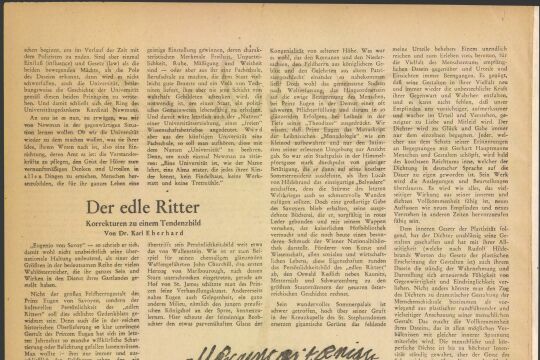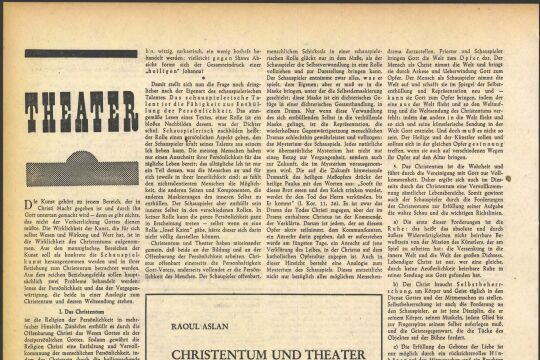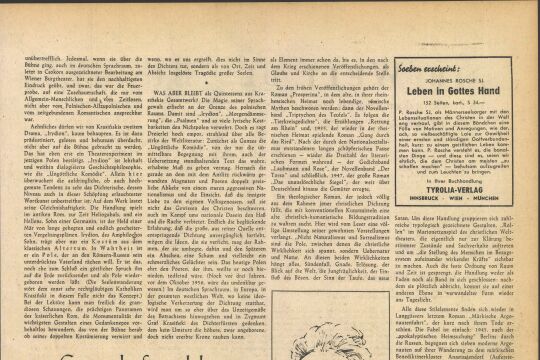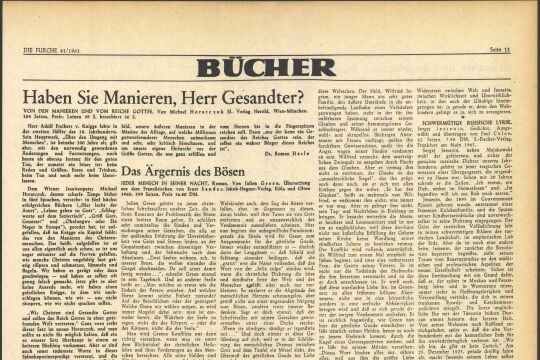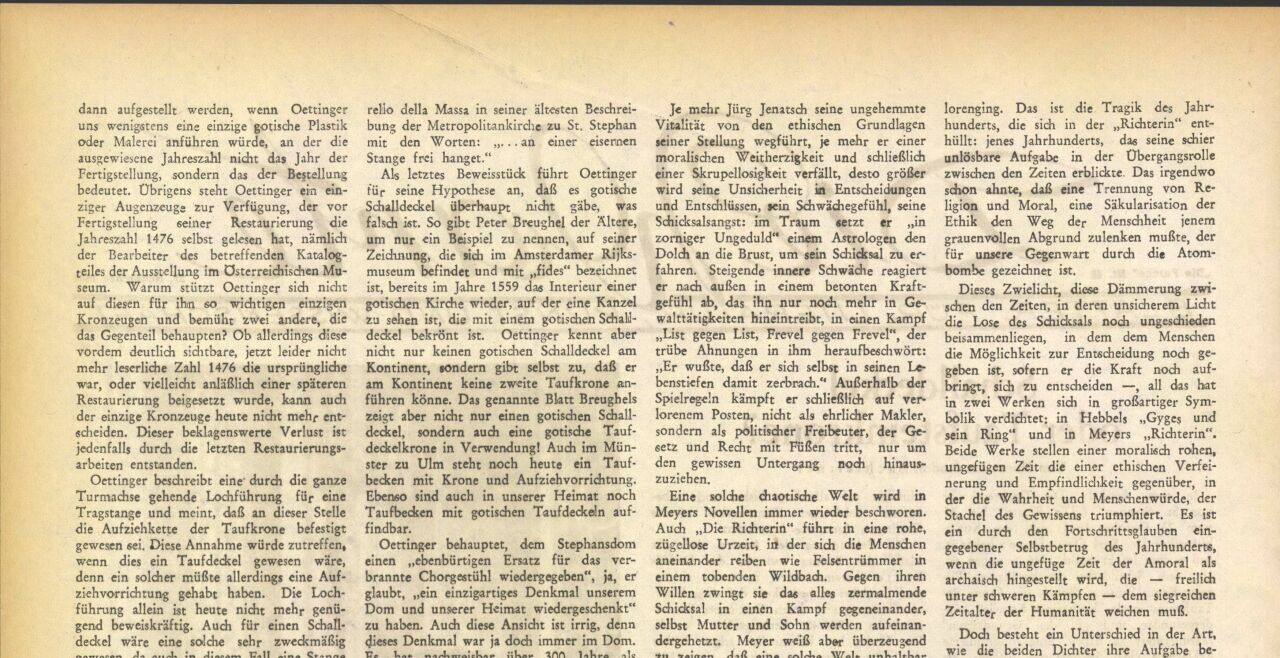
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hoffnung und Ausgang des 19. Jahrhunderts
Nodi immer leuchtet und fasziniert die farbige Welt de Erzählers Conrad Ferdinand Meyer, das rauschhafte Helldunkel seiner Balladen, seine „brokatene” Renaissanceprosa in ihrer adjektivarmen, meißelnden Knappheit, die blendende, fast schon kunstgewerbliche Einkleidungstechnik seiner Novellen. Hinter der glänzenden Fassade eines künstlerischen Raffinements, das in dieser Üppigkeit nur das 19. Jahrhundert hervorbringen konnte, verrät sich aber mehr als r— wie Meyer einmal von der Geschichte sagt — „eine Reihe schönster malerischer Kompositionen”.
Man hat sehr richtig versucht, dieses „Mehr” vom Lebensschicksal des Dichters her zu ergründen, von der Tatsache her, daß er zweimal in geistiger Umnachtung befangen war. Das mußte tiefe Schatten auf den ganzen in der Gnade geistiger Klarheit verbrachten Abschnitt seines Lebens werfen oder, wie er sich angesichts des siechen Feldherrn Pescara ausdrückt, ihm „eine Gewißheit von dem Nichts der menschlichen Pläne und der Allgewalt des Schicksals” einprägen.
Die Welt des Genfer Puritanismus und Pascals war sein entscheidender Jugendeindruck. So entscheidend, daß er alle seine Helden unter die Gewalt der kalvinistischen Prädestination, der Unentrinabarkeit des Verhängnisses stellt, weil sie ihm selbst die höchste Gewißheit ist, die das schwankende, trügerische Leben überhaupt geben kann. Seine größte Tragik ist, daß in ihr kein Licht christlicher Heilsgewißheit leuchtet; seine andere die feinnervige Empfindlichkeit des Kränkelnden, die ihn zur Flucht aus der Zeit zwingt — in die Geschichte.
„Die Geschichte ist mir größtenteils Poesie”, bekennt er in einem Briefe an Burckhardt (es ließe sich kein besserer Adressat für diese Aussage finden). Wie sieht Meyer die Geschichte? Als Geschichte der Persönlichkeiten. Nicht als Spiel kollektiver Kräfte, sondern als Spiel großer, leidenschaftlicher Persönlichkeiten. Jede von ihnen kämpft um ihre Existenz, skrupellos in der Wahl der Mittel, jede Chance einer Ausdehnung ihres Machtbereiches nützend, wenn es sein kann, bis ins Grenzenlose, aber auch jederzeit ihres Untergangs gewärtig. Ethische Rücksichtnahmen vermögen das Ausleben der eigenen Leidenschaften nicht zu hemmen, höchstens die Klugheit, die politische Taktik gebietet. Immer sind diese Menschen Getriebene, die mehr und mehr dem Diktat ihrer Existenz im Machtkampf untertan werden, ständig erleben sie, wie es in der „Versuchung des Pescara” heißt, „die große Angst und Ungewißheit, die jedem großen und gefährlichen Unternehmen vorangeht”.
Mit einer erschütternden Naivität springt oft Meyer mit den Kräften und Mächten um, deren geschichtsbildende Bedeutung wir längst erkannt haben. Der Aufruhr Thomas Beckets gegen Heinrich II. von England wird lediglich von dem Verbrechen her motiviert, das der König an der Schutzbefohlenen des Kanzlers begeht. Durch diese Tat wird sozusagen da Spielfeld geebnet, in dem Meyers Gestalten gedeihen: jene Atmosphäre vollkommener ethischer Bindungslosigkeit, die naturgemäß Verbrechen um Verbrechen großzüchtet und in der sich der Mächtige nur so lange behaupten kann, als er nicht einen noch Mächtigeren findet, der ihn gnadenlos vernichtet. Diese eine Tat verwandelt die Welt in ein Inferno: „Denn die Völker der Erde vertilgen sich und Haß ist der allmächtige König der Welt.” Daß in einer solchen Welt auch die Religion nichts als eine heuchlerische Maske ist, wird an dem Verhalten des Thomas Becket deutlich, so daß es die nachträgliche Erklärung Meyers in einem Briefe an Louise von Fnanęois, seine Seelenfreundin, nur bekräftigen kann: „In dem Akt seiner Bekehrung durchdringen sich Rachsucht und Frömmigkeit auf eine unheimliche Weise.” Auch der Glaubenswechsel des Jürg Jenatsch erfolgt aus politischer Berechnung.
Dieser Jürg Jenatsch ist die künstlerische Erfüllung des Wunschbildes, das erträumte Leben, das für Mayer niemals Wirklichkeit sein konnte. Der Schwächling an Körper und Geist, ständig bedroht von einem Rückfall in die Umnachtung, erträumt sich ein Wesen voll kraftstrotzender Vitalität, eine das Leben beherrschende und mit einem gewaltigen Willen erfüllende Gestalt. Aber dennoch stimmt von der Charakterisierung, die ihr im Verlaufe des Romans gegeben wird: „Gesetzloser Kraftmensch”, nur das Adjektiv. Denn seine Kraft kommt nicht aus dem Zentrum seines Wesens, sie ist mehr die Tarnung einer inneren Unsicherheit und Unstäte, ein Getriebensein von der dämonischen Schicksalhaftigkeit seiner Existenz, die ihn in das wilde Meer politischer Kräftespiele getrieben hat.
Je mehr Jürg Jenatsch seine ungehemmte Vitalität von den ethischen Grundlagen seiner Stellung wegführt, je mehr er einer moralischen Weitherzigkeit und schließlich einer Skrupellosigkeit verfällt, desto größer wird seine Unsicherheit in Entscheidungen und Entschlüssen, ein Schwächegefühl, seine Schicksalsangst: im Traum setzt er „in zorniger Ungeduld” einem Astrologen den Dolch an die Brust, um sein Schicksal zu erfahren. Steigende innere Schwäche reagiert er nach außen in einem betonten Kraftgefühl ab, das ihn nur noch mehr in Gewalttätigkeiten hineintreibt, in einen Kampf „List gegen List, Frevel gegen Frevel”, der trübe Ahnungen in ihm heraufbeschwört: „Er wußte, daß er sich selbst in seinen Lebenstiefen damit zerbrach.” Außerhalb der Spielregeln kämpft er schließlich auf verlorenem Posten, nicht als ehrlicher Makler, sondern als politischer Freibeuter, der Gesetz und Recht mit Füßen tritt, nur um den gewissen Untergang noch hinauszuziehen.
Eine solche chaotische Welt wird in Meyers Novellen immer wieder beschworen. Auch „Die Richterin” führt in eine rohe, zügellose Urzeit, in der sich die Menschen aneinander reiben wie Felsentrümmer in einem tobenden Wildbach. Gegen ihren Willen zwingt sie da alles zermalmende Schicksal in einen Kampf gegeneinander, selbst Mutter und Sohn werden aufeinandergehetzt. Meyer weiß aber überzeugend Zu zeigen, daß eine solche Welt unhaltbar ist, so daß er keineswegs als ein Verfechter des Immoralismu angesprochen werden kann. Die Lehre seines „Jürg Jenatsch” war es ja auch, daß ein Held, der den Boden der Moral verläßt, untergehen muß. Hier in der gewalterfüllten Urwelt erscheint das Gewissen als erstes Zeichen einer neuen Zeit, al eine Kraft, die zu einer unausweichlichen Mächtigkeit anwächst und schließlich die Heldin zur’Wahrheit zwingt. Im Lichte der Wahrheit werden die Dämmerungen dämonischer, ursprünglicher Gewalten überwunden, sie ist es, die damit das Tor zu einer hoffnungsvolleren, durch Recht und Gesetz geordneten Zeit aufstößt. Auch mit dem Tode Jürg Jenatschs ging sie mit dem Morgen der Freiheit, die er seinem Lande erkämpft hatte, auf.
Es ist nicht so, daß sich in Meyers Welt, die er mit berauschender Fülle und verwirrendem Glanz aus dem rätselvollen Meer der Geschichte emporhebt, kein Silberstreifen der Hoffnung zeigen würde. Niemals aber ist es mehr als eine vage Hoffnung. Erfüllung ist Meyers Helden versagt, ihr Schicksal wird ihnen im unerbittlichen Zugriff kalvinistischer Prädestination, es ist nicht mehr als ein „Schweben auf Todestiefe”. Eine durch Sitte, Recht und Gesetz geordnete Welt ist ihnen versagt, weil ihre stärkste Stütze, der Glaube, verlorenging. Das ist die Tragik des Jahrhunderts, die sich in der „Richterin” enthüllt: jenes Jahrhunderts, das seine schier unlösbare Aufgabe in der Übergangsrolle zwischen den Zeiten erblickte. Das irgendwo schon ahnte, daß eine Trennung von Religion und Moral, eine Säkularisation der Ethik den Weg der Menschheit jenem grauenvollen Abgrund zulenken mußte, der für unsere Gegenwart durch die Atombombe gezeichnet ist.
Dieses Zwielicht, diese Dämmerung zwischen den Zeiten, in deren unsicherem Licht die Lose des Schicksals noch ungeschieden beisammenliegen, in dem dem Menschen die Möglichkeit zur Entscheidung noch gegeben ist, sofern er die Kraft noch aufbringt, sich zu entscheiden —, all das hat in zwei Werken sich in großartiger Symbolik verdichtet; in Hebbels „Gyges und sein Ring” und in Meyers „Richterin”. Beide Werke stellen einer moralisch rohen, ungefügen Zeit die einer ethischen Verfeinerung und Empfindlichkeit gegenüber, in der die Wahrheit und Menschenwürde, der Stachel des Gewissens triumphiert. Es ist ein durch den Fortschrittsglauben eingegebener Selbstbetrug des Jahrhunderts, wenn die ungefüge Zeit der Amoral als archaisch hingestellt wird, die — freilich unter schweren Kämpfen — dem siegreichen Zeitalter der Humanität weichen muß.
Doch besteht ein Unterschied in der Art, wie die beiden Dichter ihre Aufgabe bewältigen. Hebbel stellt den Menschen in den dialektischen Kampf der Ideen hinein, die er als überindividuelle anerkennt, wodurch er die Realität der Geschichte besser trifft als Meyer. Meyer erkennt in ihr nichts als wirkende Menschen, die er zu unwirklicher Überdimensionalität steigert. Nur sie sieht er im Wirken der Geschichte, überindividuelle Kräfte vermag er nicht zu erfassen, während sie Hebbel sehr real wirken läßt und immer wieder zeigt, wie in ihrer Gewalt der Einzelmensch zerbricht.
So kommt Meyer auch nicht zu eindeutigen und klaren Lösungen wie Hebbel, er sublimiert nur da Krisengefühl des Jahrhunderts in einer tragischen Untergangsstimmung, die bisweilen durch den schwachen Schein einer Hoffnung auf eine bessere Welt erhellt wird: so wenn etwa am Ende der „Richterin” die Frage des Kaisers: „Überwindest du die Dämonen?” von Wulf- rin beantwortet wird: „Ich ersticke sie in meinen Armen! Hilf, Kaiser, daß ich sie überwältige!” In diesen Worten schlägt nochmals die Hoffnung einer ganzen Zeit empor. Daß ihr die Erfüllung versagt blieb, zeigt uns die Welt dieses Dichters in großartigen Symbolen, vor denen wir, das Ausmaß des Versagens deutlicher ermessend, als es Meyers Gegenwart tun konnte, erschüttert stehen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!