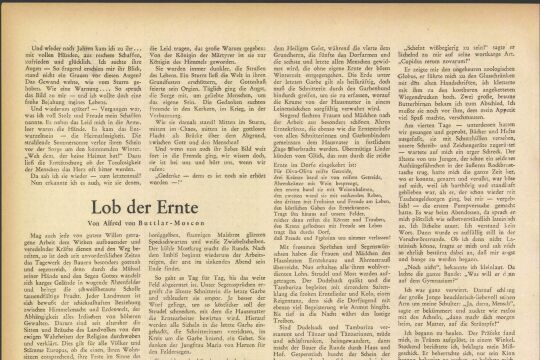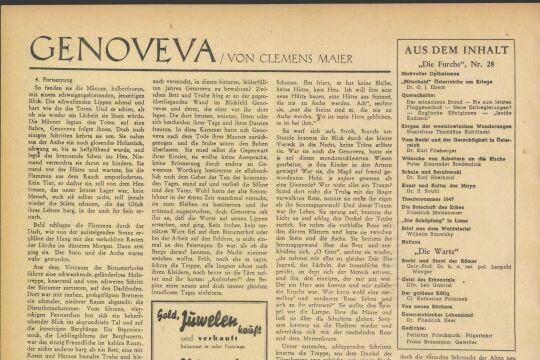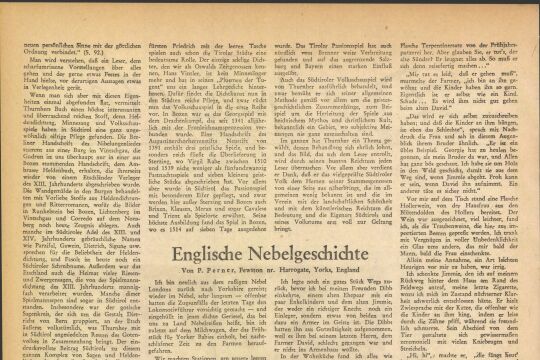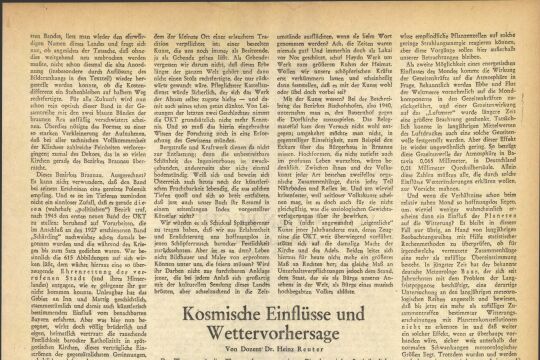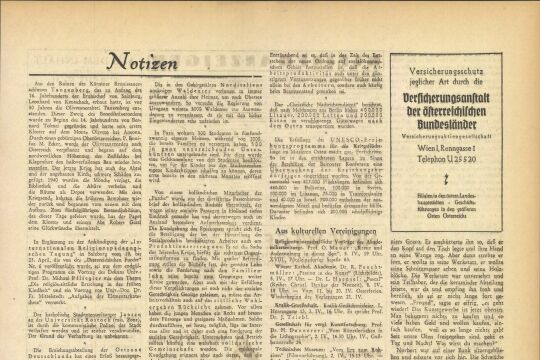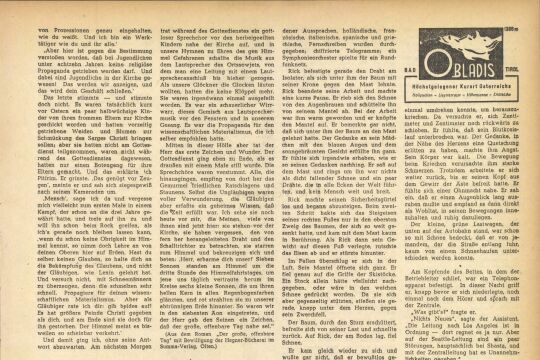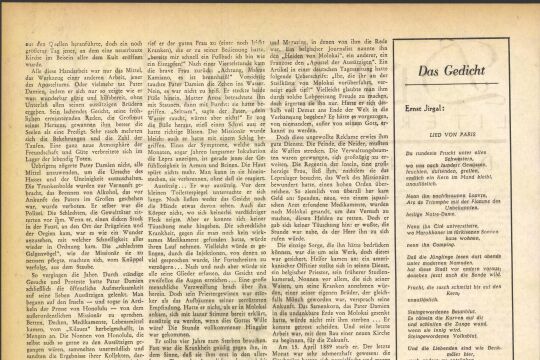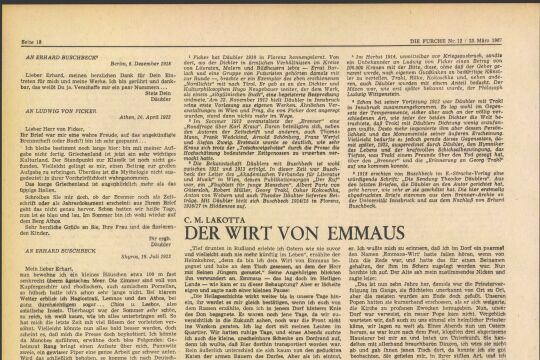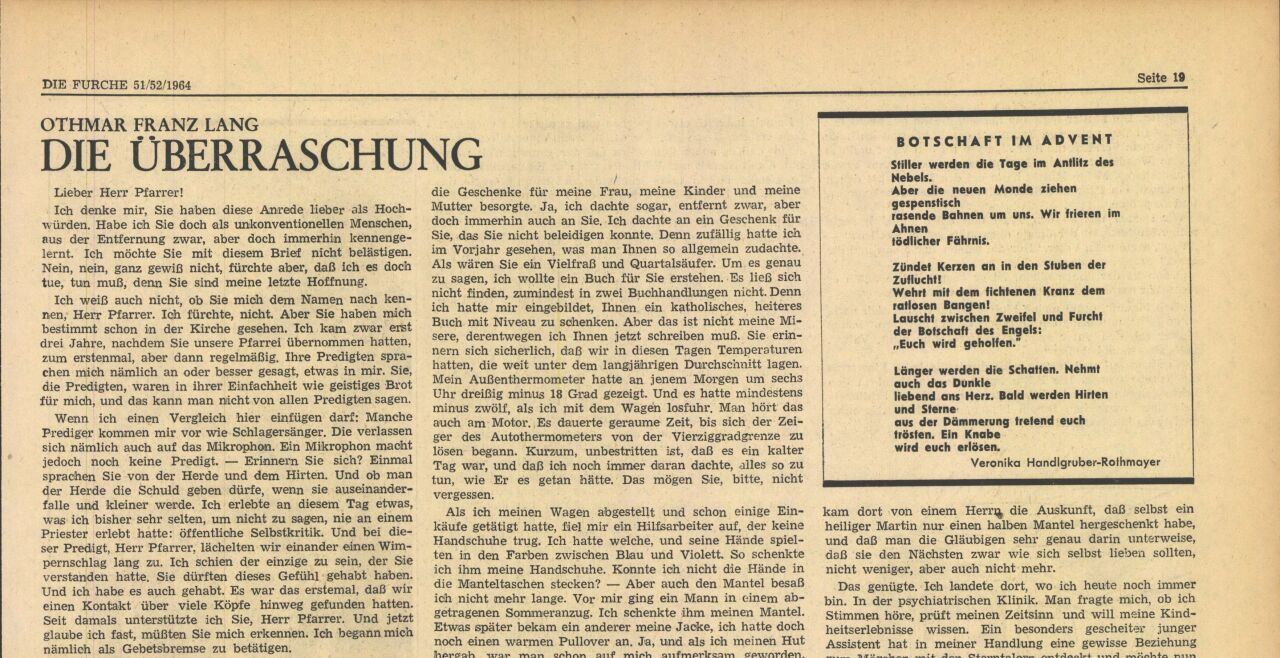
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
HOLE EINEN BRUDER AN DEN TISCH
Es war kein Haus, in dem man sehr lange wohnte. Wer hier einzog, war unten angekommen und mußte sein Brot am Grunde der Tiefe suchen, wie der Taucher die Perlen.
Manchmal nachts konnte man ein Flüstern und Rieseln hören, das nicht von menschlichen Stimmen kam. Das war das Haus; es rührte sich und seufzte.
Mit Einbruch des Winters zogen neue Mieter ein; sie hatten sogar ein Sofa. Darauf schlief der Junge. Den Namen Nino Andreoli habe ich wegen des fremdländischen Klanges nie vergessen. Er war dreizehn, dunkelhaarig, sehr blaß und still. Ich habe ihn nie mit den Jungen des Hauses zusammen gesehen. Meine Mutter sagte, er hätte immer in der Stube gesessen, allein mit der stummen, kalten Gesellschaft von Tisch, Stuhl, Bett und Schrank, denn die beiden, sein Vater und seine Mutter, waren sehr oft nicht zu Hause; aber man wußte nicht, wovon sie lebten. Wir hörten manchmal ihre Stimmen über uns; sie stritten wohl miteinander. Der Mann sprach sehr schnell. Er war keiner von uns. Dann lachten sie wieder; sie hatten sich versöhnt.
Der Winter kam damals schnell und mit großer Härte. Die Bauarbeiten mußten eingestellt werden, und mein Vater saß zu Hause am kleinen Ofen und starrte auf seine Hände. Sie waren geschaffen, auszuschachten, Ziegel zu tragen und zuzureichen. Jetzt waren sie tot und verdienten nichts. Ich war Lehrling im ersten Jahr und brachte nur meinen Hunger mit nach Hause. Es war gut, daß meine Mutter zwei Aufwartungen hatte. Manchmal brachte sie Essen mit, und das reichte dann für einen Abend. Auch andere Männer im Haus hatten keine Arbeit. Das Haus stöhnte nachts vor Kälte. Die Stuben ohne Wärme strömten ihre eisige Luft durch das Gebirge der Stockwerke und erdrückten die schwache Glut in den Öfen. Der Frost hockte auf den Treppen, sprengte die Wasserleitungen, verstopfte alles, trieb die Menschen zueinander. Manchmal gingen sie fort, aber nur das Gehen machte sie einen Augenblick warm, denn Arbeit gab es nur, wenn sie in den Straßen Schnee schaufeln konnten. Mein Vater ging mit ihnen. Wir warteten damals nicht auf Weihnachten, meine Eltern bestimmt nicht; ich schon, ein wenig. Mein Vater wollte keinen Baum sehen, er konnte ja nur seine leeren Hände auf den Tisch legen. Meine Mutter sagte, einen kleinen Baum müßten wir haben, und ich holte auch einen in der Dämmerung, draußen aus dem Stadtpark.
Es war doch besser, als wir gedacht hatten, denn die Mutter brachte von ihrer Aufwartung eine Menge Sachen zum Essen mit, auch Gebäck, für den Vater ein Paar Socken, für mich eine Strickjacke, an der die Ärmel ein bißchen zu kurz waren, und die Mutter hatte einen Kragen aus schwarzem Krimmer geschenkt bekommen. Ich wollte der Mutter ein kleines Wandbrett mit Haken schenken, das ich selber gemacht hatte; man konnte Handtücher und Wischtücher daran aufhängen.
Am Nachmittag waren mein Vater und ich zu Hause, und wir hatten gerade aufgewaschen und alles sauber gemacht und waren dabei, den kleinen Baum zu schmücken. Mein Vater war auf einmal froh geworden; eine saubere, warme Küche gibt auch gute Gedanken.
Dann hörten wir Stimmen im Haus, und wir wußten gleich, was für Stimmen es waren. „Die Polizei, Vater“, flüsterte ich. Mein Herz verkroch sich. — „Nicht zu uns, mein Junge“, sagte mein Vater. „Ich habe es ja kommen sehen, da oben stimmt es doch nicht.“
Wir lauschten. Das ganze Haus war zum Ohr geworden, und es war gierig nach oben gereckt, um alles zu hören. Über uns sprachen Stimmen gegeneinander; die ruhigen Stimmen der Polizei, die schnelle, heftige Stimme Andreolis, dazwischen das hohe, spöttische Lachen der Frau. Dann wurde es still. Die Schritte der Polizei kamen wieder herab und umschlossen die Schritte Andreolis und seiner Frau.
„Man hat sie geholt“, flüsterte ich. „Was haben sie denn getan?“ — „Ich weiß nicht“, sagte mein Vater. „Wer weiß, was sie getan haben. Es ist ein Elend in der Welt. Mein Junge“, sagte er, „es ist genug da von allem, genug in der Welt. Aber es ist nicht richtig verteilt.“
Was ging uns das an. Wir hießen nicht Andreoli, wir hatten nichts gestohlen oder uns an einer dunklen Geschichte beteiligt.
Dann kam meine Mutter mit den Geschenken und mehr als ein paar Worte redeten wir nicht von der Sache. Wir wollten den Heiligen Abend feiern; einmal wollten wir die Armut vergessen. Wir hatten einen Baum. Ein paar kleine Kerzen brannten. Die Mutter legte die Sachen, die sie geschenkt bekommen hatte, unter den Baum auf den Tisch, und ich holte aus meinem Versteck die fünf Zigarren für den Vater und das kleine Wandbrett für die Mutter hervor. Ich bekam etwas Wunderbares. Meine Mutter hatte bei den Leuten, bei denen sie wusch, ein Paar alte Schlittschuhe geschenkt bekommen, und sie paßten.
Wir setzten uns an den Tisch und aßen. Plötzlich sagte meine Mutter: „Ist der Junge oben auch geholt worden?“ — „Nein“, sagte mein Vater. „Nur die beiden, der Mann und die Frau.“
„Dann ist der Junge allein. Ist er oben?“ Wir wußten es nicht. Wir hatten nichts gehört, über uns war es still.
„Geh hinauf“, sagte meine Mutter zu mir, „und sieh nach, ob er da ist, und bring ihn herunter. Er soll mitessen.“ Meine Mutter sah den Vater an. „Es schmeckt mir nicht, Vater“, sagte sie. „Nein, hole ihn.“
Ich stand auf und tastete mich durch die kalte Finsternis die Treppe empor. Die Kälte hatte wie ein Hund in den Ecken gelegen und fiel midi an. Ich sah durch das Schlüsselloch einen schwachen Schein fließen, und ich beugte mich nieder, um hindurchzublicken.
Damals habe ich etwas gesehen und es nie mehr vergessen. Zum erstenmal sah ich, wie es ist, wenn einer allein ist, so allein, daß es außer ihm selbst auf der ganzen Welt nichts gibt, als Finsternis und Kälte. Ich sah eine Kerze, die auf dem Tisch stand, und in ihrem Schein, der sich kaum bewegte, das Gesicht des Jungen. Er starrte in das Licht, reglos, er hatte den Kopf in die Hand gestützt. Er war allein. Das habe ich begriffen. Allein in der Welt voller Menschen.
Ich klopfte an die Tür und trat ein. Ich blieb an der Tür stehen. Er sah mich an, ohne aufzustehen. „Nino“, sagte ich, „du möchtest zu uns kommen und mitessen.“ Er sah mich an, und sein Gesicht war blaß. Und dann fiel sein Kopf mit dem dunklen Haar, als wäre er von einer schrecklichen Hand abgeschlagen worden, auf seine Arme.
„Komm mit“, sagte ich, „meine Mutter schickt mich. Wir essen gerade.“ Er rührte sich nicht.
Zögernd ging ich hinaus, stolperte durch die Finsternis hinab und machte unsere Tür auf. Wunderbar schwebte mir die Wärme entgegen und liebkoste mein Gesicht. „Er kommt nicht, Mutter“, sagte ich. „Er sitzt beim Tisch und sagt nichts.“
„Ich hole ihn“, sagte meine Mutter, „er kann nicht allein da oben bleiben, und wir lassen es uns gut sein ..Sie stand auf und ging hinaus, und wir saßen still beim Tisch und warteten. Es muß immer einer vom Tisch aufstehen, und ich glaube, daß bei den großen Worten und den großen Botschaften etwas ist, was den Menschen erlaubt, sich zu verbergen und sitzenzubleiben. Meine Mutter hat nur gesagt: „Er soll unsere Suppe mit uns essen.“ Wir haben nicht gehört, was meine Mutter mit dem kleinen Andreoli gesprochen hat. Nach einer Weile ist die Tür aufgegangen, und aus der Finsternis trat sie mit dem Jungen herein. Sie hatte ihren Arm um seine Schulter gelegt und führte ihn an unseren Tisch.
„Setz dich, mein Junge“, sagte mein Vater, „und iß mit uns.“ Er saß bei uns und aß unsere Suppe, und meine Mutter füllte ihm den Teller mit Kartoffeln und Fleisch. Wir sprachen nicht von seinem Vater und seiner Mutter. Meine Eltern fragten ihn, wo sie gewohnt hatten und so etwas, und er antwortete.
„Du mußt heute hier unten bleiben“, sagte meine Mutter, und zu mir: „Ihr könnt zusammen schlafen.“ Wir tranken unseren Kaffee, der heute etwas schwärzer war, und meine Mutter tat für jeden einen kleinen Löffel Zucker hinein. Wir aßen von dem Gebäck, und ich spielte auf meiner Mundharmonika die alten Lieder. „Vielleicht kann Nino auch spielen“, sagte meine Mutter, und ich klopfte die Harmonika auf den Knien ab und gab sie ihm. Er sah mich an und lächelte. Es war ein zartes, ein bißchen schüchternes Lächeln, das in seinem Gesicht erschien. Er hob die Harmonika an den Mund und spielte, zuerst žaghaft und dann sehr schön voll und mit Zungenschlag, und dabei sah er zu Boden.
„Er spielt gut“, sagte mein Vater. — „Ja“, sagte ich, „er spielt viel besser als ich.“
Dank, Dank! spielte er. Ich bin nicht allein. Nicht mehr allein.
(Aus dem Band „Ein Licht auf Erden’, Advents- und Weihnachfsbuch, Nymphenburger Velagshandlung München.)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!