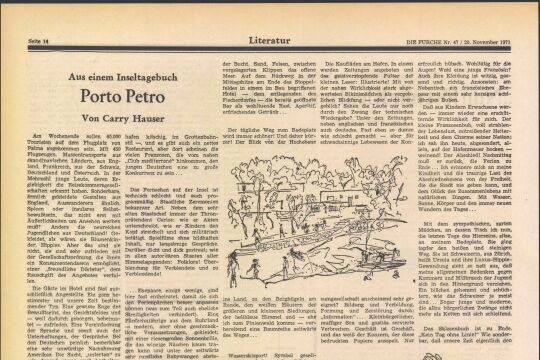Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Hunger und Heimweh im Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Italiener verachten Deutsche, Deutsche verachten Polen, Polen verachten Iren, alle verachten Schwarze und alle werden von Amerikanern (die ein paar Generationen vorher ebenfalls Einwanderer waren) verachtet. Die Geschichte Amerikas hat Annie Proulx als Geschichte der großen Träume vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten, des harten Überlebenskampfes und des Ringens um die Erhaltung der eigenen Identität mit Hilfe der Volksmusik ganz meisterhaft erzählt. Als roter Faden durch ihre dichten, pulsierenden Bilder zieht sich die Geschichte des grünen Akkordeons. Es wurde von einem italienischen Einwanderer mit Liebe gebaut und gespielt und wechselt im Lauf der Jahre oft den Besitzer und den Sound und hilft Generationen Heimwehkranker verschiedenster Nationalitäten psychisch zu überleben.
Das Instrument bildet den Ausgangspunkt der halbdokumentarischen Geschichten, die von der Autorin aus alten Zeitungsnotizen, Musikarchiven und Begionalmuseen zusammengetragen wurden und den Leser nicht in die Unverbindlichkeit der Fiktion entlassen, sondern mit der dramatischen Bealität konfrontieren.
Sie sind alle arm, wenn sie kommen, und fast alle bleiben es über viele Generationen hinweg. Anfangs glauben sie noch an das „Land der Gerechtigkeit”, doch schon der Akkordeonbauer, der in den Docks von New Orleans schuftet, abends in einem Bretterverschlag sein geliebtes Instrument spielt und von einem eigenen Akkordeongeschäft träumt, muß erkennen: „Die Amerikaner behandeln uns wie billige Schuhe. Sie kaufen sie billig, laufen lange und ausdauernd darin herum, und wenn sie durchgelatscht sind, schmeißen sie sie weg und kaufen sich neue. Jeden Tag kom men ganze Schiffsladungen solcher Schuhe.” Er wird 1891 „irrtümlich” Opfer der Lynchmorde an neun Italienern durch die „Amerikanische Patriotische Liga”.
Auch die deutschen Einwanderer, bei denen das grüne Akkordeon landet, sind mit Ausländerhaß konfrontiert. „Go the hell back to Dutchland” steht in manchen Bars. Im April 1918 erfährt der Deutschenhaß seinen Höhepunkt: Ein junger Mann wird von 50 Bergarbeitern nackt durch Illinois gehetzt und gezwungen, die amerikanische Fahne zu küssen. Geteert und gefedert wird er schließlich stranguliert. Die wirtschaftliche Krise dehnt die Zielgruppen des Hasses immer weiter aus: Rote, Juden, Katholiken - alle Ausländer, nicht nur Deutsche.
Bald sind es französische Einwanderer, die das Akkordeon von ihrer aussichtslosen Situation ablenkt. Kinder ohne Chance auf Bildung, verlassene Frauen, betrunkene Männer, Morde, Vergewaltigungen und schier unerträgliche Lebensverhältnisse bestimmen den Alltag. Die Sehnsucht nach der Musik der Vorfahren und den alten Einwanderergeschichten sind der Strohhalm, der das Uberleben psychisch ermöglicht und die Abgrenzung von anderen Volksgruppen dokumentiert.
1950 landet das Instrument schon ziemlich lädiert bei polnischen Einwanderern, die, als die ersten Schwarzen in ihren Vierteln auftauchen, mit Gewalt reagieren: „Hier wohnen anständige, schwer arbeitende Polen, verschwindet, ihr Niggers, ihr versaut uns unsere Häuser, macht daß ihr weiterkommt, ihr Hundsgeburten...” rufen die, die einst von Jungen mit Steinen beworfen und „dreckige Polacken” genannt wurden. In den sechziger Jahren kamen
Festivals der Volksmusik auf, die unter dem Motto „Polish ist beautiful” vor allem gegen Schwarze gerichtet waren.
Auch Iren spielen auf dem grünen Akkordeon, auch sie sind mit Fremdenhaß und Gewalt im Alltag groß geworden: Noch vor der Jahrhundertwende mittellos nach Amerika gekommen schlössen sich Jugendliche in New York zu Gangs zusammen, die unter dem Namen Lads of Ireland „fröhlich Schwarze zusammenschlugen, bei Lynchjustiz mit von der Partie waren und auch bei dem Mob, der das Waisenhaus für farbige Kinder in der Fifth Avenue anzündete”. Aus der irischen Heimat holen sie sich, sobald sie das dürftige Überleben auf einer Banch für gesichert halten, ihre „Postversandbräute”, um Familien zu gründen.
Die Norweger in Minnesota passen sich auch nur äußerlich an. In der Familie lebt man streng nach dem „Leitfaden für Emigranten zur Wahrung der norwegischen Kultur”, singt die alten traditionellen Lieder und verteidigt die alten Bräuche, bis sie von Popcorn, Hamburger und Blues überrollt werden.
Die krampfhaften Versuche der Anpassung und gleichzeitig Ausgrenzung anderer dauern an. Ein Nachkomme lettischer Einwanderer fühlt sich heute als richtiger Amerikaner: „Das Land versinkt ja unter all den Leuten - Chinks und Spicks und Pa-kis und diese Araber aus Mittelost. Das ist nicht dasselbe wie damals, als unsere Großeltern rübergekommen sind: die waren weiß, die hatten Mumm, 'ne gute Arbeitsmoral, die liefen nicht rum und sprengten Gebäude in die Luft. Die sind dunkelhäutig, Bastarde. Ganz einfach, das Boot ist voll, nicht mehr genug Platz im Land, nicht genug Arbeitsplätze.”
Die tristen und tragischen Szenen des Alltags der Einwanderer kann man mühelos bis zur Realität türkischer oder afrikanischer Gastarbeiter in Europa mitsamt den aktuellen Gewaltakten ihnen gegenüber weiterspinnen. Dazwischen geben die Schilderungen der Folklore-Musik-Abende in verrauchten Hinterzimmern, mit dampfendem, stampfendem Publikum ih verzweifelter Ekstase, krank vor Sehnsucht nach der Heimat und nach den Gerüchen der Nationalgerichte, dem Roman heimatlichen „sound” und Rhythmus. Jede Liebe beginnt bei folkloristischen Liedern und sie flammt dabei immer wieder auf, wenn schon längst Hoffnungslosigkeit und Hiebe die Ehe bestimmen.
Die sprachliche Gewalt der Autorin; die das Leben und Leiden der vielen Generationen mitsamt den psychischen und physischen Opfern, die für das alltägliche Überleben gebracht werden, spürbar macht, zeichnet diesen Roman aus. Und es gelingt ihr auch, die Volksmusik in ihren vielen Facetten als Trägerin aller Gefühle und Sehnsüchte, aller oft längst verschütteten (Un-)Menschlichkei-ten zu begreifen. Musik, die jenseits des Verstandes und des Alltagstrotts die direkte Verbindung zwischen den Wurzeln und den Träumen herstellt, die sich wie die Menschen in Amerika anpaßt, fremde Einflüsse annimmt, ihre Wurzeln aber nie verleugnet und so weiterlebt und weiterleben läßt. Nur die Musik ist es, die auch den Ärmsten ein kurzes Innehalten im Strudel des „Fressens und Gefressenwerdens” ermöglicht.
Der Abstieg des grünen Akkordeons ist unaufhaltsam: Über viele Jahre wurde es liebevoll gepflegt, repariert, gefettet, geölt und erfreute ärmliche Spieler und Zuhörer mit seinem herben Klang. Am Schluß wird das kaputte Instrument, das seinem letzten Besitzer nur noch als Versteck für seine Ersparnisse diente, von einem LKW zerquetscht.
Verwahrloste Einwanderer-Kinder am Straßenrand kaufen sich mit einem der herumfliegenden Tausend-Dollarscheine einen Eislutscher und träumen - wie der italienische Akkordeonbauer vor über hundert Jahren - von Reichtum und Sorglosigkeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!