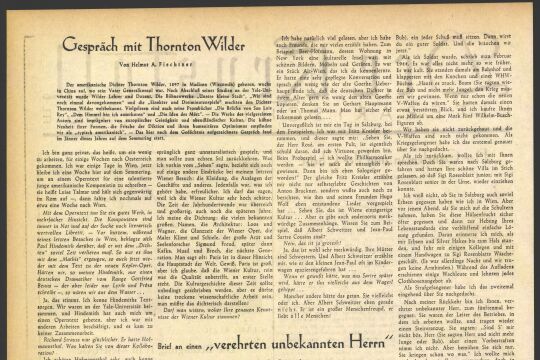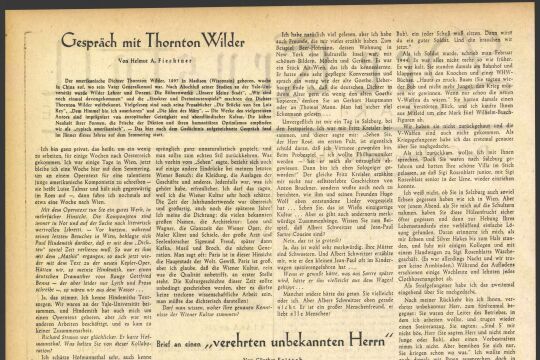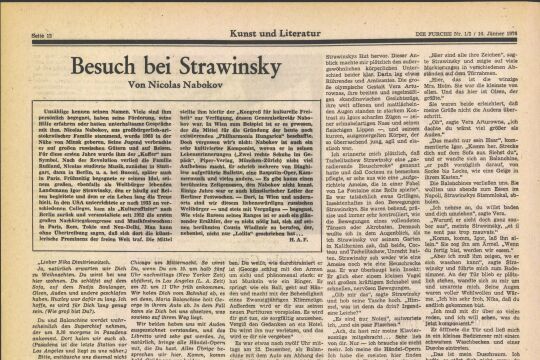„ICH BIN KOMPONIST“
Ein Gespräch mit dem polnischen Avantgardemusiker Krzysztof Penderecki
Ein Gespräch mit dem polnischen Avantgardemusiker Krzysztof Penderecki
FURCHE: Herr Penderecki, Sie lehren Komposition an der Musikschule in Krakau und seit 1966 auch an der Folkwang- schule in Essen. Unterrichten Sie gerne?
PENDERECKI: Früher tat ich das sehr gerne. Schon bevor ich an der Krakauer Musikhochschule die Endprüfung abgelegt habe, unterrichtete ich dort, also seit mehr als zwölf Jahren. Jetzt habe ich schon genug davon; zunächst einmal schreibe ich viel mehr als früher, ich habe mehr Aufträge und mehr Interessen. Außerdem ist entscheidend, wer als Schüler zu mir kommt. Hier in Deutschland gibt es leider keine Aufnahmsprüfung; wenn jemand kommt, um bei mir Komposition zu studieren, so wird er einfach angenommen. Bei uns in Polen ist das anders: Auf einen Studienplatz warten normalerweise zehn bis zwanzig Studenten; sie werden eine Woche lang geprüft, und derjenige, der dann aufgenommen wird, ist der Beste. Hier dagegen darf jeder bei mir studieren, auch wenn er keine Ahnung hat. Ich glaube auch, daß die Vorbereitung in Deutschland nicht gut ist; die Konservatorien, die ich kenne, sind alle schlecht. Volksmusikschulen wie in Polen gibt es nicht. Dort hat ein Student bereits zwölf Jahre Musikunterricht hinter sich, hier nennen sich Leute „Komponist“‘, die in Wirklichkeit keinen zweistimmigen Kanon schreiben können.
FURCHE: Man bezeichnete die Uraufführung Ihrer Lukas- Passion als das Ereignis der Kirchenmusik unserer Zeit. Gilt für die Passion die Bezeichnung „Kirchenmusik"?
PENDERECKI: Eigentlich ja; auch ich würde meine Passion nicht zuletzt wegen des Textes so bezeichnen; besser aber scheint mir, sie ein geistliches Werk zu nennen, das hat eine breitere Bedeutung. Denn nicht nur die Darstellung des Leidens Jesu Christi ist der Zweck meiner Passion. Das Leiden Jesu ist vielmehr ein Symbol für die Leiden der Menschen in unserem Jahrhundert.
FURCHE: Demnach handelt es sich bei der Passion um ein engagiertes Kunstwerk und ist auf diese Weise durchaus ihrer Komposition „Threnos“, dem Klagegesang auf die Opfer von Hiroshima, vergleichbar?
PENDERECKI: „Threnos“ hieß ursprünglich „8 Minuten 37 Sekunden“, das war die Zeitdauer des Stückes. Erst nachdem ich mit dieser Komposition auf einem Wettbewerb einen Preis gewonnen hatte, und es noch keinen rechten Titel hatte, nannte ich es „Threnos“. Ich hätte natürlich etwas anderes schreiben können, insofern ist „Threnos“ engagiert. Manche Kritiker schrieben darüber, das sei illustrative Musik, das kommt natürlich gar nicht in Frage, weil der Titel, wie ich bereits gesagt habe, später gegeben wurde. Bei der Komposition war ich in keiner Weise dadurch beeinflußt.
FURCHE: Demnach wollten Sie gar keinen „Klagegesang auf die Opfer von Hiroshima“ komponieren?
PfirtoiERECKI: Nein unÖ ja.’ ¿Silit wollte ich. eigens ein Retjtii m ‘Mirfeiben, hafte äireFI&fäi’doch dieses Werk genommen und ihm diesen Titel gegeben.
FURCHE: Kann man dementsprechend die Passion als einen Klagegesang auf die dem polnischen Volk durch die Nationalsozialisten zugefügten Leiden deuten?
PENDERECKI: Ja, durchaus. Ich bin Pole und habe das doch alles miterlebt; aber ich glaube, daß die Bedeutung weiter zu fassen ist. Es handelt sich nicht nur um eine polnische Passion, andere Nationen und Völker sind ebenso eingeschlossen.
FURCHE: Der katholische Publizist W. Dirks schrieb, Christi Peiniger seien SS-Schergen und verführte Massen, die gefolterten Opfer des Terrors und Christus seien identisch.
PENDERECKI: Dirks schrieb das als seine persönliche Meinung. Meine ist es nicht. Ich würde sagen, diese Deutung ist zu einseitig. Vor allem handelt es sich bei der Passion doch auch um ein musikalisches Werk.
FURCHE: Betrachten Sie die verwendete Tonfolge b-a-c-h als Chiasmus, also als ein Klangsymbol, wie es im 18. Jahrhundert für das Kreuz gebräuchlich war?
PENDERECKI: Ja; darüber hinaus ist diese Tonfolge eine Verbeugung vor J. S. Bach und drittens bedeutet sie für mich eine gewisse Struktur: Der ganze Kreuzweg in der Passion, die Passacaglia, ist auf b-a-c-h aufgebaut.
FURCHE: Rolf Liebermann, der Intendant der Hamburger Staatsoper, ließ verlauten, daß Sie für ihn eine Oper schreiben werden.
PENDERECKI: Ich schreibe für Hamburg die Oper „Die Teufel von Loudun“ nach Huxley; dafür habe ich bereits ein Libretto. Daneben arbeite ich an einer Oper „Ubu roi“ nach Jarry. Der Termin für diese Uraufführung steht leider auch schon fest: München 1970.
FURCHE: Schreiben Sie die Libretti selber?
PENDERECKI: Für die Huxley-Oper habe ich es selber nach dem Stück „Die Teufel“ von J. Whiting geschrieben. Für „Ubu roi“ schrieb es mir ein Dramaturg.
FURCHE: Pierre Boulez sagte in seinem „Spiegel“-Interview vom vergangenen Herbst, vertonte Literatur sei steril. Offensichtlich teilen Sie seine Ansicht nicht?
PENDERECKI: Nein. Grundsätzlich möchte ich sagen, daß Boulez etwas Gutes getan hat; er hat mit seinen Thesen die Leute berührt und aufgeschreckt. Anderseits glaube ich aber, wenn ein Komponist wagt, so etwas zu sagen, dann muß er beweisen, daß er seine Vorstellungen auch realisieren kann. Ich sehe deshalb einer Oper von Boulez mit großer Spannung entgegen. Vielleicht hat er sogar recht, daß ein Opernlibretto direkt geschrieben werden sollte; aber sehr vieles existiert nun schon einmal in der Literatur, sei es als Legende, als Roman oder als Theaterstück.
FURCHE: Wie werden Ihre beiden Opern aussehen? Werden Sie hergebrachte Formen heranziehen ?
PENDERECKI: Ich schreibe Opern, richtige Opern, keine Happenings, wie sie jetzt in Mode sind. Das fände ich zu leicht
FURCHE: Sie denken dabei an Cage, Kagel, Ligeti ?
PENDERECKI: Ligeti ist doch ein Komponist, Namen möchte ich keine nennen. Die Frage, welche Musik ich schreiben werde, ist schwer zu beantworten; meine Musik natürlich und diese wird anders sein als in der Passion. Dabei handelte es sich um ein geistliches Stück und ich brauchte all jene Mittel, die ich normalerweise verwende, nicht einzusetzen. Dort waren Text und Symbol wichtig, bei einer Oper wird es vor allem der Text sein. Ich kann dann auch alle meine Mittel, also die für Streicher, Chor usw., verwenden, ich möchte meinen Stil schreiben.
FURCHE: Haben Sie einen Opernkomponisten als Vorbild?
PENDERECKI: Sie werden enttäuscht sein, aber, ich mag Rossini sehr gerne; ich glaube, er ist einer der größten Meister der Oper überhaupt. Neben ihm natürlich Mozart — das soll aber nicht heißen, daß ich auch in dieser Richtung meine Opern schreiben werde; ferner „Boris Godunow“1
FURCHE: Werden Ihre Opern tendenziös, ohne ideologische Zielsetzung sein oder aber wird es sich dabei wieder um engagierte Kunstwerke handeln?
PENDERECKI: Das Letztere ist der Fall. Der erste Stoff behandelt Hexenprozesse aus dem 17. Jahrhundert; das hat viel Ähnlichkeit mit den letzten Prozessen, ich werde auch sagen, mit welchen. Ich glaube, dieser Stoff ist sehr aktuell, Toleranz ist immer aktuell; das wird sicherlich ein ganz engagiertes Stück. „Ubu roi“ ist eine Parodie; das Problem ist ähnlich wie bei Huxley; ich werde zwar hierbei ein ganz lustiges Stück schreiben, aber ich glaube, König Ubu könnte auch Hitler sein, manches ähnelt sich; natürlich kann man Ubu roi nicht mit Hitler gleichsetzen, das wäre zu einfach; aber auch diese Oper möchte ich nicht nur zur Unterhaltung schreiben.
FURCHE: Glauben Sie, daß Ihre Bemühungen um die Oper heute noch einen Sinn haben?
PENDERECKI: Leider haben wir überall, in Deutschland, in Polen usw., ein Publikum für Oper, ein Publikum für Konzert, für Operette; das Publikum ist geteilt und hat in seinen Gruppen nur ganz spezielle Interessen. Neue Werke zu begreifen ist es meist gar nicht imstande; daran kann man plötzlich gar nichts ändern. Aber bedenken Sie, die Oper hat heute vielfältige neue Möglichkeiten, auch technischer Art, und ich glaube, daß man auf diese Weise ein neues,
ganz junges Publikum anziehen kann. Das ist nach meiner Meinung die einzige Möglichkeit; denn sonst lohnt es sich nicht, eine Oper zu schreiben, sie zwei- oder dreimal aufzuführen und dann in die Schublade zu legen.
FURCHE: Denken Sie bei den neuen Möglichkeiten an elektronische Klangmittel?
PENDERECKI: Nein. Ich werde meine Opern nur für konventionelles Orchester schreiben; man kann aus einem solchen Orchester noch sehr viel mehr herausholen, als man gemeinhin glaubt. Es ist nicht gut, verschiedene Klangmittel zu mischen; ich würde, um ein Beispiel zu nennen, niemals versuchen, ein Stück, sagen wir, für Oboe-Solo und Tonband schreiben, und doch ist es schon unzählige Male versucht worden. So etwas ist für meine Begriffe das Schreckiichste, was es überhaupt gibt. Natürlich, wenn ich in der Huxley- Oper Glocken benötige, so kann ich kaum richtige Glocken während der Aufführung heranziehen, vielmehr muß ich diese auf Tonband haben
FURCHE: mehr aus aufführungstechnischen Gründen
PEDERECKI: ja natürlich; obwohl, um noch einmal darauf zurückzukommen, es natürlich viel leichter wäre, im elektronischen Studio mit Stimmen zu arbeiten, anstatt einen komplizierten Chor zu schreiben. Aber beide Mittel passen einfach nicht zusammen, das ist, obwohl immer wieder praktiziert, hinlänglich bekannt; ich jedenfalls könnte kein Stück nennen, das gut ist.
FURCHE: Wie ist es bei der Filmmusik?
PENDERECKI: Das ist etwas völlig anderes. Beim Film ist die Musik Nebensache, ebenso beim Theater. Ein Film kann ein Kunstwerk sein, aber sehr selten trifft das für die Filmmusik zu. — Ich sehe mehr Möglichkeiten beim Orchester, wenn, und das ist die Voraussetzung, die Orchester und die Dirigenten gut sind. Karajan hat in Berlin mein ganz abstraktes Stück „Polymorphia“ auf geführt. Was kann ein so genialer Dirigent alles mit solch einem Werk machen! Das war für mich, als ich es vor acht Jahren geschrieben habe, nur theoretisch denkbar.
FURCHE: Sie glauben also, daß man auch bei den herkömmlichen Instrumenten neue klangliche Möglichkeiten finden kann?
PENDERECKI: Darin bin ich absolut sicher; natürlich wird man endlich neue Instrumente brauchen; leider hat man sich in den letzten Jahren zwar viel mit elektronischen Instrumenten befaßt, dabei aber leider ganz vergessen, die eigentlichen Musikinstrumente weiterzuentwickeln. Es wäre beispielsweise an der Zeit, endlich die Klarinetten umzubauen, damit sie leichter spielbar würden, ein größeres Volumen und mehr Tonfarbe bekämen. Die letzten neuen Instrumente wurden Ende des 19. bzw. Anfang unseres Jahrhunderts gebaut.
FURCHE: Sehen Sie keine Möglichkeit, durch bestimmte Kompositionen Ihrerseits einen Anstoß dazu geben zu können?
PENDERECKI: Nur dann, wenn ich jemanden kennen würde, der dafür Interesse hätte, das müßte zweifellos ein Erfinder sein; mich würde es schon reizen, damit zusammenzuarbeiten. Ich selber habe schon ein Konzert für Violino grande geschrieben, ein Instrument mit fünf Saiten, etwas größer als Geige und Bratsche; sein Ton ist auch stärker, für klassische Musik ist es nicht geeignet. Aber das wäre schon eine Möglichkeit. Leider ist dieses Instrument fast völlig unbekannt und gänzlich unpopulär, es gibt davon nur ein Exemplar, das in Schweden gebaut wurde.
FURCHE: Bestände nicht die Möglichkeit, Instrumente etwa aus der asiatischen Musik zu übernehmen?
PENDERECKI: Voraussetzung dafür wäre zunächst, diese Musik sehr gut zu kennen; denn die Klangwelt solcher Instrumente ist doch ganz anders und eigentümlich. Wir sind Europäer und lassen uns so schnell nicht von unseren Gewohnheiten abbringen. Die Frage nach neuen Instrumenten ist schwer zu beantworten. Wenn das alles ein wenig leichter wäre, hätte man sicherlich schon andere neue Instrumente entwickelt; eine präzise Vorstellung habe ich leider nicht, möchte aber abschließend noch einmal betonen, daß ich es nicht für gut halte, normale Instrumente elektronischSzu ver-- stärken, das hat einen negativen Einfluß au£ die. Tonqualitäti3 es klingt häßlich.
FURCHE: Welche weiteren Pläne, neben den beiden Opern, haben Sie noch?
PENDERECKI: Ich arbeite an einer russischen orthodoxen Messe. Eigentlich sind es zwei Messen, eine Grab- und eine Auferstehungsmesse, beide mit altrussischen, kirchenslawi- schen Texten. Ich hoffe, die erste Hälfte gelangt 1969 zur Uraufführung.
FURCHE: Handelt es sich dabei wieder um eine Auftragskomposition?
PENDERECKI: Diese Messe entsteht im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks.
FURCHE: Halten Sie das Verfahren der Auftragskomposition für sinnvoll?
PENDERECKI: Eigentlich hat sich in der Musikpraxis gegenüber früher nichts geändert. Früher war es der Fürst, der den Auftrag erteilte, heute ist es der WDR. Ich schreibe eine Messe, die mich interessiert; ich würde sie auch ohne einen Auftrag schreiben. Wenn ich einen Einfall habe und mit der Komposition beginne, sehe ich mich nach der besten Möglichkeit um, das Stück aufführen zu können. Früher war das anders. Aber trotzdem finde ich es sinnvoll, daß Komponisten Aufträge erhalten, das ist die einzige Möglichkeit, um vom Komponieren leben zu können. Das ist natürlich ein schlechter Beruf, wenn es nur wenige Aufführungen gibt.
FURCHE: Zählen Sie sich auch heute noch zur unentwegt experimentierenden Avantgarde oder tendieren Sie, nachdem Sie eine erfolgreiche „Klangforscherzeit“ hinter sich gebracht haben, zu einer konsolidierten Tonsprache?
PENDERECKI: Es ist schwer, sich selbst zu definieren, zu sagen: zu der Partei gehöre ich. Ich bin Komponist, das allein interessiert mich. Das Wort Avantgarde erschreckt mich immer ein wenig, ich glaube, es hat einen negativen Beigeschmack. Es gibt Komponisten, deren Beruf es ist, Avantgardist zu sein, selbst mit sechzig Jahren noch. Weil sie eigentlich nichts zu sagen haben und hinter ihrer Musik nichts steckt, müssen sie immer noch Neues erfinden, um beim Publikum anzukommen. Ich glaube, man muß vor allem wirkliche Musik schreiben; mir persönlich ist es eigentlich egal, wie man diese dann bezeichnet. Man hat ja auch jetzt nach der Lukas- Passion geschrieben, ich hätte die Avantgarde verlassen.
FURCHE: Weil Sie darin nur zusammenfassen .
PENDERECKI: aber alles, was ich in den avantgardistischen Stücken gemacht habe, ist auch in der Passion wiederzufinden.
FURCHEv Sehen Sie denn noch die Möglichkeit, neue Klangmittel zu erfinden, mit anderen Worten, weiterhin avantgardistisch tätig zu sein?
PENDERECKI: Natürlich, das mache ich immer. Beispielsweise ist die Klangwelt in meinem letzten größeren Werk, dem Oratorium „Dies Irae“, eine völlig andere als etwa in der Passion. Das Wort Avantgarde ist für mich ganz fremd, obwohl ich welche gemacht habe; aber das geschah niemals nur in der Absicht, etwas Neues zu finden. Von der Musik muß Faszination ausgehen, es muß etwas dahinterstecken — was und wie das ist, kann ich selbst nicht sagen.
Das Gespräch mit dem Komponisten Penderecki führte Winfried Ammei.