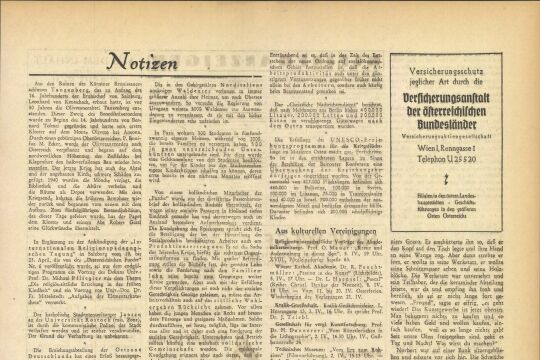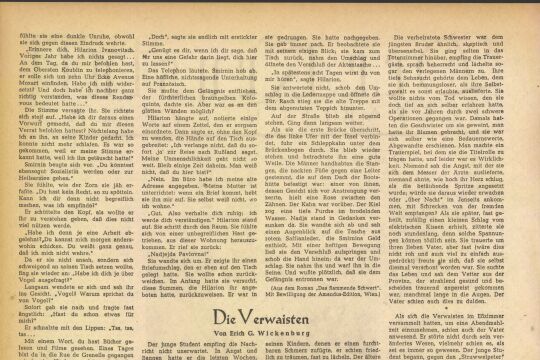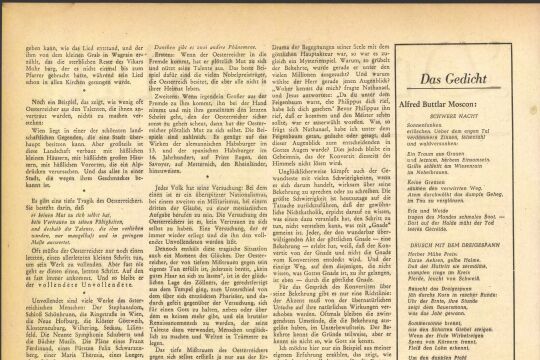Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Ich habe versagt“
Als der Arzt zur gewohnten Stunde den Warteraum durchschritt, um ins Ordinationszimmer zu gelangen, richteten sich wie immer die Blicke der bereits versammelten Patienten auf ihn. Einen Augenlang empfand er die Konzentration der vielen Wünsche, Hoffnungen und Befürchtungen, die daraus auf ihn eindrang, beinahe- als körperliche Last. Aber er fühlte sich dadurch nicht bedrückt. Im Gegenteil. Während er kurz grüßte, umspielte seinen Mund ein Lächeln, das nicht frei von Eitelkeit war. Er liebte seinen Beruf. Denn er war interessant, abwechslungsreich und spannend, wie das Leben in jener Phase, da es vom Schatten des Todes gestreift wird, nur sein kann. Aber es war da noch etwas anderes, das ihn an seinen Beruf fesselte: er durfte helfen, immer wieder und immer anderen Menschen helfen. Die Hilfe, die er brachte, war eine selbstlose. Das heißt, er lebte natürlich davon. Aber es gab genug Verrichtungen, für die er sich keinen Groschen erwarten durfte, und in vielen Fällen konnte man seine Leistung gar nicht abgelten, da man das Leben einfach nicht bezahlen kann. Er hatte schon oft über seine Selbstlosigkeit nachgedacht. War er wirklich so gut? War er wirklich so edel, wie er hilfreich war? Die Leute glaubten es. Und er auch. Doch manchmal drängte ihn etwas, diesen Glauben zu überprüfen, einer Korrektur zu unterziehen. Er schien ihm auf einmal der realen Grundlage zu entbehren. Er hielt ihn dann für eine bloße Selbstgefälligkeit, und das Gefühl einer leisen Beschämung überkam ihn, wenn er sich den Ausdruck seiner Patienten ins Gedächtnis rief, mit dem sie ihm entgegentraten. Doch das ging vorüber, und er gewann sehr bald seine Selbstsicherheit wieder, die ganz auf der Überzeugung von der moralischen Motivierung seines Handelns aufgebaut war.
Im Durchgehen musterte er flüchtig die Versammlung. Er stellte fest, daß bis auf ein, zwei neue Gesichter nichts Auffällt ges zu bemerken war. Ja doch: da war auch ein Mann, dessen Lebensverhältnisse ihm“ bereits außerberuflich bekannt waren. Der suchte in letzter Zeit mehrmals die Ordination auf, wiewohl er offensichtlich nicht ernstlich krank war. Er war ein ruhiger, vernünftiger Mensch, der ein offenes, wenn auch keineswegs aufdringliches Wesen zeigte. Es war anzunehmen, daß er nicht grundlos oder Irgendwelcher Einbildungen wegen zum Arzt kam, wenn auch das angegebene Leiden nicht die einzige Ursache seines Erscheinens sein konnte. Als die Reihe an ihn kam, berichtete er zunächst allerlei über seine Beschwerden, sprang aber plötzlich vom Thema ab und bat den Arzt, er möchte ihm durch Bescheinigung seines Leidens bei der Erlangung einer Wohnung behilflich sein. „Aber gerne“, erwiderte dieser, „doch muß ich Ihnen sagen, daß Sie nach meinen Erfahrungen damit kaum etwas ausrichten werden. Die Wohnungsnot ist so groß, daß nur Schwindsüchtige beim Wohnungsamt auf Grund ihrer Erkrankung eine höhere Punktebewertung erhalten.'
Der Arzt sprach dies — wie oft hatte er es schon sagen müssen — stereotyp vor sich hin, doch als er aufsah, begegnete er dem betroffenen Blick des Patienten. Eine spannungsvolle Pause entstand. Im Blitztempo rollte im Gedächtnis des Arztes das Schicksal des Mannes vorüber, dessen Augen ihm einen Moment lang die Sicht ins Innorste des Herzens freigaben. Ein beinahe alltägliches Schicksal. Die Ehe des Patienten war nach zwanzig Jahren in Brüche gegangen und zu Beginn des letzten Sommers geschieden worden. Das Besondere daran war vielleicht, daß nicht Gleichgültigkeit und Abneigung, sondern ein ewiges Sichnichtverstehen, Sichnichtfindenkönnen die tiefere Ursache war. Seinem Kinde, einer erwachsenen Tochter zuliebe, hatte er bei der Scheidung auf sein Anrecht auf die Wohnung verzichtet und sie der Gattin und dem Kinde überlassen. Er selbst hatte ein Kellerlokal bezogen, in der leisen Erwartung, das getrennte Familienband würde sich wieder vereinen lassen. Nun aber war der Herbst gekommen. So . grau wie der Himmel wurde auch die Stimmung in seiner Seele. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Familie war am Widerstand der Frau gescheitert.-Die Tochter hatte sich von ihm zurückgezogen und hielt anscheinend zur Mutter. Den Frost, der sein Herz umschloß, wollte er nun dadurch mildern, daß er sich für den Winter wenigstens ein menschenwürdiges Quartier zu verschaffen suchte. Dem Arzt wurde die Betroffenheit im Auge des Mannes plötzlich verständlich. Sie war der Ausdruck der neuerlichen Enttäuschung, welche die Eröffnung von der Vergeblichkeit einer Bemühung in dieser Richtung hervorrief. Keine Miene, kein Wort des Unmuts durchbrach die äußere Ruhe des Mannes, doch der Arzt erkannte auf einmal das Wesen seiner Krankheit. Vor ihm stand einer, der mit dem Schicksal in der letzten Runde um die Entscheidung kämpfte. Das Thema der Auseinandersetzung lautete: Ist auch die Liebe gleich manch anderem als Scheinwert erkannten Ideal nur Illusion?
Die Antwort war in seinen Augen gleichbedeutend mit der Entscheidung über die Sinnhaftigkeit des Daseins selbst. Wenn auch die Liebe nur Lüge ist, dann war seine Arbeit für seine Familie, ja für jede andere Form menschlicher Gemeinschaft umsonst, dann gab es auch keine Geborgenheit, keine Sicherheit und kein Vertrauen mehr. Die Angst vor einer furchtbaren Entdeckung zwang ihn dazu, als Bettler der Liebe herumzu-irren. Die Angst um die Liebe war für ihn Ausdruck der Angst um sein Leben geworden, denn gab es das eine nicht, hatte das andere keinen Sinn mehr.
Der Arzt überlegte. Sollte er aufspringen, dem Manne sagen, daß er ihn durchschaute? Sollte er versuchen, ihn vom Rande der Verzweiflung zurückzuziehen und mit ihm von den Geheimnissen des Lebens und der Liebe reden? Und sollte er — doch war er dafür noch zuständig? Mischte er sich da nicht in Dinge, die ihn nichts angingen und mit der Medizin nichts mehr zu tun hatten? Er wurde in seinen Gedanken durch den Mann unterbrochen, der den Faden' des Gesprächs wieder aufnahm: „Also, Herr Dcktor, ich geha ab morgen wieder meinem Beruf nach. Sollte ich eine Bescheinigung über meine Erkrankung benötigen, werde ich Sie noch darum bitten...“ —
Nun also — er hatte doch zu schwarz gesehen. Der Mann sprach ja ganz ruhig über seine nächsten Zukunftsabsichten. Erleichtert drückte ihm der Arzt zum Abschied die Hand.
Drei Tage später wurde bekannt, daß sich der Mann am Morgen in seiner Kellerwohnung erhängt hatte.
Der Arzt schritt am selben Tag wieder durch die Reihen seiner Patienten. Sie blickten wie immer mit gläubigem Vertrauen auf ihn. Er fühlte sich zum erstenmal wirklich bedrückt. Ein Gesicht fehlte heute. Er wußte, daß er versagt hatte. Auch als Arzt. Es zeigte ihm das Erlebnis der letztvergangenen Tage, daß es für den rechten Arzt eine Begrenzung seiner
Wirktätigkeit einfach nicht geben kann, sofern er im Kampf gegen den Tod seine eigentliche Lebensaufgabe sieht. Daß er erst dann den Boden der menschlichen Schwächen, der Geld- und Ehrsucht verlasse und in den Bereich seines Berufsethos vordringe, wenn er den körperlichen Schmerz, wo es nötig ist, bis zur Steile seiner Verknüpfung mit dem Leidenszustand der Seele zu verfolgen gewillt ist. Und wenn er bereit ist, an diesem wahrhaft neuralgischen Punkt die ganze ihm zu Gebote stehende Kraft seiner Persönlichkeit ohne Rücksicht auf Zeit, Geld und Ansehen einzusetzen, nur um ein Leben zu retten. Denn: das Gesetz ärztlichen Handelns ist nicht die Pflicht, sondern die Liebe. Diese aber ist grenzenlos.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!