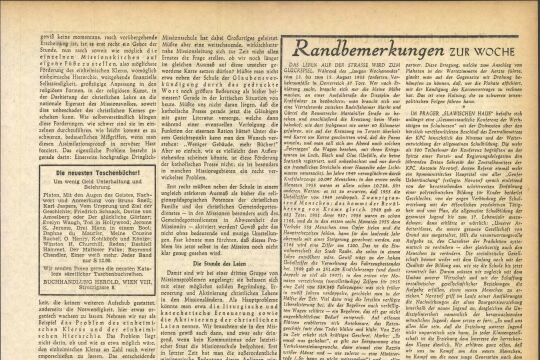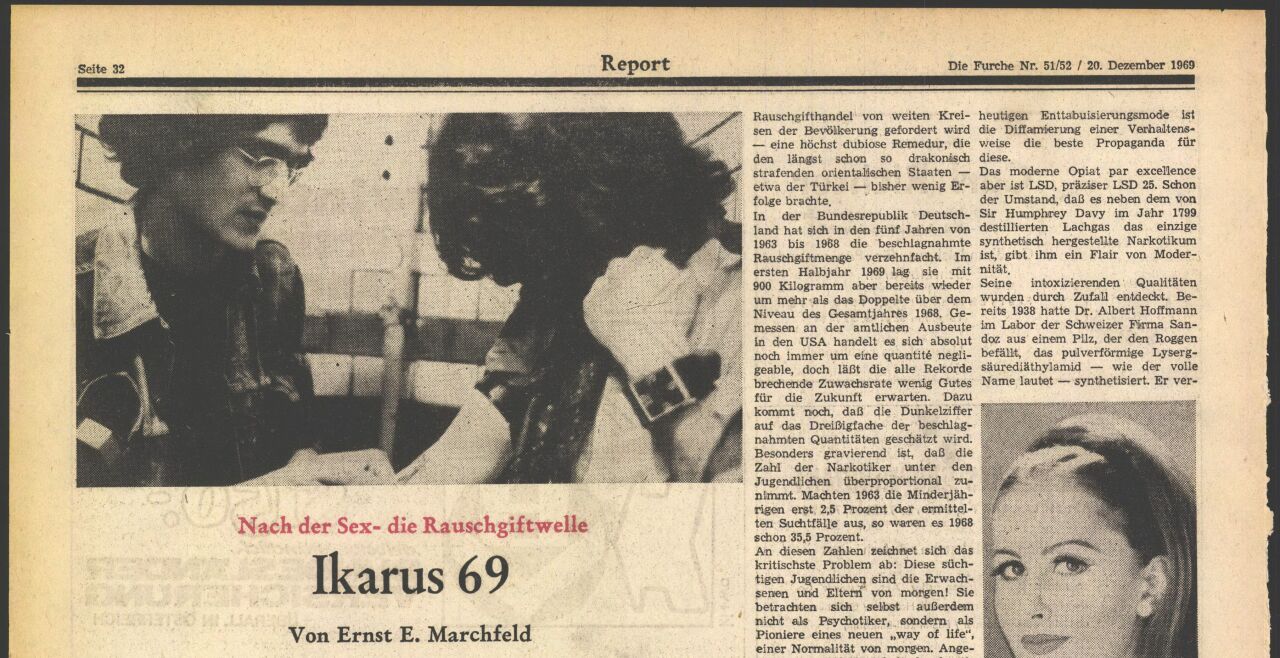
Ein junges Mädchen aus Wien, dem das Leben „alles gegeben hat“ (um den Illustriertenjargon zu gebrauchen) — Schönheit, Karriere, Erfolg — kletterte im letzten Sommer in der Nähe von New York auf einen Baum und stürzte tödlich ab. Unfall? Verbrechen? Selbstmord? Wenn wir noch in der Zeit lebten, in deir die Totenmaske der Unbekannten aus der Seine die Jungmädchenzimmer dekorierte und Romane ä la Muschler oder Agnes Günther verschlungen wurden, so würde die Legende vom armen reichen Seelchen mit seinem geheimen Schmerz nicht aufzuhalten sein. Wäre noch die Pseudomoral eines Jakob Christoph Heer oder deir „Bluboisten“ en vogues, so würde uns mit erhobenem Zeigefinger versichert, die Verunglückte hätte ihre Seele für eine schmutzige Karriere verkauft, statt ihre Rolle als Frau und Mutter zu erfüllen, sie sei der Heimat entlaufen und eine Entwurzelte gewesen.
Aber so simpel ist die menschliche Existenz nicht, um mit solchen hausbackenen Klischees erklärt zu werden. Karriere und Kosmopolitismus sind heute als legitime Positionen auch für die Frau anerkannt, und unsere unsentimentale Jugend geht nicht mehr an Liebeskummer und Heimweh zugrunde.
Speziell die junge Wienerin dürfte
— wenn wir den publizierten Cha- rakterdairstellungen glauben dürfen
— nicht in das Schema von gestern gepaßt haben: Ein fröhlicher,
lebensbejahender Mensch, auf alle Fälle einer, der mit beiden Beinen im Leben stand, dem im „Traumberuf“ eines’ Mannequins und Photomodells eine „Traumkarriere“ — hochbezahltes „Covergirl“ in New York, dem Eldorado des „beauty business“ — gelungen war. Ein Mensch aber auch, der allzu schnell bei allem, was „in“ ist, dabei war. Kein tragisches Mysterium umwittert daher den Tod der Eva G. Des Rätsels Lösung ist ganz trivial: Rauschgift. Ein kleiner Unfall bei einer fashionablen Drogen-Party —- sonst nichts. Routinesache. Hätte unsere erfolgreiche, jungę Landsmännin nicht zu den „beautiful people“ gehört, wäre ihr Gesicht den Amerikanern nicht von Titelseiten und Plakaten her vertraut gewesen, ihr Tod würde ein Satz im lokalen Polizeireport geblieben und die Nachricht davon kaum bis zu den österreichischen Zeitungen gedrungen sein.
New York ist nicht nur das ideale Pflaster für Careergirls, sondern auch eine, wenn nicht die Metropole der Drogenmanie, die heute in den USA grassiert. Allmonatlich sterben an die hundert Personen allein an den Folger, des Heroingenusses. Zirka 40.000 Personen sind als heroinsüchtig registriert. Die Gesamtzahl der „addicts“ bloß dieses früher arglos als Hustenmittel rezeptierten Morphiumderivats wird auf 100.000 geschätzt.
Heroin gilt heute als Droge der Armen. Den Großteil seiner Anhänger stellen Farbige und Puertoricaner. Das Zentrum des Konsums sind die Slums.
Diese 100.000 meist armen New Yorker geben alljährlich auf dem von der Mafia kontrollierten Schwarzmarkt zirka 850 Millionen Dollar für dieses Opiat aus — das sind 8500 Doller oder 200.000 Schilling pro Süchtigen. Woher nehmen Bedürftige, darunter vielfach Sozial- befürsorgte, solche Summen?
Die Antwort erteilt die Kriminalstatistik. Zirka die Hälfte der Diebstähle und Raubüberfälle in New York werden von den Polizeiexperten den Drogenkranken zur Last gelegt. Ihre jährliche Beute dürfte einen Wert von 2 Milliarden Dollar haben. Die Differenz zwischen ihren Ausgaben und „Einnahmen“ soll zum Großteil in die Taschen der gleichfalls zur „Cosa Nostra“ zählenden Hehler fließen.
Die arrivierte junge Wienerin ist natürlich nicht dem „ordinären“ Heroin zum Opfer gefallen. Ihr Un fall ist typisch für die „noble“ Droge LSD. Diese ist speziell in Studenten-, Intellektuellen- und Snobzirkeln der Favorit neben dem gleichfalls populären Marihuana, das im Jargon der Zünftigen meist als „pot“ oder „grass“ bezeichnet wird. Es sind dies Präparate, die angeblich keine physischen Defekte zur Folge haben — eine empirisch keineswegs fundierte Behauptung. Von den psychischen Konsequenzen wird vorsichtshalber erst gar nichts gesprochen.
Die Universitäten wurden von diesen Opiaten „erobert“. Bereits ein Drittel aller amerikanischen Studen ten hat einschlägige Erfahrungen — gegenüber angeblich „nur“ 5 Prozent der amerikanischen Gesamtbevölkerung. Überhaupt ist speziell die Jugend anfällig. In New York soll auch schon ein Drittel aller Schüler solche Erfahrungen haben. Marihuana kommt hauptsächlich aus Mexiko und wird zum Großteil in präparierten Zigaretten — das Stüde zu 75 Cents, also nicht ganz 20 Schilling — konsumiert. Wie explosiv der Verbrauch dieses Mittels zunimmt, beweist der Umstand, daß 1968 an der mexikanischen Grenze schon siebenmal soviel „pot“ beschlagnahmt wurde wie zwei Jahre vorher. Für die viele Male größere Quantität, die erfolgreich geschmuggelt wurde, liegt der Multiplikator vermutlich noch bei weitem höher. Dabei wurden im Vorjahr zirka 35.000 Kilogramm beschlagnahmt — beachtlich, wenn man bedenkt, daß weniger als ein Gramm genügt, um eine Zigarette zu „präparieren“.
Eine amerikanische Tragödie? Nicht nur. Die USA sind heute international im Positiven wie im Negativen der Pionier. Ihre Manieren und Manien erobern — mit entsprechendem „time lag“ — auch Europa. Dies hat schon die amerikanische Sexwelle bewiesen, die — im Gegensatz £ur älteren, aber viel weniger konta- giösen skandinavischen — unaufhaltsam nach allen Richtungen Übergriff. Wird die Rauschgiftwelle gleiche Intensität erreichen?
Die Indikatoren sind alarmierend. Großbritannien und die skandinavischen Staaten stehen Amerika kaum noch nach. In Frankreich verursacht der Anstieg der Suchtfälle schon solche Panik, daß die Todesstrafe für
Rauschgifthandel von weiten Kreisen der Bevölkerung gefordert wird
— eine höchst dubiose Remedur, die den längst schon so drakonisch strafenden orientalischen Staaten — etwa der Türkei — bisher wenig Erfolge brachte.
In der Bundesrepublik Deutschland hat sich in den fünf Jahren von 1963 bis 1968 die beschlagnahmte Rauschgiftmenge verzehnfacht. Im ersten Halbjahr 1969 lag sie mit 900 Kilogramm aber bereits wieder um mehr als das Doppelte über dem Niveau des Gesamtjahres 1968. Gemessen an der amtlichen Ausbeute in den USA handelt es sich absolut noch immer um eine quantitė negli- geable, doch läßt die alle Rekorde brechende Zuwachsrate wenig Gutes für die Zukunft erwarten. Dazu kommt noch, daß die Dunkelziffer auf das Dreißigfache der beschlagnahmten Quantitäten geschätzt wird. Besonders gravierend ist, daß die Zahl der Narkotiker unter den Jugendlichen überproportional zunimmt. Machten 1963 die Minderjährigen erst 2,5 Prozent der ermittelten Suchtfälle aus, so waren es 1968 schon 35,5 Prozent.
An diesen Zahlen zeichnet sich das kritischste Problem ab: Diese süchtigen Jugendlichen sind die Erwachsenen und Eltern’ von morgen! Sie betrachten sich selbst außerdem nicht als Psychotiker, sondern als Pioniere eines neuen „way of life“, einer Normalität von morgen. Angesichts der Willfährigkeit der heutigen Menschheit — nicht nur der Jugend — gegenüber allem, was nachhaltig als modern etikettiert wird, angesichts ferner der Schrittmacherrolle, die der heutigen Jugend generell zugebilligt wird, könnten sich solche Zukunftsvisionen als weniger phantastisch erweisen, als es im ersten Moment scheinen mag. Die gleiche Situation wie in Deutschland zeichnet sich auch in Österreich ab — wenn auch mit dem üblichen Verzögerungseffekt. Hier — die Levante ist relativ nahe — dominiert das altbewährte orientalische Hausmittel Haschisch — ein Hanfprodukt, das von seinen deutschsprachigen „Fans“ den ziemlich phantasielosen Kosenamen „Hasch“ erhalten hat. Für diese Droge soll Österreich sogar der internationale Umschlagplatz sein.
Mag der Prozentsatz der Süchtigen auch heute noch klein sein — Opiate interessieren, die psychische Resistenz gegen sie wird systematisch abgebaut. Nicht ohne Grund erzielte der junge Grazer Dramatiker Wolfgang Bauer mit einem Stück über das Drogenproblem — in Deutsch land freilich noch stärker als in Österreich — seinen Durchbruch. Und wenn sogar Fritz Eckhardt mit seinem Riecher für populäre Aktualitäten den TV-Kriminalinspektor Marek mit einer Rauschgiftaffäre befaßt („einfacher Doppelmord“), so kann kein Zweifel mehr daran bestehen, daß auch in Österreich das Drogenproblem bereits hausmeisternotorisch geworden ist.
Von der — vorläufig noch — negativen Emotionalisierung dieser literarischen Exkurse dürfen wir uns aber keinen Abschreckungseffekt versprechen. Im Gegenteil: Bei der heutigen Enttabuisierungsmode ist die Diffamierung einer Verhaltensweise die beste Propaganda für diese.
Das moderne Opiat par excellence aber ist LSD, präziser LSD 25. Schon der Umstand, daß es neben dem von Sir Humphrey Davy im Jahr 1799 destillierten Lachgas das einzige synthetisch hergestellte Narkotikum ist, gibt ihm ein Flair von Modernität.
Seine intoxizierenden Qualitäten wurden durch Zufall entdeckt. Bereits 1938 hatte Dr. Albert Hoffmann im Labor der Schweizer Firma Sandoz aus einem Püz, der den Roggen befällt, das pulverförmige Lyserg- säurediäthylamid — wie der volle Name lautet — synthetisiert. Er ver sandte Proben dieses Destillats an diverse Labors zwecks Indizierung eines praktischen Verwendungszwecks — ohne Resultat.
Bis er selbst im Jahre 1943 einmal das Pulver aus Versehen inhalierte. Er wurde daraufhin schwindelig, sah die Objekte zu Farb- und Formmustem zerfließen, hatte aber anderseits wieder halluzinatorische Erscheinungen von intensiver Plastizität.
Visionär hat Goethe jene emotionellen Tendenzen, für die eine von allen Bindungen befreite, total emanzipierte Jugend besonders anfällig ist, in einer Figur vorweggenommen, die er signifikanterweise Euphorion genannt hat. Bevor dieser Sohn des Faust und der Helena einen Felsen erklettert und zum Todessprung ansetzt, ruft er aus:
„Doch! — Und ein Flügelpaar Faltet sich los!
Dorthin! Ich muß! Ich muß!
Gönnt mir den Flug!“
Vermutlich dürfte jeder LSD- Experte mit dieser Deskription des Antigravitationsgefühls zufrieden sein. Klingt das nicht fast wie eine etwas altmodische Poetisierung des Todes unseres Wiener Covergirls? Was aber bei Goethe metaphorische Bedeutung hatte, Chiffre für bestimmte ideelle Tendenzen war, wird in unserer realisierungswütigen Ära mit Hilfe chemischer Stimulantia zur persönlichen faktischen Erfahrung konkretisiert — und banalisiert. Schon Goethe stellt die Relation zu Ikarus, dem abgestürzten Flieger der griechischen Sage, her, wenn er den Chor nach Euphorions Todessprung ausrufen läßt:
„Ikarus! Ikarus!
Jammer genug!“
Dies suggerierte sowohl die Identität als auch die Divergenz der ikarischen und euphoriontischen Frustration. Ikarus versagt durch mangelhafte Beherrschung der Materie, Euphorion durch ungenügende Kontrolle seines Bewußtseins. Könnte die Situation gerade unserer Zeit stringenter dargestellt werden?
Die moderne Rauschgiftsucht darf nicht bloß als Krankheit oder Laster verstanden werden. Sie kann daher weder mit polizeilichen noch mit medizinischen Maßnahmen allein erfolgreich bekämpft werden. Ihre Wurzeln stecken im Existentiellen, im Selbstverständnis der heute lebenden Generation. Ohne Korrekturkollektive der Bewußtseinssituation — allerdings nicht ganz im Sinne avantgardistischer Bewußtseinstechniker — wird keine dauerhafte Überwindung des modernen Massennarkotismus möglich sein.