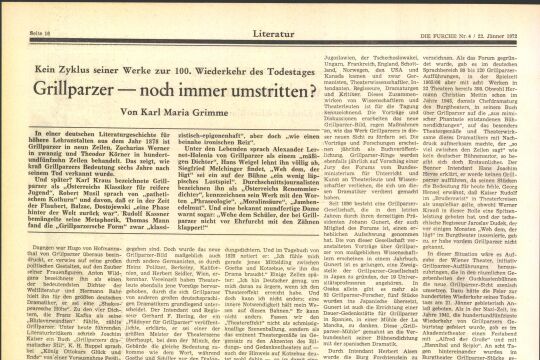Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Im Schatten des Traums
Sicherlich ist Bancbanus in Grillparzers Trauerspiel „Ein treuer Diener seines Herrn” der aus Einsicht wie Gehorsam „unheldischeste Held”, der je in ein tragisches Geschick verstrickt wurde. Aber er ist weder ein serviler noch ein lächerlicher Vasall seines Königs; denn am Ende erweist er sich in seiner höheren Welt des Duldens und Erdul- dens als der Stärkere, der Sieger — auch über den hemmungslosen, gefühlskranken Wüstling, den Herzog von Meran. Um Bancban ist etwas wie eine an Rembrandt gemahnende Leuchtkraft. Nicht ein Zerrbild des vormärzlichen Beamtentums, sondern einen Fürstenspiegel hatte Grillparzer hier freimütig aufgestellt. Die erwogene, weit schroffere Fassung des Schlusses sollte lauten: „Sei du ein König und ein Mensch… Das Gute tu und tu es rasch und gern: / Sei ein getreuer Herr erst deinen Dienern, / Dann sind sie treue Diener ihres Herrn.”
So müßte Grillparzers Trauerspiel gespielt werden. In der Inszenierung von Rudolf Kautek, die uns ein Gastspiel des Grazer Schauspielhauses im Akademietheater vermittelt hat, hielt sich der Hauptdarsteller Helmuth Ebbs eher an die im Programmheft von Raoul Auern- heimer zitierte Auffassung, die in Bancban „einen antiken Charakter im Bürorock eines österreichischen Hofrates” sehen wollte. Hans Kraß- nitzer war ein würdiger König von Ungarn, Marianne Kopatz seine törichte Gemahlin, Ruth Pirron Banebans junge, unglückliche Frau, Harald Harth ein etwas zu hysterisch exaltierter Meran. (Gerade diesem völlig modern anmutenden Neurotiker, dem kompliziertesten seiner Charąktere, hat Grillparzer in einem Brief eine ausführliche richtungweisende Charakteristik gewidmet.) Die Wiederbegegnung mit einem seit vielen Jahren in Wien nicht gespielten Grillparzer war auf jeden Fall zu begrüßen. Wenn das Gastspiel der Grazer dennoch viele Wünsche offenließ, so mögen sie sich damit trösten, daß auch das Burgtheater bis heute noch keinen gültigen, unserer Zeit gemäßen Aufführungstitel für die Werke Grillparzers gefunden hat. Das gilt auch für eines der schönsten, kürzlich neuaufgeführten: das Märchen „Der Traum ein Leben”,
Das ist jene Dichturig, mit der Grillparzer der Welt seines Zeitgenossen Raimund am nächsten kam, wenn er bekennt: „Meinen Werken merkt man an, daß ich in meiner Kindheit mich an den Geister- und Feenmärchen der Leopoldstadt ergötzt habe.” Weltgeschichte wird zum Theatermärchen, Menschen verwandeln sich in schwebende Traumschatten, und über allem wölbt sich die Hoffnung, das Leben mit seinen Härten möge sich in jenes Arkadien verwandeln, wo des Innern stiller Friede und die schuldbefreite Brust die höchsten aller Güter bedeuten. Dieser „Traum ein Leben” ist auch ein Stüde der Belehrung. Was Rustan im Traum einer Nacht erlebt, birgt eine ebenso hintergründig tiefe wie volkstümlich schlichte Darstellung der Verführung zur Gewalt und des schlimmen Endes, das Gewalt und Lüge allemal nehmen. Dieses Drama der Läuterung war geboren aus der Hochachtung vor dem Menschenbild, dessen Zerstörung Ruhm und Sieg nicht aufzuwiegen vermögen. Der Mensch— das war vielleicht Grillparzers höchstes Wort. Höhere Geltung hatte es auch in Weimar nicht gehabt.
In der Neuinszenierung des Burgtheaters beeindruckte das Bühnenbild von Lois Egg vor allem durch die farbige Phantastik des „Königsreichs Samarkand”, während die nicht immer geglückten Kostüme (Ursula Schäffler) einem etwas skurillen Märchenorient entstammten. Die Regie (Walter Gerhardt) vermied zwar äußerliche Effekte in dem an märchenhaften Vorgängen so reichen Spiel, vermochte jedoch die Schauspieler nicht so zu leiten, daß die Verse jenen Charakter des Bedeutens bekamen, wie er im Sinne Grillparzers liegt. Walter Reyer spielt den Rustan, den Traumlüstemen, Schillernden, der sich verführen läßt und schließlich selbst aktiv zum Bösen wird. Eine gute Leistung, nur droht Reyers leidenschaftliche Bewegtheit, auf einen Ton gestimmt, bald zur Routine zu entarten. Erika Pluhar bewegt als sanfte Mirza mehr denn als stolze Gülnare. Wolfgang Gassers Zanga entwickelt sich zwar komödiantisch vom gutmütigen Sklaven zum mephistophelischen Verführer, bleibt jedoch ohne schärfere Profilierung. Das Publikum, darunter viel Jugend, zollte nach pausenloser Aufführung mäßigen Beifall.
Immer mehr beginnt die junge deutsche Dramatik mit der Vergangenheit aufzuräumen, indem sie Zeitgeschichte, Zeitkritik in formal meist anspruchslosen Stücken bietet. In der deutschen Gegenwartsdramatik wird die Bühne wieder zur „moralischen Anstalt”. Hans Günter Michelsen und sein mit dem Ger- hart-Hauptmann-Preis ausgezeichneter Einakter „Helm” gehört dazu. Fritz Helm, ehemaliger Regimentskoch und jetziger Gastwirt, ist einer der „Überlebenden”, welche die Spuren des Krieges, der Denunziation am Körper und im Gesicht tragen. Klenkmann, sein Oberst, hatte ihn einst aus Ärger über ein mißlungenes Essen und den anschließenden Wortwechsel wegen „Wehrkraftzersetzung” angezeigt und zu einer Strafkompanie abkommandiert. Helm war al£ Krüppel aus dem Krieg heimgekehrt. Nun hat er am Stammtisch seines Gasthauses mit den fünf ehemaligen Vorgesetzten „Versöhnung” gefeiert, was nicht ohne peinliche Auseinandersetzung abging. Im Morgengrauen hat er sie auf seinen Jagdgrund in den Wald vorausgeschickt, wo sie jetzt verabredungsgemäß auf ihn warten. Aber Helm kommt nicht. Sein Fernbleiben beunruhigt; in der sich steigernden Unsicherheit werden Erinnerungen an die Vergangenheit geweckt, die in zerstückelt kreisenden Dialogen eine quälende gegenseitige Gewissenserforschung auslösen. Michelsen läßt das meiste in Schwebe, ungeklärt. Auch die vier rätselhaften Schüsse, die den nacheinander aus der Gruppe aufbrechenden . Männern folgen, und die der Vermutung nach Heim vom Hochsitz seines Waldstückes aus später Rache abgefeuert haben soll.
Aber vielleicht ist „Helm”, der unsichtbar bleibt, vom Autor gar nicht so real gemeint, sondern eher als Personifizierung des Gewissens, das die Schuld ins Bewußtsein zurückruft. Die ganze Situation wirkt konkret und irreal zugleich. Der schließlich allein zurückgebliebene Klenkmann, der Wortführer (die anderen vier sind eher spärlich charakterisierte Typen), enthüllt in einem anspruchsvollen Schlußmonolog die Zusammenhänge.
Das Volkstheater brachte in seinem überaus verdienstvollen Zyklus „Spiegel der Zeit” unter der Regie von Leon Epp eine Aufführung zustande, in der den Dialogen gemäß ein Höchstmaß an Beweglichkeit immer Wieder die lähmende Ahnung und Erwartung durchbrach. Die fünf Darsteller (Hanns Krassnitzer als Klenkmann, Herbert Probst, Heinrich Trimbur, Hans Rüdgers, Hans Weicker) gaben den an sich vagen Figuren feste Konturen. Gustav Manker hatte den Phantasieraum des Stückes mit stilisierten Baumstämmen ausgefüllt, zwischen die das Morgenlicht einflutete. — Als Einstimmung zu dem nicht abendfüllenden Einakter ließ Leon Epp auf leerer Bühne die Novelle „Die Berliner Antigone” von Rolf Hoch- huth rezitieren, eine moderne Paraphrase auf den antiken Stoff, knapp, unpathetisch in der Sprache. Emsl Meister war der ausgezeichnete Sprecher. Nach Überwindung einiger Vorurteile feierte das Publikum die Darsteller. Es war ein wichticei Theaterabend.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!