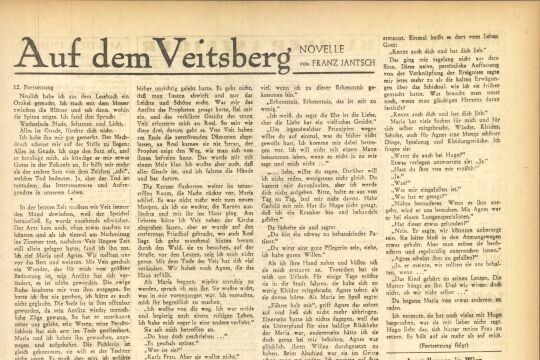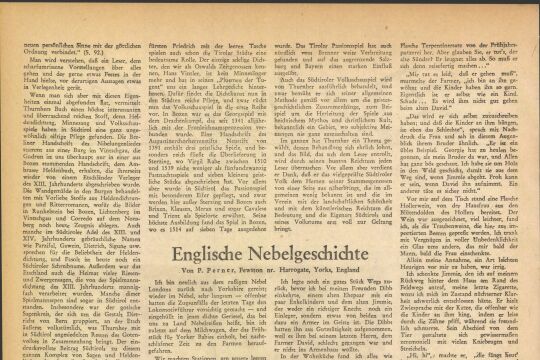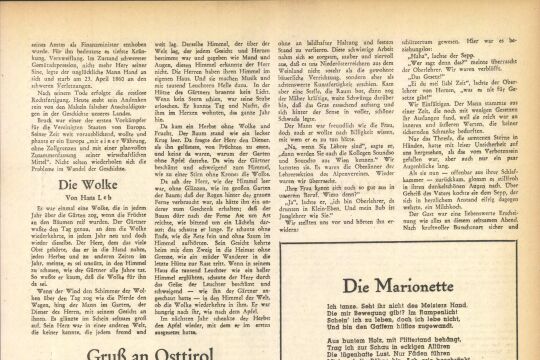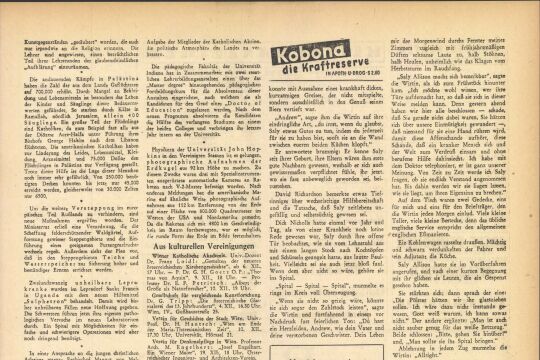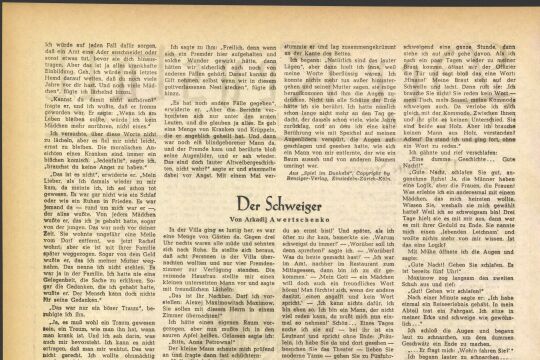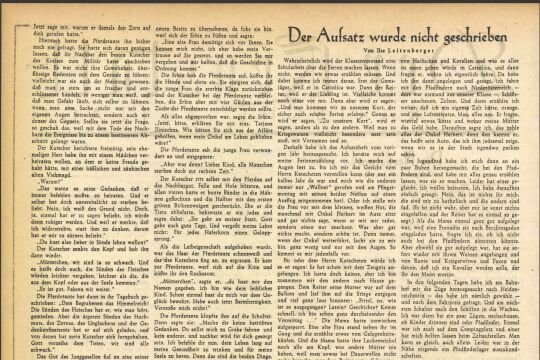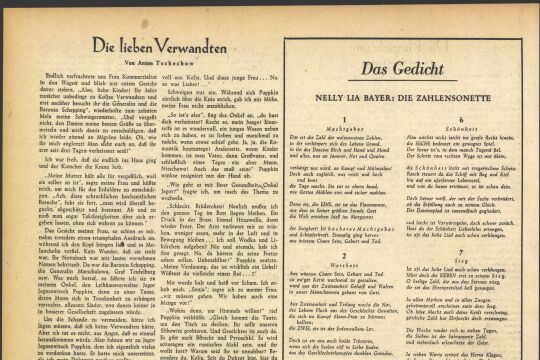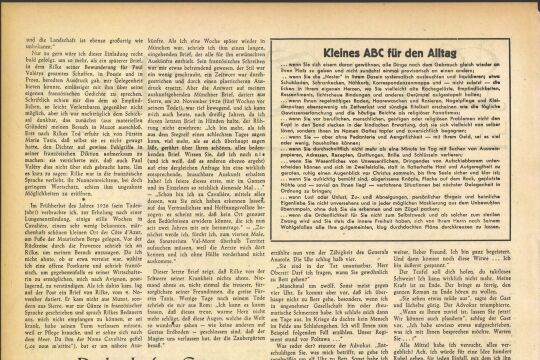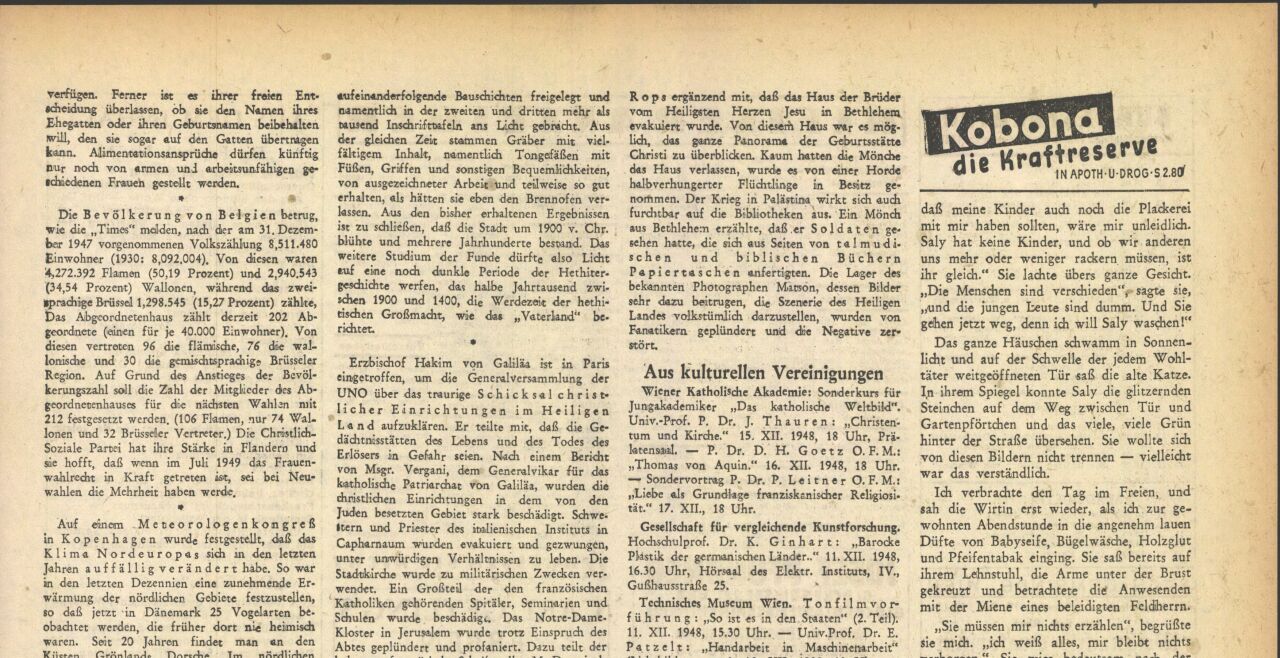
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
In dem alten Wayside Inn
(1. Fortsetzung)
Der Briefträger brachte nicht nur Post für die ganze Gegend, sondern auch eine große braune Teekanne herein.
Er hatte in Salys Häuschen vorgesprochen: „Ich wollte doch sehen, wie es ihr geht”, erklärte er, während er Platz nahm. „Sie hat Feuer im Kamin, aber die Teebüchse, die Andrew aufgehoben hat, konnte ich nicht finden und zu langem Suchen habe ich heute am Montag, meinem strengsten Tag, leider keine Zeit. Vielleicht füllen sie mir die Kanne, dann trage ich sie schnell zurück.”
Die Wirtin begann noch etwas nachdrücklicher als gewöhnlich eine Darstellung des Sachverhalts. „Kann mir jemand Hartherzigkeit vorwerfen?” fragte sie zuletzt. „Du kennst die Verhältnisse, denn du bist bei uns hier geboren. Das ist der Grund, weshalb ich mit dir so offen rede, was ich mit Fremden wie zum Beispiel den Kohlenmännern nie tue.”
„Sie sind eine gute Frau”, versicherte der Briefträger über seinem Frühstück, „die Eltern haben mir’s immer erzählt. Gleich waren sie bei der Hand, als die Großmutter sich den Fuß gebrochen hatte — und damals, als die große Epidemie war — und damals, als mein ältester Bruder, den ich nicht mehr gekannt habe, ins Wasser fiel… Recht haben Sie jedenfalls.” Was nicht hinderte, daß er, nachdem sein letztes Butterbrot verzehrt war, die Posttasche aufnehmend, neuerdings, wenn auch etwas zaghaft, Salys Kanne gedachte: „Einmal ist keinmal, wie? Und ob ich ihr nun den Tee bringe oder nicht, sie wird darum nicht mehr und nicht weniger ins Spital gehen! Und ich hab’ es doch versprochen — und sie wartet drauf — und sonst bringe ich den Gedanken an Saly den ganzen Tag nicht los…”
„Schau, daß du weiter kommst, Charlie”, rief die Wirtin mit einer ungeduldigen Bewegung, als hätte sie Fliegen verjagt. „Du hast keinen Charakter. Ein charaktervoller Mensch muß auch einmal um der gesunden Vernunft willen unangenehme Gedanken ertragen. Meinst du, mir liegt die Sache mit Saly nicht auch im Magen? Schau, daß du weiterkommst, sag’ ich, damit deine Frau, die arme Haut, dein Essen nicht bis Mitternacht warmhalten muß. Ihr zulieb werde ich mich um den Tee annehmen.”
Montag ist Waschtag in der ganzen Grafschaft, außerdem war in Erwartung einer angesagten Gesellschaft große Pastetenbäckerei im Gang. Zur Entlastung der Frauen erbot ich mich, Salys Frühstück zu besorgen.
„Trachten Sie vor allem herauszubekommen, wer den Kamin geheizt und die Türe geöffnet hat”, trug mir die Wirtin noch auf, nicht ohne Bitterkeit.
Saly Allison lag auf ihrem Bett, weiß und unbeweglich wie eine Marmorstatue.
„Lassen Sie die Türe offen”, gebot sie, als ich eintrat, „und stellen Sie die Kanne auf den Tisch!” Ohne den Kopf zu bewegen, die Blicke immer gradaus auf die Wand gerichtet, wo ein Spiegel hing, folgte sie jeder meiner Bewegungen mit starkem Mißtrauen. „Gehen Sie ins Nebenzimmer, rechter Hand im Glaskasten stehen Tassen! Finden Sie den Kasten nicht?” Sie wurde ungeduldig und seufzte: „Mein Gott, mein Gott;- was ist das für ein Elend! Andrew hat immer alles gleich gefunden. Ein Glück noch, daß er mir den. Spiegel hingehängt hat, so kann ich wenigstens sehen, was vorgeht… mein Gott, jetzt haben Sie mir eine falsche Tasse gebracht, ich trinke hie aus dieser Tasse. Holen Sie eine andere, aber schnell, sonst wird mein Tee kalt! O mein Gott, mein Gott, was fang’ ich an mit allen diesen fremden Leuten, verlassen vom guten Andrew! Gewaschen hat mich auch noch niemand, obwohl ich schon solang zur Tür hinausrufe.”
„Im Spital wären Sie viel besser dran”, konnte ich nicht umhin zu äußern, nachdem ich m irfach vergebens versucht hatte, ihr den Tee genau so zu reichen, wie Andrew es angeblich immer getan.
„Ich gehe nicht ins Spital”, sagte sie, „denn ich bin hier umabkömmlich. Meine Sachen brauchen mich, das Haus braucht mich und jch bin immer hier gewesen … „Zu meinem Schrecken rollten plötzlich große Tropfen über die Marmorwangen.
Ich hielt verzweiflungsvoll Umschau nach einem Taschentuch, wobei mein Blick auf eine kleine gebrechliche Alte fiel, die eben daherkam. Sie hielt sich am Türstock und an den Möbeln fest und lächelte freundlich.
„Mit meinen weitsichtigen Augen habe ich Sie zwei Felder weit aus dem Gasthaus hierhergehen sehen”, sagte sie, „ich habe mir gleich gedacht, daß es für Sie kein leichtes Geschäft sein wird.”
Sie fing an, im Zimmer umherzuwirtschaften, leise und geschickt bei aller Hinfälligkeit. „Ich bin die Mutter David Richardsons, den sie vom Wirtshaus her kennen. Er hat mir von Ihnen erzählt, daß Sie von so weit her zu uns gekommen sind. Ich war schon zeitlich früh hier Feuer machen und die Tür öffnen. Bei offener Tür kann Saly nicht viel passieren, den irgendwer hört sie immer. Die jungen Leute wollen sie zwingen, ins Spital zu gehen. Ich, für meine Person ginge gleich hin, wenn ich krank wäre, denn daß meine Kinder auch noch die Plackerei mit mir haben sollten, wäre mir unleidlich. Saly hat keine Kinder, und ob wir anderen uns mehr oder weniger rackern müssen, ist ihr gleich.” Sie lachte übers ganze Gesicht. „Die Menschen sind verschieden”, sagte sie, „und die jungen Leute sind dumm. Und Sie gehen jetzt weg, denn ich will Saly waschen!”
Das ganze Häuschen schwamm in Sonnenlicht und auf der Schwelle der jedem Wohltäter weitgeöffneten Tür saß die alte Katze. In ihrem Spiegel konnte Saly die glitzernden Steinchen auf dem Weg zwischen Tür und Gartenpförtchen und das viele, viele Grün hinter der Straße übersehen. Sie wollte sich von diesen Bildern nicht trennen — vielleicht war das verständlich.
Ich verbrachte den Tag im Freien, und sah die Wirtin erst wieder, als ich zur gewohnten Abendstunde in die angenehm lauen Düfte von Babyseife, Bügelwäsche, Holzglut und Pfeifentabak einging. Sie saß bereits auf ihrem Lehnstuhl, die Arme unter der Brust gekreuzt und betrachtete die Anwesenden mit der Miene eines beleidigten Fcldherrn.
„Sie müssen mir nichts erzählen”, begrüßte šie mich, „ich weiß alles, mir bleibt nichts verborgen.” Sie wies bedeutsam nach der Abwasch am breiten Fenster der Straßenseite, die so gut wie ein Aussichtsturm war.
„Du brauchst nicht so fatal herumzureden, Polly”, begann David Richardson, „mein Wort gilt zumeist so gut wie das deine…” Er rechtfertigte sich dahin, daß seine Mütter, eigensinnig wie alle alten Leute, von mehrfachen Besuchen bei Saly nicht abzuhalten gewesen sei, und er sich verpflichtet gefühlt habe, ihr wenigstens beim Holz- und Kohlentragen zu helfen.
„Man wird oftmals gezwungen, gegen seine bessere Einsicht zu handeln”, ließ Dick Nicholls sich mißmutig vernehmen. Er erzählte von einem Touristen, der Salys Geschrei im Wald gehört hatte und spornstreichs erst zu ihr und dann querfeldein in seinen Hof gelaufen war, eine Wärmeflasche zu holen. Der Mann hatte Saly eine Unglückliche genannt, und natürlich war er, Dick, stehenden Fußes mit der Wärmeflasche zu Saly gerannt. „Wie hätte das ausgesehen vor dem Touristen, wenn ich nicht gegangen wäre?” fragte er.
Der Hausherr hatte mit Soldaten, die nachmittags auf dem Moor Schießübungen gehalten hatten, und Jesse mit dem Kutscher des Brotwagens ähnliches erlebt. Die einen waren schreckensbleich in Vorwürfe ausgebrochen: „Kümmert sich denn in dem verdammten Loch hier niemand um die Bejammernswerte, die in dem kleinen Haus dort liegt und weint und wimmert?” Der Kutscher aber hatte eine mehr als beleidigende Äußerung über die Roheit der Moorleute fallen lassen, die Kranke nicht einmal ins Spital brächten.
Patrick, seines Zeichens Fahrer des staatlichen Motorpflugs, rot angeweht von der scharfen Luft, mit wirrem schwarzem Haar und blitzenden Augen, schlug dröhnend auf den Tisch und brüllte dazu in Bekennerglut: „Hol euch alle der Teufel! So wahr ich Pat Donaghan heiße. Morgen bin ich dienstfrei, da sollt ihr was sehen! Ich gehe zu Saly und wasche sie und striegle sie und füttere sie … Spital oder nicht Spital, wenn ein Kranker irgendwo liegt, helfe ich ihm ohne langes Getue und Gefasel.”
Bevor ich schlafen ging, leistete ich der Wirtin bei einem Gutenachttee in der still gewordenen Küche Gesellschaft. „Haben Sie den dummen Jungen gehört?” fragte sie. „Der richtige Irländer, wenn er in Saft gerät, vergißt er alles, even his manners (sogar seine Manieren). Das traurige ist, daß er imstand wäre, seine Drohung auszuführen — ein junges Mannsbild, das ein Frauenzimmer wäscht, der reine Botokude —, und daß er den anderen Helden aus der Seele gesprochen hat.
Wie sind die Leute bei Ihnen zu Haus? Auch solche Schlappschwänze? Was bleibt mir anders übrig in einem Land, wo es keinen gesunden Menschenverstand gibt, als zuletzt mit dem Strom zu schwimmen. Von morgen ab werden wir, Florrie, Lizzy und ich, täglich alle zwei Stunden nach Saly sehen. Sonst stirbt womöglich noch die fünfundachtzigjährige Deborah Richardson an Erschöpfung.”
(Schluß folgt)
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!