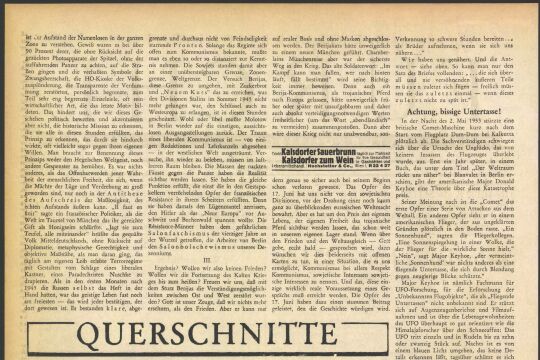Ein Verdacht geht um in Österreich, der Verdacht, dass die zeitgenössische Kunst, die junge jedenfalls, unpolitisch sei. Womit sollte sich eine Generation, die nichts erlebt hat und behütet aufgewachsen ist, beschäftigen? Mit dem eigenen mickrigen Ich? Der Vorwurf, junge Kunst habe nichts zu sagen, ist alt und ein Zeichen der Trägheit. Wird Kunst besser, wenn einer durch die Hölle des Krieges gegangen ist? Muss man, um Bedeutsames zu sagen, an Depressionen leiden und müssen sich Künstler zu Ikonen des Leidens verkleiden, damit sie für die Öffentlichkeit glaubwürdig wirken? Es kann einen unschätzbaren Vorteil bedeuten, wenn sich Künstler im Abstand zur Zeit, im Abstand zum Raum an eine Sache herantasten, die sie nicht unmittelbar selbst betrifft, die aber ohne Zweifel von skandalösen, grausamen, Menschen verachtenden, mörderischen Zuständen zeugt.
Der Fotokünstler Markus Oberndofer, Jahrgang 1980, bringt seiner Gegenwart eine geschärfte Aufmerksamkeit entgegen. Deshalb stechen ihm Einzelheiten ins Auge, über die andere hinwegsehen. Wie viele Urlauber hielt er sich in Frankreich am Meer auf, und er hätte sich zufrieden geben können mit Sonne, Wasser und Ruhe. Ihn aber begannen architektonische Fragmente von auffallender Nutzlosigkeit aus einer anderen Zeit zu beschäftigen. Nach und nach holte sie sich das Meer, sodass über kurz oder lang historische Monumente aus dem Blickfeld verschwunden sein werden. Er musste erst Erkundigungen einziehen, um zu erfahren, dass es sich um Anlagen der Nationalsozialisten handelte, Überreste des Atlantikwalls, Bunker, militärische Nutzbauten. Kein Schild um Cap Ferret wies darauf hin, dass an diesem Ort grauenhafte Geschichte geschrieben wurde. Oberndorfer machte sich mit der Kamera auf die Suche und erstellte eine Serie jener Objekte, die dem Vergessen überantwortet werden sollen. Die Aufnahmen sind bewusst überbelichtet gehalten, dass man den Eindruck bekommt, dass diese Welt im Begriff ist zu verschwinden. Das ist nur eine Deutungsart, die Erinnerung einmahnende, an unser Gedächtnis appellierende. Was aber, wenn sich aus dem Schemenhaften, dezent Verborgenen das Vergangene erst wieder herausschält, an Farbe und Kraft gewinnt? Dann würde das Verschwiegene wieder Kontur gewinnen. Damit stimmt Oberndorfers Kunst jener jüdischen Deutung von Geschichte zu, die behauptet, dass alles, was einmal gewesen ist, wieder eintreffen kann: die Zukunft als Wiedergängerin der Vergangenheit.
Sieht man sich in der Ausstellung "Under Pressure“ im Salzburger Museum der Moderne um, dann stößt man noch auf andere Methoden, Vergangenheitsräume aufzuschließen. Die Französin Tatiana Lecomte, geboren 1971, begab sich nach Mauthausen. Mit Dokumentarfotografie haben ihre Arbeiten nichts im Sinn, weil sie bewusst auf Abstand geht, wie es jemandem angemessen ist, der nur aus zweiter Hand über Vergangenheit informiert sein kann. Ihre Aufnahmen der "Fallschirmspringerwand“ wirken verschmutzt, seltsam entrückt. Sie fotografierte nicht den Felsen selbst, sondern dessen Spiegelbild auf dem leicht bewegten Wasser, auf dem auch noch Blätter treiben. Lecomte vermeidet jeden Affekt, ihre Kunst zu deuten setzt obendrein Vorwissen voraus. Fallschirmspringerwand? So nannten die Aufseher jene Stelle des Steinbruchs, von dem Häftlinge in den Tod gestoßen wurden.
Geprägt vom Zweifel
Das ist das Auffallende an der neuen historisch und politisch motivierten Kunst, dass in ihr der Zweifel stets sichtbar ist, etwas Verbindliches über Vergangenes zu sagen. Nichts da von Empathie, niemand nimmt den Betrachter an der Hand, um ihm zu sagen, was er zu denken hat und wie abscheulich Terrorregime doch eigentlich sind.
Fotografien dieser Art sprechen mit doppelter Zunge. Sie zeigen eine stille, beschauliche Welt, die erst ins Brodeln gerät, wenn man all das herausholt, was nicht unmittelbar gezeigt werden kann: den harten Boden der Geschichte, auf dem diese vorerst so harmlos wirkenden, ästhetisch inszenierten Bilder von Landschaften stehen. Dazu ist Sucharbeit des Beschauers notwendig, anders ist Aufklärung nun einmal nicht zu haben.
Angenehm geht es auch bei Gregor Sailer, einem Österreicher des Jahrgangs 1980, nicht zu, der das von Menschen gemachte Fürchterliche im Hier und Jetzt sucht. Er besuchte eine Stadt im tiefsten Sibirien, aus der niemand unkontrolliert herauskommt. Ausschließlich das Flugzeug bringt Passagiere in die Stadt und aus dieser heraus. Die Leute dort sind Verdammte, die die Gier des Staates nach den dort so reichen Bodenschätzen festhält. Die Behörden haben die Mobilität ihrer Bürger fest im Griff. Erst nach langem bürokratischen Aufwand gelang Sailer die Einreise, ausführen durfte er seine Aufnahmen nur nach Genehmigung. Was die Zensur übrig lässt, ergibt immer noch eine ausgesprochen freudlose, in architektonischer Erbärmlichkeit erstarrte Welt. Sailer steht Lukas Birk (geboren 1980) nahe, der herausbekommen wollte, was Touristen dazu bringt, nach Afghanistan und Pakistan zu fahren. Er trifft einen jungen Biologen in der Absicht, eine besondere Baumart zu erforschen. Seiner Arbeit kann er aber nicht nachgehen, weil das Land großflächig von Minen verseucht ist. Im Verlauf der Reise stößt Birk auf so merkwürdige Einrichtungen wie ein Tellerminenmuseum.
Die 1976 geborene Wiener Künstlerin Tanja Boukal holt jene aus der Anonymität, die unsere Gegenwart als Zwangsabgabe für den entfesselten Kapitalismus einfordert. Sie sammelt Material von Menschen im Auffanglager, von umgekommenen Bootsflüchtlingen, von Aufständischen im Arabischen Frühling. All diese Personen verfügen über ein unerzähltes Schicksal. Vielleicht tauchen sie in einer Zeitung auf, um Kunde zu geben von einem neuen Unglück, einer frischen Gewalttat. Solche Schicksale haben das Pech, nie für sich genommen zu werden, sondern immer für ein Kollektivereignis zu stehen.
Boukal greift solch eine Momentaufnahme aus dem Kontinuum des laufenden Schreckens heraus, in der das Leben eines Unbekannten gerade an ein tragisches Ende gekommen ist oder dabei ist, sich zu verändern. Nach Art biedermeierlicher Behäbigkeit verwandelt sie das Tragische in Stickbilder, vielleicht sogar im vergoldeten Rahmen, um im Kontrast von Idylle und Katastrophe die Wirkung zu steigern. Die Künstlerin hat nicht die Kraft, in das Schicksal einzugreifen, sie verändert nichts, aber im Verlauf der Arbeit nimmt sie sich viele Stunden Zeit für den Einzelnen, von dem sonst niemand etwas wissen will. Eine Art Meditation über die Tragik unserer Zeit.
Forderung nach dem genauen Blick
Der Anspruch von politischer Kunst heute ist anders als er in früheren Zeiten einmal gewesen ist. Sie entwickelt keine agitatorischen Energien, sie kommt nicht mit dem Gestus der weltumfassenden Erklärung. Sie nimmt sich selbst zurück, fordert eine geduldige Öffentlichkeit, die sich einübt in den genauen Blick. Solch eine Kunst ist eine Aufforderung, sich von der reinen Anschauung zu entfernen und sich Informationen zu beschaffen über unsere Zeit und die jüngste Geschichte. Wie ein Menetekel ist bei Tanja Boukal jene Botschaft ausgestellt, die ein griechischer Apotheker in seinem Abschiedsbrief hinterließ, bevor er sich am 4. April 2012 in aller Öffentlichkeit erschoss: "Da ich ein Alter erreicht habe, das es mir nicht erlaubt, auf aktive Weise Widerstand zu leisten (ohne jedoch auszuschließen, dass, wenn ein Grieche die Kalaschnikow nähme, ich mich dem anschließen würde), finde ich keine andere Lösung als meinem Leben ein würdiges Ende zu setzen, bevor ich damit beginne, die Mülltonnen nach Nahrung durchzusuchen.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!