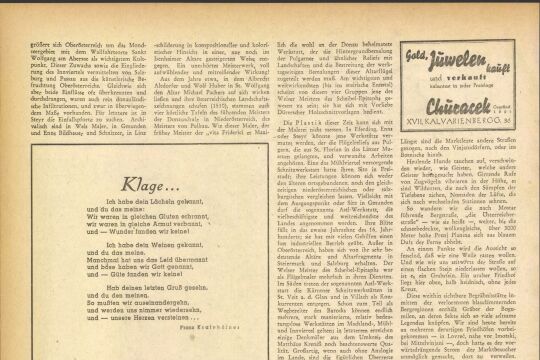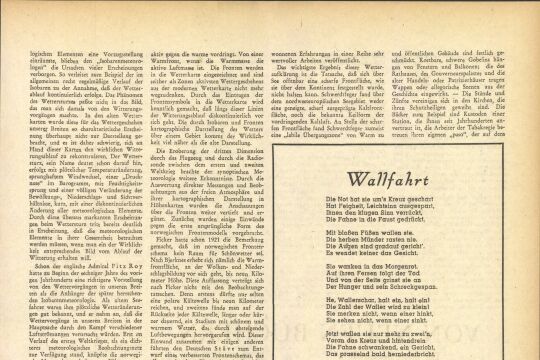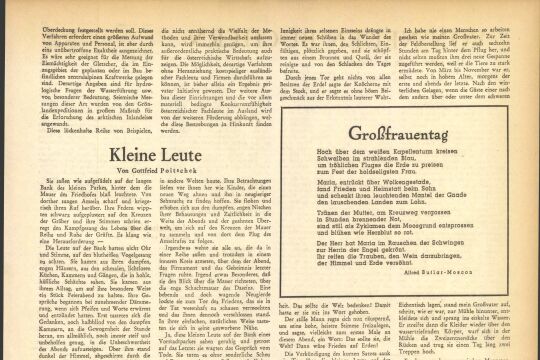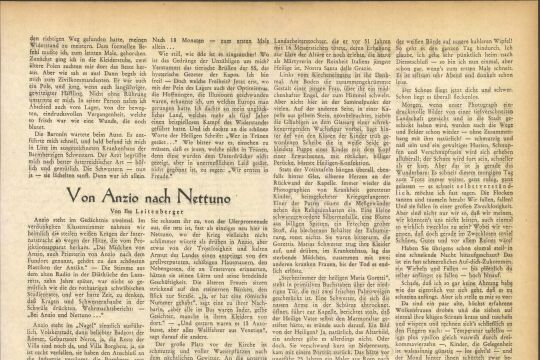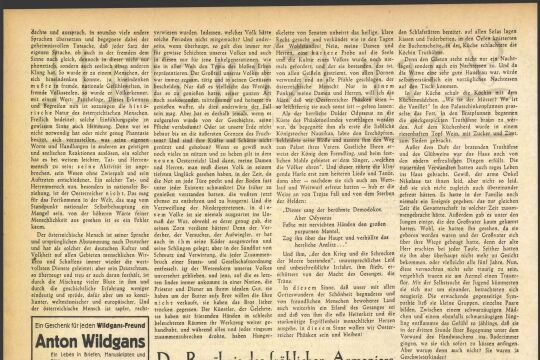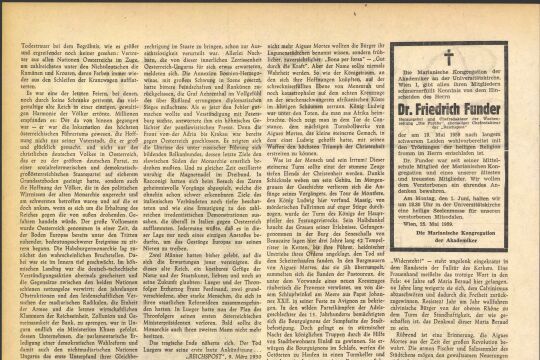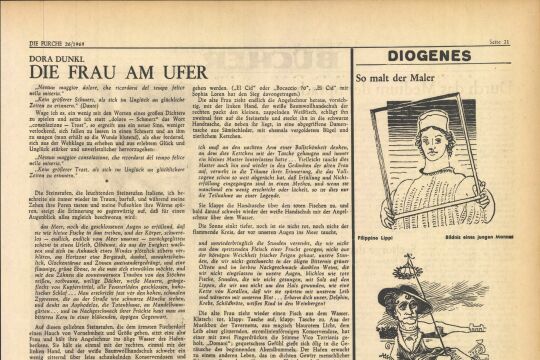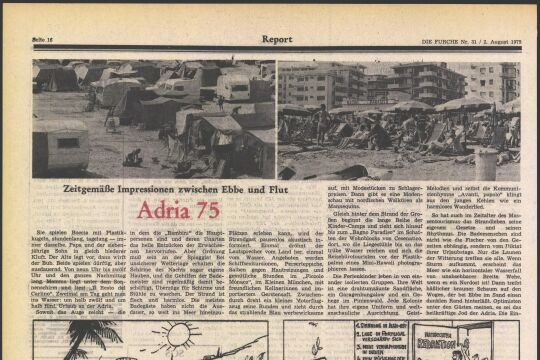LEICHT FRIEREND, in Decken und Mäntel gehüllt, schlummern wir, manchmal von einem heftigen Zittern der Flügel geweckt. Über uns leuchtet ein in strahlendes Tiefblau getauchter Himmel. Jäh weicht die Nacht dem Tage, und unter uns hebt sich die Küste Indiens aus den blauen Fluten des Arabischen Meeres.
Nach glatter und eleganter Landung im Flughafen von Santa Cruz — der Name stammt von einer portugiesischen Landnahme im 15. Jahrhundert — betreten wir müde, verwundert und benommen, doch voller Erwartung kommender Erlebnisse indischen Boden. Zwei Stunden dauern die peinlichen Zoll- und Paßformalitäten.
Auf dem Dach des einstöckigen Flughafengebäudes und hinter den Gittern der Zollräume drängt sich eine seltsam . zusammengewürfelte Menge. Hindus in Dhotis — einem Kleidungsstück aus weißem Baumwollmuslin, das hosenartig und luftig um die Beine gewunden wird — und einem losen Hemd, Sikhs mit Turbans in zarten Pasteil- tönen, sonst aber meist europäisch angezogen, mit Vollbärten, kunstvoll aufgezwirbelt unter einem feinen Haarnetz, Mohammedaner mit engen, gefältelten Hosen und knielanger, geknöpfter Tunika mit Stehkragen oder flatternden weißen Matrosenhosen und Hemden, Diener und Chauffeure in weißer, chinesisch wirkender Uniform und Kulis in Lumpen; Gesichter verschiedenster Schattierungen vom dunkelsten Blauschwarz bis zum hellsten Braungelb starren uns Ankömmlingen regungslos entgegen. Unter dieser bunten Menge erblickt man hie und da einige wenige Weiße, deutsche Ingenieure und ihre Angehörigen, amerikanische Geschäftsleute oder Touristen und britische Beamte,
DAS EUROPÄISCH WIRKENDE GELÄNDE des Flughafens hinter uns lassend, fahren wir an graslosen, schilfigen Marschen, Tümpeln und an kaum mannshohen Elendshütten aus Wellblech, geflochtenen Palmblättern, Lehmziegeln, Jutesäcken oder Holzbrettern vorbei, aus denen Frauen, Kinder, Männer und Greise, pechschwarze Schweine und dürftiges Federvieh herausquellen.
In bunte Fetzen gehüllt, notdürftig bekleidet, mit strähnigem Haar, barfuß, manchmal mit silbernen Fuß- und Nasenringen, hocken Frauen und Kinder umher; Kranke und Müßige liegen auf hanfgeflochtenen Liegestätten vor den Hütten und Buden, auch auf den Gehsteigen. Nicht selten bietet ein großer Korb, über den Kopf gestülpt, den einzigen Schutz vor den sengenden Strahlen der Sonne.
Um ein graubraunes Tuch, auf dem Gehsteig ausgebreitet, versammelt sich eine vielköpfige Familie zum Mahle.
Dhobis — die Wäscher —, die die Felsblöcke des Meeres als Arbeitsstätte benützen, in deren Nähe sie in kleinen Hütten aus Baumrinde wohnen, halten auf den Wäschesäcken ihrer Kundschaften gern ein Schläfchen. Kulis und Obdachlose ohne Zahl schlafen zu jeder Tageszeit unter und auf den Bänken der Uferpromenaden, nachts auf den Gehsteigen oder in den Höfen und Passagen der Häuser und auf den Stufen der Denkmäler, als leblose Klumpen in schmutzige Tücher gewik- kelt. Unter den spärlichen Lichtern einer Straßenlampe hocken die Männer und’ lesen Zeitungen oder lernen schreiben.
HEILIGE KÜHE, UNTER ALL DEM Elend allein wohlgepflegt und wohlgenährt, stapfen gemächlich im dichten Menschengewimmel, durch das sich pausenlos wacklige Taxis, in Indien erzeugte Hindustans und Fiats, amerikanische und englische Luxuslimousinen, aber auch Autos anderer Herkunft, von einheimischen Fahrern gelenkt, rücksichtslos den Weg bahnen. Ausrangierte englische Doppeldeckerautobusse und Tramways, von verwegen aussehenden Fahrern bedient, werden ausschließlich von der ärmeren Bevölkerung benützt. Kein Inder und keine Inderin, die etwas auf sich halten, würden je in ein öffentliches Fahrzeug steigen; auch in den Straßen zu promenieren verbieten Sitte und Gegebenheiten.
Bettelnde Kinder in Lumpen, Bein lose, die sich mühsam auf dem schmutzigen Boden der Straßen und Gehsteige mit den Händen fortbewegen, Leprakranke, die ihre abgefaulten Finger, Arme oder Beinstümpfe um Bakschisch heischend entgegenstrecken, scharen sich binnen wenigen Minuten um das parkende Auto eines Weißen. Ein Inder würde diese Armen kaum eines Blickes, geschweige denn eines Almosens würdigen. Er wendet sich auch nicht um, wenn ein splitternackter Greis mit langem Bart, der sich offensichtlich büßend seinem Nirwana nähert, aufrecht durch die Menge schreitet.
Eine vieltausendköpfige Menge wogt nach Sonnenauf- und Sonnenuntergang auf den Kais und Molen. Es ist die einzige Zeit des Tages, zu der sich Angehörige der besseren Kreise ins Freie begeben, um, dem englischen Vorbild getreu, Bewegung zu machen und frische Luft zu schöpfen. Im Laufschritt, arm- und beinstoßend, unbekümmert um Tausende von Zuschauern, absolvieren ältere und jüngere Männer ihr Pensum Graziöse oder bereits zur Fülle neigende Inderinnen schreiten in unnach- ahmbarer Würde, immer einen Schritt hinter ihren männlichen Begleitern.
GROSS IST DIE ZAHL DER SADHUS, das heißt der Heiligen, die, barfuß und kahlgeschoren, in ein orangefarbenes Laken gewickelt, das den halben, meist gutgenährten und gepflegten Oberkörper freiläßt, mit Wanderstab und Bettelschale selbstbewußt auf den Straßen und Strandpromenaden einherschreiten. Das Gesicht dem Meer zugewandt, die Hände gefaltet, sich mehrmals tief verneigend, unbekümmert um Vorübergehende, stehen Männer und Frauen, die ihre Andacht verrichten.
Feiste Männer, das obligate Tuch aus weißer Seide sarongart’g um die Hüften geschlungen, mit heiligen Zeichen auf der Stirn, kehren von einer Morgenandacht aus dem Tempel der Lakshmi zurück, wo sie Fülle und Reichtum für sich und ihre Angehörigen von der Göttin erflehten.
Die Religion der 340 Millionen zählenden Hindus gestattet es nur Männern, die vorgeschriebenen Riten ihres Glaubens zu vollziehen. Frauen und Mädchen aber dürfen das heilige Symbol Shivas, den Lingam (Phallus) salben und täglich mit Blumen schmücken. Im Höhlentempel von Elephanta auf einer kleinen Insel in der Bucht von Bombay gibt es drei heilige Schreine mit je einem in riesigen Dimensionen auf quadratischem Sockel aus dem Felsen herausgehauenen Lingam, der als höchstes Kultbild verehrt wird und auf den täglich frische Blüten gestreut werden. Seit mehr als 1200 Jahren pilgern gläubige Hindus — mit Ausnahme der Unberührteren, denen der Zutritt bis vor kurzem verweigert war — zu diesem Heiligtum.
EINE KASTENLOSE, WESTLICHER Bildung und Lebensart aufgeschlossene Bevölkerungsgruppe persischer Abstammung stellen die 120.000 Parsen dar. Sie sind Monotheisten und Anhänger des Zarathustra, denen die vier Elemente: Wasser, Feuer, Erde und Luft heilig sind. Ihre Feuertempel sind kubische Gebäude, von einer riesigen Steinflamme gekrönt. Zwei geflügelte, menschenköpfige Tiere flankieren den Tempeleingang, der ständig von einem Wächter gehütet wird. Weder die Tempel noch die Friedhöfe der Parsen, die „Türme des Schweigens“ genannt, sind je von Glaubensfremden betreten worden. In Bombay liegt der „Turm des Schweigens“ auf dem Malabar Hill, einem vornehmen Stadtteil, inmitten eines dichtbewachsenen,’ ummauerten Gartens, wo fast mannshohe Aasgeier zu Dutzenden auf riesigen Bäumen ritzen und sich von Zeit zu Zeit in; Sturzflug kreischend ein Stück von einem im Turm ausgelegten Toten holen.
Die Parsen besitzen im Gegensatz zu den Hindus Sinn für soziale Einrichtungen; sie haben Krankenhäuser, Schulen, Volksküchen und Waisenhäuser für ihre, aber auch andersgläubige Arme errichtet. Sie betätigen sich zumeist als Kaufleute, Industrielle oder Rechtsanwälte und haben durch bedeutende Stiftungen den Bau von öffentlichen Instituten, wie zum Beispiel der Asiatic Library und der Lady Thackersey 1920 gestifteten Bombayer Frauenuniversität, ermöglicht.
Wie jede andere RePgionsgruppe in Indien lassen sich auch die Parsen durch die Art ihrer Kleidung erkennen. Die Männer, meist hochgewachsen und schlank, tragen kniekehlenlange schwarze Gehröcke mit Stehkragen und einen typischen randlosen Steilhut mit Wulst gleicher Farbe. Par- sinnen huldigen dem kurzen, europäischen Haarschnitt, bedecken alter, wenn sie indisch gekleidet gehen, im Gegensatz zu den Hindufrauen, ihre Taille.
Die mohammedanischen Inderinnen müssen die faltigen Röcke und eng geschlossenen Blusen, die sie im Haus tragen, auf der Straße mit einer, bei Ehefrauen schwarzen, Borka — einem bodenlangen Umhang — verdecken und Gesicht und Haar unter einem dichten Muslinschleier verbergen, der in Augenhöhe " von einem feinmaschigen Netz ersetzt wird. Nur die Mohammedanerinnen der höheren Gesellschaftskreise tragen den landesüblichen Sari und verschleiern sich nur noch, wenn sie sich in ein besonders orthodoxes mohammedanisches Haus begeben. Noch immer ist es den Mohammeda nern gestattet, vier Frauen zu ehelichen; selten jedoch wird von diesem Recht Gebrauch gemacht, da wirtschaftliche Verhältnisse und soziale Rücksichten die Einehe begünstigen.
OBWOHL DER HINDUFRAU seit der innerhalb der letzten dreißig Jahre mehrmals erfolgten Kodifizierung der Ehegesetze (Hindu marriage acts) die Einehe an Stelle der Zweiehe, der Schutz und die Gleichberechtigung vor dem Gesetz und das Recht zur Erbfolge — das der mohammedanischen Inderin noch immer nicht zuerkannt wurde — zugesprochen wurden, hat dies ihre absolute Abhängigkeit vom Ehegatten und seiner Familie in der Praxis kaum geändert. Nach wie vor muß die junge indische Ehefrau im Hause ihrer Schwiegermutter leben und sich dieser vollkommen unterordnen. Sie hat weder Rechte noch Pflichten in der Haushaltführung, noch ist es ihr gestattet, eine persönliche Meinung zu vertreten
Keines der nach englischem Vorbild geschaffenen Gesetze ist wirklich in das Bewußtsein des indischen Volkes eingedrungen. Noch immer kann der Gatte, ohne im geringsten seine Stellung innerhalb der Gesellschaft zu riskieren, seine Frau töten oder aus dem Hause jagen, nachdem er ihr Schmuck und Kleider, die sein Eigentum bleiben, abgenommen hat. Oft kommt es vor, daß sich eine Hindufrau dem gnaden losen Ausgeliefertsein an einen grausamen und despotischen Gatten durch Selbstmord entzieht. „Lieber lasse ich mich von meinem Mann töten, als uaß ich in das Haus meiner Eltern zurückkehre, denn auch sie würden mich, nachdem mich mein Gatte verstoßen hat, nicht mehr als ihre Tochter anerkennen", anwortete mir die Schwiegertochter eines führenden weiblichen Erziehungsfachmannes.
FAST FREI VON BINDUNGEN DER RITEN und Vorurteilen sind nur die Mitglieder der höchsten Gesellschaft, und völlig frei jene der untersten Kaste, die Unberührbaren. Keine andere Inderin geht so aufrecht und selbstbewußt, ungeniert um sich bliik- kend durch die Straßen der Stadt, wie die nach wie vor „Unberührbare". Sie weiß sich seit vielen Jahrhunderten von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen und ihre 40 Millionen Kastengenossen gelten nur vor dem Gesetz als befreit. Immer noch verrichten sie die traditionelle Arbeit ihrer Kaste, denn das Reinigen des Bodens in Haus, Hof und auf der Straße, die Entfernung der Abfälle und des Unrats wird ihnen von keinem auch noch so armen Inder, sei er Diener oder Arbeiter, abgenommen, höchstens macht sich die europäische „Memsahib“ (Herrin-) ungeduldig daran, Bad und WC ihres Heimes selbst zu reinigen, wenn einmal die „Sweeperin“ des Hauses ausbleibt.
Ihre durch ständige Arbeit kräftigen und wohlgeformten Körperformen, kaum verdeckt durch den Baumwoll- sari der Armen, den sie hosenartig eng um Oberschenkel und Hüften geschlungen, mit dem oberen Ende kokett über den Kopf gezogen und einer die Brust kaum einschließenden Bluse trägt, riehen die Blicke von Männern aller Kasten auf sich. Oft deuten Brillanten in den Nasenflügeln und silberne Arm- und Knöchelreifen darauf hin. daß sich die Sweeperin nicht ausschließlich auf ihre traditionelle Verdienstmöglichkeit beschränkt.
MÖBEL SIND DER traditionellen indischen Wohnkultur fremd, wenngleich heute in begüterten Kreisen Möbel europäischen, meist englischen Stils, verwendet werden. Matratzenartige Matten werden abends auf dem Boden aufgerollt oder werden auf ein Gestell mit vier Pfosten gebreitet und ersetzen das Bett.
An Stelle von Sesseln und Stühlen verwendet der Inder - auch im Geschäft, wenn er der heimischen Sitte treu geblieben ist - Polster, die um niedrige Tischchen gruppiert werden. Die Kleider hängt man im Schlafzimmer über eine zwischen den Wänden gespannte Leine.
Einen einheimischen Antiquitätenhändler beobachtete ich beim Mittagmahl, wie er die Gerichte, in vielen kleinen Messingschalen auf einem runden Tablett serviert, der Landessitte tmäß, mit geübten Fingern verzehrte.