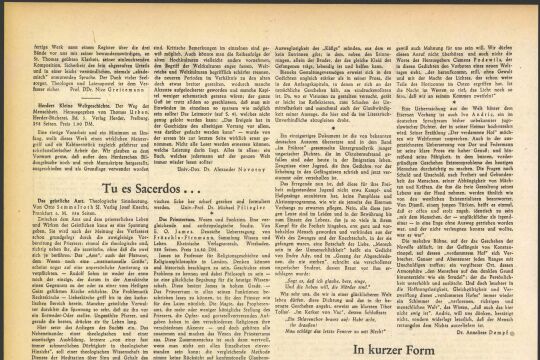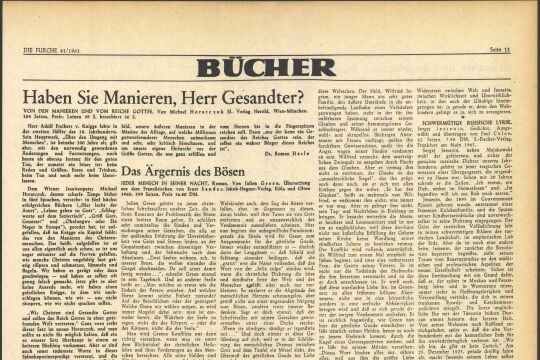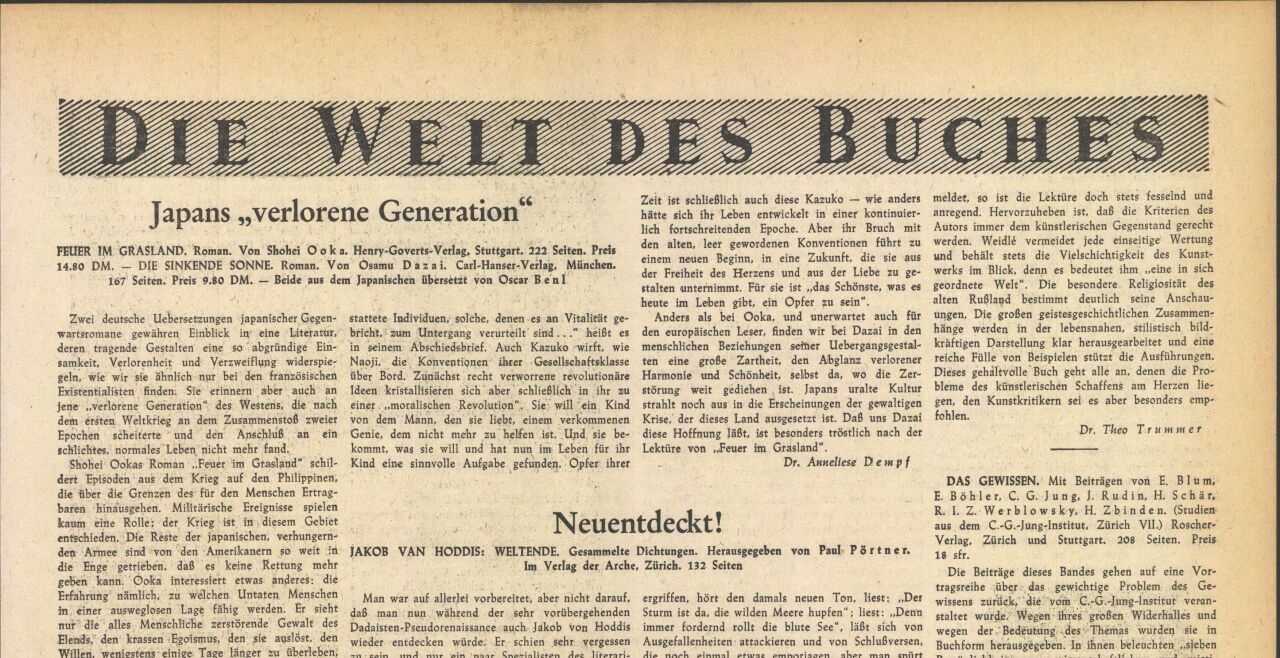
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Japans „verlorene Generation”
Zwei deutsche Uebersetzungen japanischer Gegenwartsromane gewähren Einblick in eine Literatur, deren tragende Gestalten eine so abgründige Einsamkeit, Verlorenheit und Verzweiflung widerspiegeln, wie wir sie ähnlich nur bei den französischen Existentialisten finden. Sie erinnern aber auch an jene „verlorene Generation” des Westens, die nach dem ersten Weltkrieg an dem Zusammenstoß zweier Epochen scheiterte ‘ und den Anschluß an ein schlichtes, normales Leben nicht mehr fand.
Shohei Ookas Roman „Feuer im Grasland” schildert Episoden aus dem Krieg auf den Philippinen, die über die Grenzen des für den Menschen Ertragbaren hinausgehen. Militärische Ereignisse spielen kaum eine Rolle; der Krieg ist in diesem Gebiet entschieden. Die Reste der japanischen, verhungernden Armee sind von den Amerikanern so weit in die Enge getrieben, daß es keine Rettung mehr geben kann. Ooka interessiert etwas anderes: die Erfahrung nämlich, zu welchen Untaten Menschen in einer ausweglosen Lage fähig werden. Er sieht nur die alles Menschliche zerstörende Gewalt des Elends, den krassen Egoismus, den sie auslöst, den Willen, wenigstens einige Tage länger zu überleben, und sei es auf Kosten derer, die einmal Kameraden waren. Es sind schauerliche Bilder, vor die wir gestellt werden. Mit dem Ausschluß der Kranken und Verwundeten aus. ihren Einheiten beginnt es. „Ich habe begriffen! Schütze Tamura kehrt sofort zurück ins Lazarett und bringt sich um, falls man ihn dort nicht aufnimmt!” Und mit Kannibalismus endet es! „Was, du bist noch immer da?” sagt ein Sterbender zu dem ausgestoßenen Tamura. „Wenn ich tot bin, darfst du das hier aufessen!” Und langsam hebt er seinen ausgestreckten linken Arm und schlägt mit der rechten Hand auf seinen Bizeps. Wenn sich für Tamura gerade dieses Angebot eines Sterbenden wie ein Verbot auswirkt — was er nicht tut, tun doch andere!
Eine weitere Frage, die nach der Freiheit des Menschen, zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Die letzte Antwort ist furchtbar. Tamura findet die Freiheit im Irrenhaus, in das er sich nach seiner Entlassung aus einem amerikanischen Militärlazarett, der Welt der Gesunden und Normalen nicht mehr gewachsen, freiwillig einweisen läßt, narrebairfosö’ rab nslIsrhsV isb ibilfiLnsmo itrs „Seitdem ich — wenn auch widerwillig in diese Weit zurückgekehrt bin, ist alles iu meinem Leben ganz und gar freiwillig geworden. Bevor ich in den Krieg zog, war mein Leben auf individuelle Notwendigkeiten gebaut, mein jeweiliges Tun war unvermeidlich. Sobald ich aber dann an der Front der als schrankenloser Autorität getarnten Willkür ausgesetzt war, wurde alles Zufall. Daß ich am Leben blieb, war Zufall, und dessen unmittelbare Folge, mein jetziges Dasein, ist auch nur Zufall…Die Menschen werden aber die Herrschaft des Zufalls wohl kaum je anerkennen können. Unser Geist ist nicht stark genug, um sich eine Kette von Zufällen vorzustellen, die sich ins Endlose fortsetzt. In dieser kurzen Spanne — zwischen dem Zufall der Geburt und dem Zufall des Todes —, die wir Leben nennen, registrieren wir jene kleine Anzahl von Vorfällen, von denen wir uns einbilden, sie seien unserem ,freien’ Willen zu verdanken; wir trösten uns damit, daß wir das Ergebnis dieser registrierten Willenakte, das uns immer als so unbedingt wesentlich erscheint, mit den Worten ,Charakter’ oder ,Leben’ bezeichnen. Anders können wir es uns gar nicht denken.”
Shohei Ooka ist Christ, wie wir aus einer Verlagsnotiz erfahren, eine Tatsache, die seine trostlose Weitsicht für den europäischen Leser nur noch quälender macht. Das hier besprochene Buch gilt übrigens in Japan als einer der besten Romane der Nachkriegszeit, der seinem Autor, ebenso wie die früheren Bücher „Gefangener” und „Lady Musashino”, bedeutende japanische Literaturpreise einbrachte.
Interessant ist ein Vergleich Ookas mit Osuma Dažai, der sich 1948, kaum 39jährig, das Leben nahm, als er keinen anderen Ausweg mehr sah, mit seiner Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit fertig zu werden. Opfer einer Zeitenwende scheint er, wie auch die Gestalten seines Romans „Die sinkende Sonne” — jeder in seiner besonderen Weise — Opfer des großen gesellschaftlichen und geistigen Umbruchs sind, den das heutige Japan zu bewältigen hat. Und doch ist dieses Buch tröstlich, verglichen mit „Feuer im Grasland” — es gibt nicht nur Untergang, sondern auch Verwandlung.
Dažai schildert das Ende einer alten japanischen Adelsfamilie, in deren Schicksalen wir uns vertraute Erfahrungen wiederfinden, eben Wesenszüge jener „verlorenen Generation des Westens”, an die uns das Geschwisterpaar Kazuko und Naoji erinnern. Die Mutter der beiden, eine Aristokratin großen Formats, lebendige Verkörperung noch jener alten feudalistischen Ordnung, die nun zusammenbricht, stirbt bei aller Resignation voll Haltung und Größe, Naoji, dessen Lebensweg dem des Autors sehr ähnlich ist, begeht Selbstmord nach einem ausschweifenden Leben, das ihn immer tiefer in Ueberdruß, Verzweiflung lind Hoffnungslosigkeit getrieben hat. „Ei mag sein, daß zu allen Zeiten mangelhaft ausgestattete Individuen, solche, denen es an Vitalität gebricht, zum Untergang verurteilt sind…” heißt es in seinem Abschiedsbrief. Auch Kazuko wirft, wie Naoji, die Konventionen ihrer Gesellschaftsklasse über Bord. Zunächst recht verworrene revolutionäre Ideen kristallisieren sich aber schließlich in ihr zu einer „moralischen Revolution”. Sie will ein Kind von dem Mann, den sie liebt, einem verkommenen Genie, dem nicht mehr zu helfen ist. Und sie bekommt, was sie will und hat nun im Leben für ihr Kind eine sinnvolle Aufgabe gefunden. Opfer ihrer Zeit ist schließlich auch diese Kazuko — wie anders hätte sich ihr Leben entwickelt in einer kontinuierlich fortschreitenden Epoche. Aber ihr Bruch mit den alten, leer gewordenen Konventionen führt zu einem neuen Beginn, in eine Zukunft, die sie aus der Freiheit des Herzens und aus der Liebe zu gestalten unternimmt. Für sie ist „das Schönste, was es heute im Leben gibt, ein Opfer zu sein”.
Anders als bei Ooka, und unerwartet auch für den europäischen Leser, finden wir bei Dažai in den menschlichen Beziehungen seiner Uebergangsgestal- ten eine große Zartheit, den Abglanz verlorener Harmonie und Schönheit, selbst da, wo die Zerstörung weit gediehen ist. Japans uralte Kultur strahlt noch aus in die Erscheinungen der gewaltigen Krise, der dieses Land ausgesetzt ist. Daß uns Dažai diese Hoffnung läßt, ist besonders tröstlich nach der Lektüre von „Feuer im Grasland”.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!