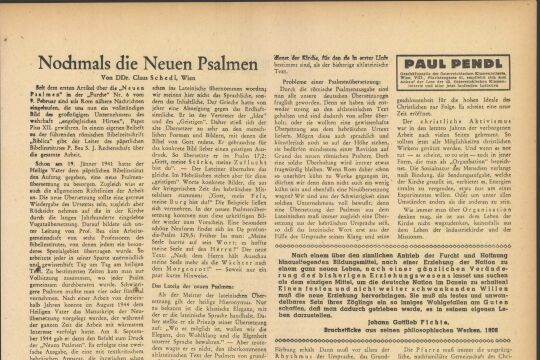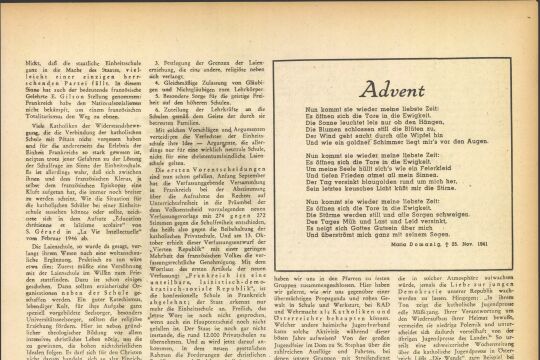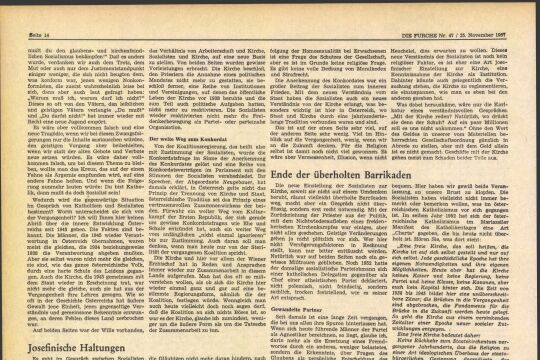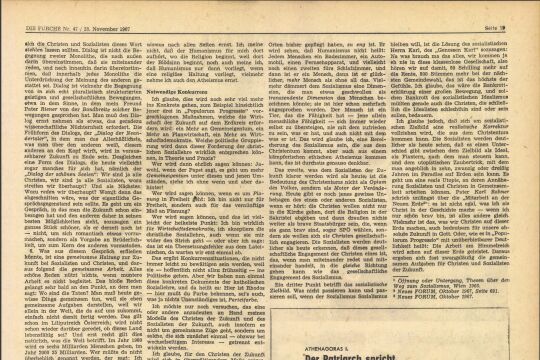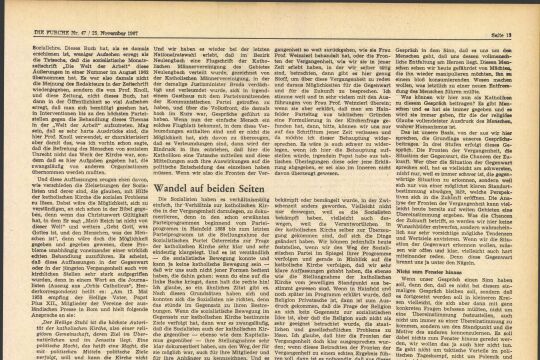T“ em satten Wohlstandschristen unserer „wackeren neuen Welt“ (Aldous Huxley) ist Weihnacht nur noch Erinnerung, Gedächtnis; eine Sache, die einer gewissen Mirjam zugestoßen ist vor unvordenklichen Zeiten und von der uns sicher nichts mehr passiert. Freilich, selbst das Gedächtnis ist schwach und die Erinnerung schlecht. Sonst würden unsere Schaufensterdekorateure nicht vergessen haben, daß Jesus in einem Stall geboren wurde, „dem schmutzigsten Ort in der Welt“; „und ein Stall ist finster, und es stinkt darin“, bemerkt Papini.
Einmal erlebten wir es auch selbst anders, als wir aus Krieg und Bombennächten heimkamen. Die Augen brannten uns noch von Rauch und Dreck, und der seltsame Geruch von verbranntem Menschenfleisch stand uns noch in der Nase. Alle Fronten schienen plötzlich zusammengebrochen. In halb zerfallenen und ausgeplünderten Alm- und Berghütten und bei einer Notverpflegung, die man sich heute kaum mehr vorstellen kann, trafen einander die Feinde von gestern zum Gespräch: Liberale. Nationale, Austromarxisten und Christen; bedachten die uralten Fragen der Menschen, Philosophie und Religion, Kunst und Geschichte, Transzendenz und Inkarnation und die Botschaft Jesu; lasen die Zeugnisse der Christen und Nichtchristen, die diese „im Angesicht des Todes" (Alfred Delp) an ihre Nachwelt gerichtet hatten, und diskutierten sich heiß bis in den Morgen, bis das flackernde Öllicht längst verloschen war. Der österreichischen Kirche war es klar, daß sie in solch einer Zeit besonders unmißverständlich nichts sein dürfe als Kirche, als Künderin der Botschaft Jesu an alle und als Ausspenderin Seines Reichtums; daß sie mit besonderer Vorsicht alles meiden müsse, was sie als Kirche nur einer bestimmten Klasse oder gesellschaftlichen Schichte, also nur einer pars des Volkes, erscheinen lassen könnte, oder auch nur als Kirche einer bestimmten Zeit. Darum liebte sie keine allzu engen Bündnisse mit Mächten dieser Welt, die Sicherheiten vortäuschten, für die in einer pluralistischen Gesellschaft und nach der Auflösung der feudalen, mittelalterlichen, konstantinischen Welt keine Deckungen mehr da waren. Daruin wär sie mißtrauisch gegenüber allzu „christenheitlichen“ Konzeptionen im Wissen, daß ihr heute letztlich keine anderen Mächte bleiben als ihr Herr, der sie führt, und als die unbändigen Kräfte des Glaubens, Hoffens und Liebens in den Herzen derer, die sich zu ihr bekennen. Das war eine gerade für Österreich nicht gewöhnliche Haltung. Das hieß nämlich, sich abwenden von bloßer Restauration, vom bloßen Fortführen geheiligter Traditionen; das hieß, Kirche in die Zukunft bauen.
Gewiß gab es dabei mancherlei Mißverständnisse. Manche glaubten, das erlaube ein spiritualistisches Sichzurückziehen der Kirche oder gar der Christen auf Sakristei und Gottesdienstraum, ein Verachten gewachsener und lebendiger Kräfte, einfach weil sie früher auch schon da waren, oder gar einen Verzicht auf die Kraft der Organisation. Doch bald wurde offenkundig, daß die Kirche keinesfalls gewillt war, auf ihre Sendung in die Welt zu verzichten, ja daß sie jetzt noch glaubwürdiger für Jesus Zeugnis ablegen konnte vor der Welt; daß aber der einzelne Christ, von Gott auch zu einem zeitlichen Werk in die Welt gestellt, dieses Werk in christlicher Verantwortung zu tun habe, im öffentlichen Leben, in Kultur, Wirtschaft, Politik sowie in Familie und Beruf. Wie wenig aber die Kirche auf ein organisiertes Wirken in diese Welt verzichten W'ollte, hat sie bewiesen durch Aufbau und Förderung einer in sich wieder in spezialisierte Verbände gegliederte und nach Verbänden und Diözesen föderativ zusammengeschlossenen Katholischen Aktion.
Zum erstenmal wurde dieser Weg der österreichischen Kirche in einem gewissen Höhepunkt sichtbar bei der Mariazeller Studientagung der österreichischen Katholiken im Mai 1952, die „eine freie Kirche in einer freien Gesellschaft“ proklamierte, und als im September desselben Jahres der Wiener Kardinal die Katholiken Österreichs zum allgemeinen österreichischen Katholikentag einlud „über alle Schranken des Standes, des Berufes, der Klassen und Parteien hinweg, um ein Bekenntnis abzulegen für Euren Glauben".
Parallel zu dieser Entwicklung ging eine andere, an sich nicht minder erfreuliche: zur Wiedergewinnung der politischen Freiheit, zum wirtschaftlichen Aufstieg, zu einem lang nicht mehr dagewesenen Wohlstand, zum „österreichischen Wirtschaftswunder", wenn auch leider mit noch etwas zu unterschiedlicher Beteiligung. Und auf dieser Straße befinden wir uns noch immer — und feiern Weihnacht, immer wieder Weihnacht. Und was ereignet sich? Am Ende wieder nichts als ein wenig Erinnerung? Und eine schlechte Erinnerung, nicht einmal mehr daran, daß es ein Stall war, finster und voll Gestank; jedenfalls eine Erinnerung an etwas, was jemand anderem zustieß, aber nicht uns, die wir den „realeren“ Dingen nachgehen, den Fragen der Rentabilität, der Produktions- und Gewinnsteigerung, des Konsums und des Lebensstandards. Sind wir nicht nahe daran, alles das zu verkaufen und zu verspielen, was uns in den Nächten der Not und des Todes in Schmerzen geboren und geschenkt wurde? Das ist die Frage, die das Mysterium vom Herabstieg Gottes in unsere Geschichte den österreichischen Christen stellt, und unter dieser Frage müßten die noch unbewältigten und doch zu bewältigenden Probleme der österreichischen Kirche stehen. Es sei nur einiges angedeutet.
Da ist zunächst der grundsätzliche Weg der Kirche dieses Landes. Die Kirche selbst geht diesen Weg gewiß unbeirrt weiter. Aber verstummen nicht da und dort die begonnenen
Gespräche, verhärten sich nicht die Fronten, werden nicht alte Barrieren aufgebaut, hört man nicht wieder alte, haßerfüllte Worte, die 1946 niemand gesprochen hätte? Solche Dinge bedrohen den Weg der Kirche und damit auch jenes Werk, dem gerade diese Wochenschrift mit Mut und Ausdauer dient, das
Werk der Versöhnung der Arbeiterschaft mit der Kirche. Aber manche scheinen nichts mehr zu fürchten als solche Annäherungen und empfinden eine wahre Freude — es kann nur eine höllische sein — in der Feststellung, daß diese oder jene Bekehrungen nicht oder noch nicht ganz stattgefunden haben und man sich darum mit Recht weiter bekämpfen könne, ja müsse. Hört man nicht wieder lauter antisemitische Stimmen, auf die auch Katholiken zu leise reagieren und ohne ihrer geschichtlichen Mitschuld gegenüber den Juden zu gedenken? Andere Gespräche haben kaum begonnen: das ökumenische Gespräch mit der Ostkirche, mit den evangelischen Brüdern. Könnte man sich nicht mitunter ein gemeinsames Vorgehen der christlichen Bekenntnisse auf karitativem, sozialem, kulturellem Gebiet in der Öffentlichkeit vorstellen, wie dies etwa von der Katholischen und Evangelischen Jugend schon geschah?
Doch auch innere Barrikaden bedürfen des Abbruchs. Seit langem gibt es mehrere österreichische Katholizismen. Das hat geschichtliche Ursachen. Das betrifft Fragen des Lebensstils, der Beurteilung wirtschaftlicher, sozialer, politischer Geschehnisse, einer mehr konservativen oder mehr dynamischen Einstellung, des Leitbildes, das man sich vom Weg der Kirche in Österreich macht. Das wäre nicht so schlimm, wenn das nur bedeuten würde, daß sich die Katholiken eben in den Dingen, in denen man vom Glauben her nicht gebunden ist, frei und eben verschieden entscheiden. Schlimm wird das nur, wenn man diese verschiedenen Entscheidungen nicht zur Kenntnis nehmen will, sich gegenseitig zum Vorwurf macht, wenn man einander verdächtigt, verketzert, wenn diese Verschiedenheiten zu unüberwindlichen Barrieren werden, über die hinweg kein echtes Gespräch mehr möglich ist, keine Zusammenarbeit auch in den Dingen, in denen man wirklich eins sein müßte, und zwar einfach deshalb, weil man sich einbildet, man müsse auch dort eins sein, wo das durchaus nicht der Fall sein muß. In letzter Zeit ist es nun in der Gründung eines „österreichischen Komitees katholischer Organisationen“ zu einem echten Versuch gekommen, die katholischen Kräfte Österreichs in den Dingen zusammenzuführen, in denen dies notwendig und nützlich ist. Diese Zusammenarbeit wird dann fruchtbar sein, wenn sich hier wirklich alle entscheidenden und gerade auch die gegensätzlichen katholischen Kräfte treffen, aber bewußt als Glieder der Kirche treffen, wenn es dabei zu einem ehrlichen und offenen Gespräch kommt und wenn man Einigungen von vornherein nur erzielen will, wo sie vom Glauben her wünschenswert sind, und nicht, wo vom Glauben her legitim verschiedene Lösungen möglich sind, wenn man also Kirche bleiben will und nicht krampfhaft einen einzigen „Katholizismus" oder gar eine neue Christenheit fabrizieren will. Erfreulicherweise sind solche Versuche einer echten Kooperation und Koordination auch in den Diözesen im Gange.
Aber da sind noch andere Fragen, die eine neue, christliche und glaubhafte Antwort erwarten, nicht von außen her, sondern von Katholiken einer Kirche, die in dieser Zeit und Geschichte Fleisch angenommen hat: die Auseinandersetzung mit der jungen Generation und ihrem Lebens- und Weltgefühl, das nach einer christlichen Bewältigung und Sinngebung schreit und dem man nicht mit ein paar asketischen Sprüchen beikommt, denen mehr Platon und andere Heiden Pate gestanden sind, als Jesu Frohe Botschaft; die echte geistige Auseinandersetzung mit der modernen Philosophie, mit dem dialektischen Materialismus — wer darüber einen fachkundigen Referenten sucht, muß ihn meist weit aus dem Ausland herbeiholen; das Gespräch der Philosophie, der Geisteswissenschaften, der Theologie mit den modernen Naturwissenschaften; die Erarbeitung einer christlichen Lehre von der Geschichte, von der Welt, von der Arbeit, Kultur, Technik, Gesellschaft; die Erstellung einer wahrheitsgetreuen differenzierten Zeit- und Milieudiagnose und die Überlegung einer entsprechenden wirksamen Therapie; die Überprüfung gewisser Thesen, die man unbesehen weitergibt, wie etwa die vom angeblich ewig gültigen klassisch-humanistischen, freilich christlich verbrämten Bildungsideal, an dem wir schon in unserer Jugend vor 30 Jahren gezweifelt haben und das heute erst recht nur noch als ein Gesprächspartner im großen Agon des Geistes vertretbar ist; die Überprüfung auch mancher eingefahrener „bewährter“ Methoden, die sich eben nun doch nicht mehr bewähren, und der Mut zum Experiment, zum Erproben neuer Modelle, sei es der Gemeinde- und Zentrenbildung, der offenen Tür, der Betriebsseelsorge und überhaupt der kate- goriellen Seelsorge; das Aufbrechen jener Tabus, von denen alle wissen, aber niemand spricht: in der Erziehung, in der Schule, in der Ehe, in der Kirche, im Verhältnis Priester und Laie, in der Gesellschaft, um den Gehorsam; die Probleme um die Heranbildung einer Priestergeneration für diese Zeit, von Kündern des Glaubens für dieses Geschlecht; der radikale Abbau jener krankhaften Empfindlichkeit mancher Leute gegenüber jedem gesunden und kritischen Luftzug, die die echten Auseinandersetzungen in den Untergrund drängt, die Atmosphäre vergiftet, die jeden verdächtigt, der meint, es könnte manches noch besser gemacht werden, und die die Hauptschuld trägt, wenn der Kirche auf irgendeinem Sektor die öffentliche Meinung fehlt, von der Pius XII. sagte, daß sie „die Mitgift jeder normalen menschlichen Gesellschaft sei“. Änderungen sind nur möglich, wo auch ein deutliches Wort der Kritik, wo ein offenes Gespräch möglich ist, wo man sagen kann, was man sich denkt, wo man nicht vorher überlegen muß: was hört man gern und wie hört man’s gern, wo man vom Partner nicht nur das Echo seiner eigenen Meinungen hören will. Von dieser erfrischenden Luft der Freiheit, der Liebe und der Brüderlichkeit wird es auch abhängen, ob sich Menschen mit eigenen Meinungen und Urteilen, ob sich begabte Menschen, ob sich Künstler, Dichter. Wissenschaftler bei uns wohlfühlen, ja ob es überhaupt weiter oder wieder christliche Künstler, Dichter und Denker von Rang bei uns geben wird. Im übrigen haben die verschiedenen Enqueten um das Konzil gezeigt, daß durchaus auch Laien fruchtbare Gedanken zu all diesen Dingen haben und auch nicht wenig zu ihrer Bewältigung beitragen könnten und daß es darum so sinnvoll wäre, jene schon erfreulichen Ansätze einer echten und offenen Zusammenarbeit von Laien und Priestern in der Kirche systematisch auszubauen, die das hierarchische Prinzip durch ein brüderliches und mitbrüderliches Prinzip ergänzt und Formen dafür findet.
Er hat Fleisch angenommen und ist Mensch geworden", bekennen wir im Nicänischen Symbolum als ein Geschehen, als eine Geschichte, die Jesus zugestoßen ist. Aber dieselbe Geschichte ist, wie Pėguy sagt, auch „eine der Erde zugestoßene Geschichte". Ist sie uns zugestoßen? Hat sie sich in uns ereignet? Ereignet sie sich noch in uns heute und morgen? In der Kirche Österreichs? Ist diese eine Kirche, die „die Zeichen der Zeit zu deuten versteht“ (Mt 16, 3), und darnach situationsgerecht handelt, eine Kirche in die Zeit hinein und darum allein schon eine Kirche in die Zukunft hinein? Das ist die Frage.