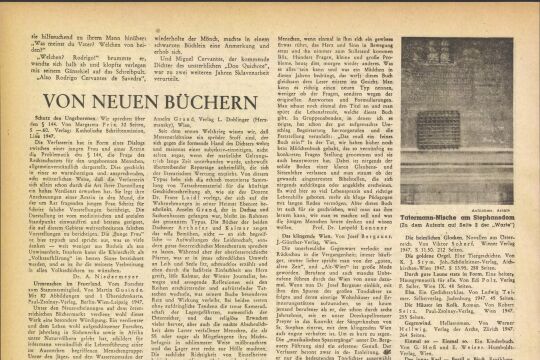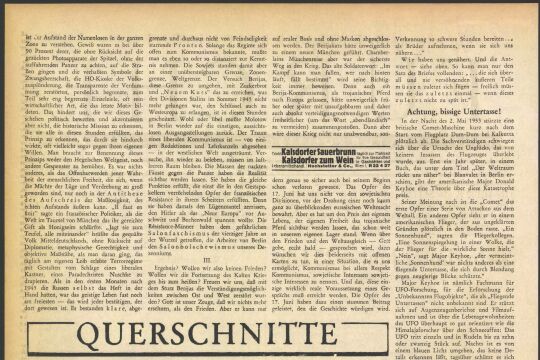Josef Haslinger tanzt auf dem Opernball einen Pas de deux mit sich selbst. Diesen Pas de deux tanzt der zornige, aber äußerst seriöse Autor Haslinger, den wir alle kennen, mit einem nach Skandal und Film schielenden Haslinger, den wir bisher so nicht kannten. Der Erfolg möge sich einstellen, ich gönne ihn ihm. Doch der zornige Haslinger und der nach dem Skandal schielende Haslinger müssen kenntlich bleiben und dürfen keinesfalls zu einer Figur verschwimmen. Es ist beim Lesen des. Romans „Opernball” nicht immer ganz leicht, sie ausein anderzuhalten.
Der Opernball ist vorbei. Die Re-sucher haben ihn glücklicherweise überlebt. In, wie sie sind, werden ganz gewiß einige von ihnen vorher Haslingers Roman „Opernball” (S. Fischer Verlag) gelesen und sich mit leichtem Gruseln daran erinnert haben, welches Schicksal ihnen des Dichters Phantasie zudachte. Auch Haslinger selbst braucht keine Angst mehr zu haben. Dem Vernehmen nach war er ja beim Gedanken, sein Politkrimi könne irgendwelche Wahnsinnige auf schreckliche Gedanken bringen, nicht ganz frei von einem flauen Gefühl.
„Opernball” handelt nämlich davon, daß Neonazis Rlausäure in den Schacht der Frischluftzuführung für das Operngebäude im Burggarten schütten und auf diese Weise die Besucher eines von einer privaten Fernsehanstalt eingekauften und daher besonders glanzvollen Opernballs ausrotten.
Der Film im Roman
Haslinger legt los, als wollte er Frederick Forsyth Überthrillern. Tausende Tote in der Wiener Staatsoper gleich auf den ersten Seiten des Romans. Die Rilder, die der Ich-Erzähler, der Fernsehjournalist Fräser,
Elötzlich auf allen Monitoren seines Ibertragungswagens sieht, gleichen einander: „Menschen schwanken, stolpern, taumeln, erbrechen. Reißen sich noch einmal hoch. Stoßen ein letztes Krächzen aus. Ihre Augen sind weit aufgerissen. Sie sehen, sie spüren, daß sie ermordet werden. Sie wissen nicht, von wem, sie wissen nicht, warum. Sie können nicht entkommen.” Der Verlag druckte diese Sätze auf die Rückseite des Schutzumschlags. Der Wiener Opernball -eine riesige Gaskammer.
Unmittelbar darauf wird der Erzählfluß bedächtig. Dabei bleibt es dann im großen und ganzen, bis auf die gewissen Szenen, in denen unschwer die ganz besonderen Zuk-kerln für potentielle Filmregisseure zu erkennen sind. Und an denen man die Filmhoffnungen von Autoren erkennt. Der abgerissene Finger in der Opernpassage, die Fingerabreißszene im Wienerwald: Das ist nicht Sprache, das ist Kino. Die Zerstückelung des Verräters durch die Nazis: Drehbuch, nicht Sprache. Die Bosnien-Erinnerungen des Ich-Erzählers: Optik, Kino. Und der in der Villa auf Mallorca spielende Schluß, die Stunden des Beporters mit dem halb wahnsinnigen Nazi-Ingenieur”, der Fräser zwingt, eine Nacht im Brunnenschacht zu verbringen: Das ist ein klassischer Film-Showdown. Schon auch Sprache, keine schlechte Sprache, aber primär: Optik, Drehbuch.
Um Mißversjändnissen vorzubeugen: Dies ist keineswegs ein Vorwurf. Das Schielen des Bomanautors nach dem Kino ist legitim. Ganze Begimenter hervorragender Autoren haben erfolgreich nach dem Kino geschielt, von Steinbeck bis Fallada, und Bomanen verdanken wir unzäh-
lige großartige Filme. Im konkreten Fall stellt sich die Frage nach dem Kalkül aber aus einem ganz besonderen Grund. Haslinger läßt eine ganze Menge Menschen sterben. Anonyme. Personen der Zeitgeschichte. Die ganze Bundesregierung. Ausländische Staatsoberhäupter. Auch die „kaiserlichen und königlichen Prinzen und Prinzessinnen” werden kaum lebend dem Gedränge entronnen sein.
Er läßt aber auch eine zwar nicht namentlich genannte, doch unschwer erkennbare und noch lebende emeritierte Wiener Professorin der Theaterwissenschaft (für ganz Begriffstützige wird auf ihre Aufnahme in den „Who is Who” verwiesen, schätzungsweise mindestens 126 „Opernbair'-Leser sprangen zum Bücherschrank) sterben, beziehungsweise gestorben sein.
Er läßt sie nicht dem Gasangriff
der Neonazis zum Opfer fallen, sondern einen alten deutschen Gelehrten nicht zuletzt in der Hoffnung, die große Liebe von einst wieder zu treffen, nach Wien zum Opernball gekommen sein, fädelt kunstvoll einen eigenen Handlungsfaden ein, läßt des Professors Tochter der alten Liebe des Herrn Papa nachspüren und erfahren, was zu erfahren Haslinger dem alten Professor erspart, nämlich, „daß sie schon gestorben war”.
Der erzählerische Aufwand, der in Gang gesetzt wird, um der alten Professorin, sowie dem tatsächlich verstorbenen Professor der Professorin, deren NS-Vergangenheit noch einmal unter die Nase reiben zu können, ist beträchtlich. Wie notwendig, sinnvoll, legitim (und so weiter) solches Unter-die-Nase-Beiben dort ist,
wo sich das individuelle Wirkungspotential der Gesinnung längst verloren hat, muß jeder Autor selbst entscheiden. Meiner Ansicht wird aber eine Grenze überschritten, wenn ein Autor den Tod einer konkreten, lebenden Person erfindet. Im konkreten Fall zieht er damit ein allgemeines Odeur von Voyeurismus des Todes, das mir beim Lesen von „Opernball” immer wieder aufstieß, mit einer Konsequenz durch, die tief ins Persönliche reicht.
Eine andere Frage, die ich beim Lesen dieses spannenden, Anteilnahme weckenden, anregenden Bomans - alles zugestanden! - nicht von mir weisen konnte und die mir wachsendes Unbehagen bereitete: Was kann, darf, soll die literarische Phantasie in ihren Fiktionen Mächtigen als Absicht unterstellen? Gibt es irgendwo einen Punkt, wo die Hereinnahme des Möglichen in die literarische Fiktion aufhört, Warnung vor Gefahren zu sein und wo sie beginnt, das Undenkbare denkbar zu machen? Gibt es den Punkt, wo die Sache kippt und die Warnung, gegen den Willen des Autors, mithilft, uns in Gedanken an Wirklichkeiten zu gewöhnen, die niemals eintreten dürfen?
Mitwisser des Wahnsinns?
Solche Wirklichkeit malt Josef Haslinger tatsächlich an die Wand, wenn er einen hohen Wiener Polizeibeamten zum Mitwisser der Nazis macht. Das Machtvakuum nach der Ausrottung der politischen Oberschicht kann ja der Polizei nur nützen... Und wenn er seinen Ich-Erzähler insgeheim vermuten läßt, aucn der Pariser Big Boß der privaten Fernsehanstalt könnte Wind vom geplanten Massenmord bekommen naben. Könnte ihn, Fräser, an den Begietisch verbannt haben, damit er nicht im Operngebäude Politiker interviewt - schlicht, weil er seinen besten Mann noch braucht.
All dies läßt sich trotz solcher möglicher Einwände bedingungslos verteidigen, wenn ein Zorniger wie der Haslinger, den wir alle kennen, mit Österreichs braun gesprenkelter Gegenwart und Vergangenheit rechtet. Die Bedenken werden aber stärker, wenn er der Vermutung Nahrung gibt, die infernalische Zuspitzung der Fiktion könnte auch etwas mit dem Schielen auf den verkaufsfördernden Skandal oder das Skan-dälchen zu tun haben.
Der gute, alte, zornige Haslinger flicht also aus fiktiven Interviewprotokollen vor allem dreier Menschen,
des Ich-Erzählers, der in der Oper selbst seinen eben erst der Sucht entrissenen, neu gewonnenen Sohn verloren hat, eines kleinen Wiener Polizisten und eines überlebenden Na-
zis, seinen kunstvollen Erzählzopf. Er stellt mit literarischen Mitteln eine Authentizität her, die überzeugend den Eindruck vermittelt: So weit könnte es tatsächlich noch kommen! Der Sohn des geflohenen Wiener Juden... der in reaktionären Klischees denkende Polizist, den uns Haslinger von innen sehen und verstehen lehrt... der auf eine charismatische Führerkarikatur abgefahrene und in die Sicherheit einer in sich geschlossenen Alptraumwelt abgetauchte Neonazi... ihre Geschichten fließen zu einem gespenstischen Panorama zusammen. Die Technik des fiktiven Protokolls ermöglicht es Haslinger, sich erzähltechnisch auf sicherem Boden zu bewegen und sicheren Abstand von allem zu halten, was für reißerisch gehalten werden könnte. Sich das Massensterben in der Oper auszumalen, bleibt der Phantasie des Lesers überlassen.
Eben dies hat aber einen möglicherweise unbeabsichtigten Effekt: Gerade weil sich der Erzähler aus dem von ihm erfundenen Inferno heraushält, bleibt dieses ein Versatzstück in einem konsequent durchdachten, gut komponierten, erzählerisch überzeugenden Buch. In diesem Buch würde auch dann alles stimmen, wenn die „Bewegung der Volkstreuen” lediglich das Gastarbeiterhaus auf dem Gürtel angezündet und statt der Opernballbesucher „nur” die Hausbewohner ausgerottet hätte. Die Psychologie der Nazis, die absolute Autorität ihres Führers, des „Geringsten”, die Psychologie der Polizisten, die Szenen während
des Opernballs vor der Oper, das alles wäre nicht weniger genau beschrieben. Selbst die Wirkung der zur Verfilmung einladenden Szenen wäre nicht kleiner. Bloß eine Startauflage von, wie man hörte, 21.000 Stück wäre schwerlich drin gewesen und die Wirkung auf potentielle Filmregisseure viel geringer.
Erzählerische Abstinenz
Die Verwandlung der Wiener Staatsoper in eine Gaskammer bleibt schließlich auch deshalb verkaufsförderndes Versatzstück, weil Josef Haslinger genau ab dem Punkt erstaunlich wenig politische Phantasie und erzählerische Mühe aufwendet, an dem sich für^eden mit solchen Wahnsinnsmöglichkeiten konfrontierten Leser Fragen über Fragen eröffnen:
Was kann es wirklich weitergehen in einem Staat, der auf einen Schlag seine politische Oberschicht verliert? Was ereignet sich in den Parteien? Welche Schichten ergreifen dort jetzt die Macht? Welche Machtspiele werden gespielt? Kommt nun politisches Gestaltungspotential von unten zum Zug?
Offenbar ist Josef Haslinger gar nicht aufgefallen, wie unbefriedigend er, intellektuell und erzählerisch, mit der von ihm geschaffenen Tabula-rasa-Situation umgeht. Wir erfahren, daß ein aus dem ehemaligen Jugoslawien stammender populistischer Polizeibeamter Nachfolger des in der Oper ums Leben gekommenen Polizeipräsidenten wird und daß er gegen Liberalität, Toleranz, Freiheit der Meinungsäußerung und Demonstrationsrecht hetzt. Wir erfahren, daß er den hochrangigen Mitwisser des Massenmords zum neuen Sicherheitsdirektor macht. Wir erfahren, daß bald Neuwahlen ausgeschrieben werden und daß Haslinger die Freiheitlichen als stärkste Partei aus ihnen hervorgehen läßt. Den Best dürfen wir uns selbst ausmalen.
Während in Wien der Opernball 1995 in Szene ging, lobte im ZDF Marcel Reich-Ranickis Literarisches Quartett Haslingers „Opernball”. Dem Lob schließe ich mich an. Daß es keine einzige kritische Frage oder Nebenbemerkung gab, spricht, nun ja, nicht gerade für die Tagesform der vier Literaturrichter.