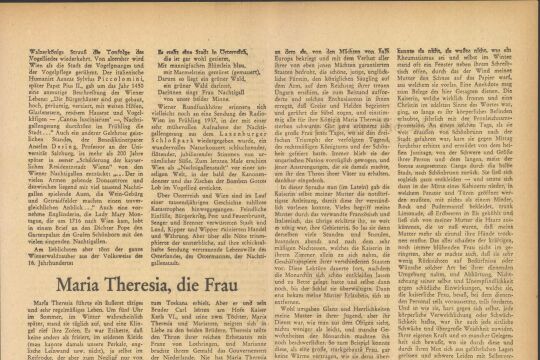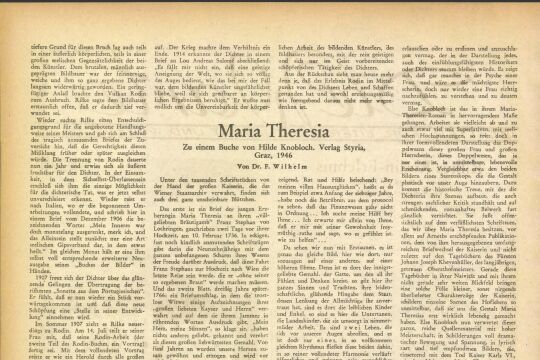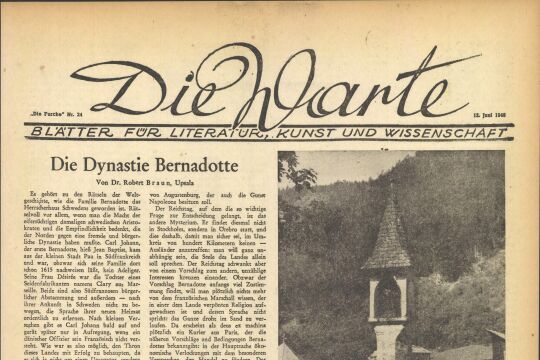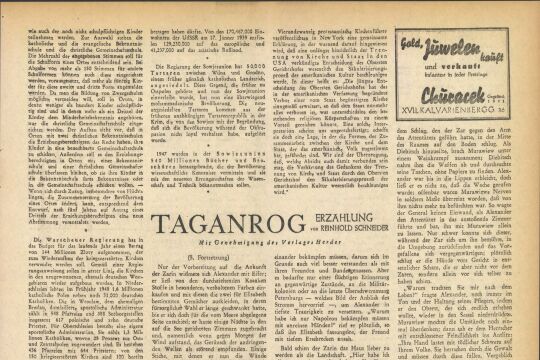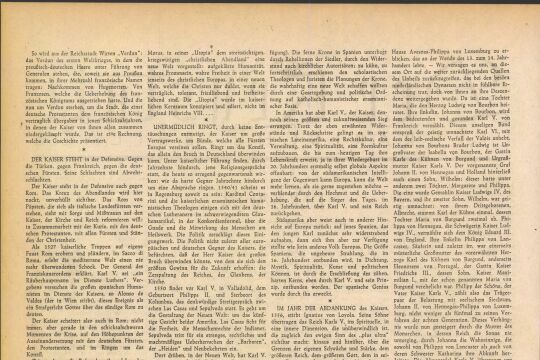AM 15. AUGUST 1853, der Krimkrieg lag keimhaft schon in der Luft, geschah in Ischl etwas, das, eigentlich als Staatsakt inszeniert, als echte Idylle endete. Kaiser Franz Joseph, der fünf erfolgreiche, freilich noch auf Schwarzenbergs Konto gehende Jahre hinter sich hatte, sollte sich verheiraten. Hinter dem Plane stand die Herrschernatur seiner Mutter, der Erzherzogin Sophie. Die Wahl war auf eine Prinzessin des eigenen Hauses gefallen, auf Helene, die älteste Tochter des Bayernherzogs Max und seiner Gemahlin Ludovika, Sophies Schwester. „Nene“ galt als nicht hübsch, fromm und unpünktlich. Der 23iährige Franz Joseph, ein anmutiger, schlanker junger Mann, hatte sich, der mütterlichen Entscheidung beugend, bereits abgefunden, als ihm der Zufall an jenem Augusttag die kaum 15jährige Kusine Elisabeth in den Weg führte. Die Entscheidung fiel blitzschnell: nur Elisabeth werde er heiraten oder niemanden sonst. Als sie gefragt wird, ob sie den Kaiser lieb habe, antwortet sie: „Ja, ich hab' den Kaiser schon lieb“, und setzt ahnungsvoll hinzu: „Wenn er nur kein Kaiser wäre!“ Am 24. April 1854 wechseln beide in der Augustinerkirche in Wien unter dem Donner der auf den Stadtwällen aufgestellten Kanonen und dem Geläut sämtlicher Glocken die Ringe.
ELISABETH WAR am Weihnachtsabend des Jahres '1937' zur Weif gekörnnien. Keine natürliche Neigung hatte die Eltern zusammengeführt, sondern elterlicher Wille. Die Ehegatten führten, obwohl kinderreich, jeder -ein Leben für sich. Herzog Max, der Vater, war einer jener charmanten Wildlinge, an denen die Wittelsbacher so reich sind. Er war Kavalleriegeneral, doch stach nur seine Reitkunst ins Auge, die ihn sagen ließ: '„Wenn wir net Prinzen warn, warn wir Kunstreiter geworden!“ Materiell unabhängig, konnte er allerhand Liebhabereien frönen, er präsidierte eine Tafelrunde „König Artus“, reiste und dichtete, spielte die Zither und galt als Original. Ludovika teilte mit ihm das Desinteressement an der Politik. Pädagogisch dürften beide kaum auf Elisabeth Einfluß gehabt haben, von Erziehung im Sinne von Tsewußter Einwirkung auf den Willen war keine Rede. Elisabeths poetische Kindheit am Starnberger See, wo sie wie eine Elfe die Wälder durchstreifte, hat in ihr einen unbeugsamen Freiheitsdrang entwickelt. Sie war völlig unverbildet. Mit den bernsteinbraunen Augen, dem schimmernden, prachtvollen Haar, dem frischen Teint und der kindlichen Unbefangenheit muß sie etwas von einer jungen Waldgöttin gehabt haben. Es ist seltsam: die unzähligen von Elisabeth erhaltenen Bilder können keine Vorstellung von dem Zauber ihrer Persönlichkeit vermitteln. Wer hätte auch das Je-ne-sais-quoi, das Unwägbare ihres Wesens festhalten können? Natürlich mußten die Akteure, die in immer wieder gemachten Anstrengungen dieses kaiserliche Paar auf den Filmstreifen zu bannen suchten, an solchen historischen Vorbildern scheitern.
ELISABETH VERZAUBERTE ALLE. Die Hochgeborenen und das einfache Volk. Marie von Wallersee, ihre Nichte, die Kronprinz Rudolf in seltsamer Haßliebe zugetan war und erst 1940 in einem Augsburger Greisenasyl starb, fand sie „wie eine Tochter der Sonne und des Feuers“, „zauberschön wie im Märchen“. „Sie hat etwas von einem Schwan, etwas von der Lilie, etwas von der Gazelle, zugleich aber auch von der Melusine“, schildert sie die vor Begeisterung fassungslose Gräfin Festetics. „Anbetungswürdig“ scheint sie dem, was Frauenschönheit anlangt, nicht unverwöhr ten Grafen Schuwaloff. Der Schah von Persien geht während seines Wien-Besuches ganz um die Kaiserin herum und ruft immer wieder aus: „Mon Dieu. qi'eile est belle!“ Den Hauptfehler, den man ihr vorwirft, den Mangel am Bewußtsein ihrer hohen Würde, an Herrscherstolz und -freude, Kaiserin zu sein, begreift sie nicht. Denn der ist in der ganzen Anlage, in der Sinnesart und im Charakter dieser Frau begründet, die auch so starke Eindrücke wie die des Wiener Hofes nicht zu ändern imstande waren. Etikette und herkömmliche Formen, Adelsstolz und Exklusivität sind ihr Begriffe, mit denen sie sich nie befreunden wird, weil sie viel zu frei und ungebunden erzogen ist. Dabei hat sie ein eigenes Gefühlsleben, das sie natürlich in der Hofluft, die ein Hort aller Aeußerlichkeiten ist, nicht zur Geltung bringen kann. Sie ist in ewigem Aufruhr gegen den Kastengeist ihrer Umgebung und die Parteirücksichten aller Art. So schreibt ihr Biograph Conte Corti.
In den ersten Jahren ihrer Ehe, in der sie ja erst allmählich zur Erwachsenen reift, hatte sich die Umgebung daran gewöhnt, in ihr ein halbes Kind zu sehen. Der 1858 geborene Sohn blieb daher der Großmutter überlassen, die eine echte Herrschernatur und so wenig Frau war, daß sie von dem schönen Frauenvorrecht, der Fürsprache um Gnade, zu der ihr das Jahr 1848 genug Gelegenheit gegeben hätte, nie Gebrauch machte. Aber als General Gondrecourt, e,in bärbeißiger Troupier, das Kind einem Ertüchtigungsprogramm unterwarf, zu dem eisige Wassergüsse und nachts neben dem Schlafenden abgefeuerte Pistolenschüsse gehörten, stellte die Kaiserin die ultimative Forderung: Entweder Gondrecourt oder ich. Von dem Tage an erkannte man, daß man nun eine 28jährige Frau vor sich habe.
OBGLEICH DIE GRENZEN UNGARNS bald hinter Wien begannen, wurde dieses Land als sehr fremdartig empfunden. Statt des kärglichbäuerlichen Lebenszuschnitts in Oesterreich schienen dort Selbstbewußtsein und Kraft zu herrschen — ein Land weiter Horizonte, feurigen Weins und starren Kalvinertums. Hier Nationalitätengezänk, dort ein von einem stolzen Adel geführtes Volk, dessen Kernspruch, sehr zu Unrecht natürlich, lautete: Es gibt in Ungarn nur eine Nation, die ungarische. Hinter der glänzenden Fassade fielen die Gebresten dieses Staatswesens nicht so sehr auf, aber die für Romantik empfängliche Kaiserin ist diesem Lande ganz verfallen. Die Liebe zu ihm hatte ihr schon während der Brautzeit Johann Mailath, ein in München lebender Ungar, als Lehrer geweckt. Sie umgibt sich mit Ungarn und sucht, Verächterin der österreichischen Aristokratie, die Freundschaft der madjarischen. Tatsächlich hat dieses Land ihr und dem Kronprinzen eine jahrzehntelange treue Erinnerung bewahrt. In jenem Sommer des Jahres 1866, da man nachts die Wachtfeuer der Preußen von Wien aus sehen konnte und die Kaiserin mit dem Sohn und den Kroninsignien ostwärts floh, hat sie, jung, schön und unglücklich, wie einst Maria Theresia, die ritterlichen Gefühle der Ungarn wachgerufen. Im Bahnhof von Pest stand Franz Deäk, „der Weise der Nation“, und der schmalhüftig-elegante Graf Julius Andrässy, Revolutionär von 1848, in effigie gehängt, aber seit Elisabeths Hochzeit amnestiert Sie standen hier, weil sie es, so erklärte es Deäk später, „als Feigheit empfunden haben würden, der Kaiserin im Unglück den Rücken zu kehren, nachdem wir ihr gehuldigt hatten, als es der Monarchie gut ging“- Und wenn später Andrässy vermerkte, Ungarn habe der „schönen Vorsehung, welche über ihm wache“, mehr zu danken, als es ahne, so trug die Vorsehung den Namen Elisabeth denn sie hatte beim Ausgleich von 1867 tatkräftig mitgewirkt. Seither ist sie mit Bewußtheit ungarische Königin.
NUN ERFASST SIE, nachdem ihre Kinder herangewachsen sind, sich verheiratet haben und Enkel kamen, ein fast pathologischer Wandertrieb. Sie ist immer loser an Wien gebunden. Raschen, federnden Schrittes sieht man ihre hohe, überschlanke Gestalt nun überall in Europa auftauchen: Dover, Gastein, Korfu, Marseille, Florenz, Lissabon. Immer wieder zieht es sie ins heimatliche Bayern und nach England, dem klassischen Land des Sports mit der uferlosen Weite der Reitterrains. Stunden der Melancholie wechseln mit plötzlich aufbrechender Lebensfreude. „Man muß sich, um mit dem Leben auszukommen, schließlich zu einer Insel machen“, sagt sie zum verwachsenen Griechen Christomanos, mit dem sie Neu- und Alt-, griechisch lernt. In der Monarchie vermerkt man mit steigender Unzufriedenheit, daß sie sich von den Pflichten als Kaiserin zurückgezogen hat. Nur einmal, als sie mit dem Kaiser Triest besucht und von Attentaten gesprochen wird, besteht sie darauf, mit dem Kaiser, der allein gehen will, zusammen ein Spital zu besuchen. „Es sind in Mama vielleicht die größten Widersprüche, die nur überhaupt in einem Charakter vereint sein können“, schreibt 1893 ihre Tochter, die Erzherzogin Valerie, in das Tagebuch. Die Kaiserin liebt ausgedehnte Spaziergänge, die man aber eher als Eilmärsche bezeichnen kann. Die Hofdamen sind jedesmal nahe am Zusammenbrechen. „Die pedestrische Leistungsfähigkeit Ihrer Majestät ist eine so bewunderungswürdige“, schreibt am 23. November 1891 in schönstem Kanzleideutsch der österreichische Vertreter in Kairo an den Grafen Kälnoky, „daß die Geheimpolizei es für unerträglich erklärte, der allerhöchsten Frau anders als im Wagen zu folgen.“ Als sie auf dem Segelkutter „Chazalie“ in einen Sturm gerät, läßt sie sich wie einst Odysseus am Mast festbinden und sieht, völlig durchnäßt, den tobenden Elementen zu. Zum 55. Geburtstag, den sie nicht in der Heimat verbringt, schreibt ihr Franz Joseph: „... Heute will ich meine innigsten Glückwünsche mit der schönen Bitte darbringen, daß Du auch in der vielleicht kurzen Zukunft, die uns noch bemessen ist, ebenso gut und lieb für mich seist, wie Du es in immer zunehmenderem Maße für mich warst. Aussprechen möchte ich es doch auch, da ich es nicht genug zu zeigen weiß, es Dich auch langweilen würde, wenn ich es immer zeigen würde, wie unbändig lieb ich Dich habe. Gott segne, beschütze Dich und gebe uns ein gemütliches Wiedersehen, mehr haben wir ja nicht* zu wünschen und zu hoffen...“ Der Brief ist, was nicht oft vorkommt, mit „Dein Kleiner“ unterzeichnet.
Den Sommer 1898 — Rudolf wäre 40 Jahre alt — verbringt die Kaiserin in der Schweiz. Sie logiert im Hotel „Beau Rivage“ in Genf, über dem der 10. September als strahlender Spätsommertag aufgeht. Als sie, begleitet nur von der Hofdame Gräfin Sztaray, das Schiff, das sie nach Caux bringen soll, besteigen will, springt sie am verlassenen Kai ein Mann an und stößt ihr mit größter Wucht eine Feile in die Brust. Alles geschieht so plötzlich, daß man erst nachher alles genau rekonstruieren kann. Die Kaiserin geht, ohne zu ahnen, wie es um sie steht, noch einige hundert Schritte bis zum Schiff, bricht aber an Bord tot zusammen, nachdem die Hofdame erst erklären mußte, wer die Dame sei. Der rasch verhaftete Attentäter, der sich lächelnd abführen läßt, rühmt sich der Tat und sagt, er sei „Individualanarchist“, von niemandem gedungen. Sein Name ist Luigi Luccheni, ein kräftiger, kraushaariger Mann. Sein Leben hat im Findelhaus Saint-Antoine in Paris begonnen, im Gefängnis Saint-Antoine in Genf soll es im Herbst 1910 durch eigene Hand enden. Am Tage aber der Untat beendet der nichtsahnende Kaiser in Schönbrunn einen Brief an die Kaiserin mit den Worten: „Isten veled szeretett angyalom“ — Gott befohlen, geliebter Engel. Er erreicht sie nicht mehr. Franz Joseph wird, jetzt 68 Jahre alt, also keineswegs ein Greis, nun zum „alten Kaiser“. Mit allmählich erblassendem Gesicht und bleichendem Haar, spartanisch in ewiger Aktenarbeit, bleibt er, ein Pflichtenmensch in der besonderen Prägung des Soldaten, durchdrungen von dem Gedanken: das zum Besten aller dienende Reich zu erhalten ...