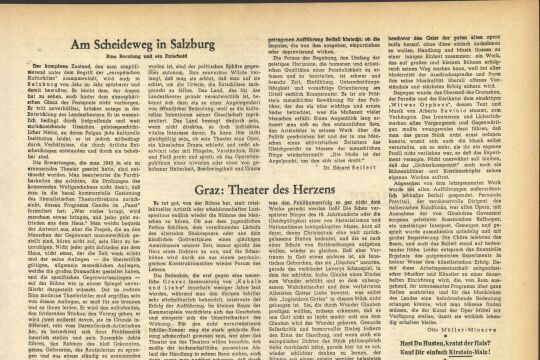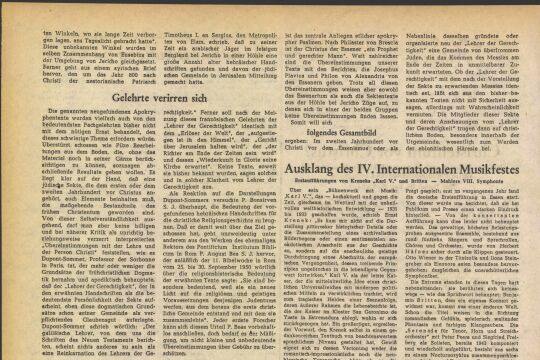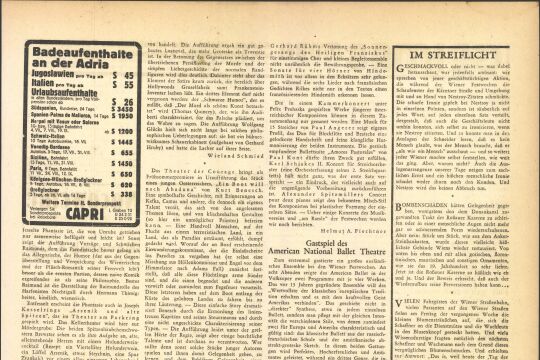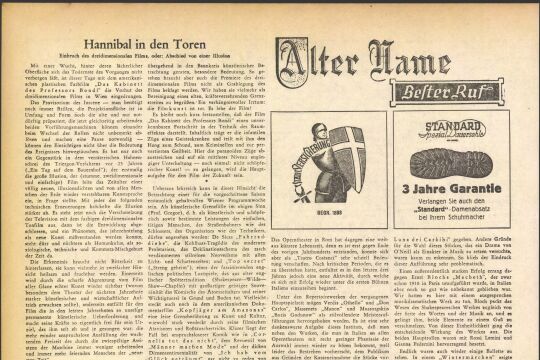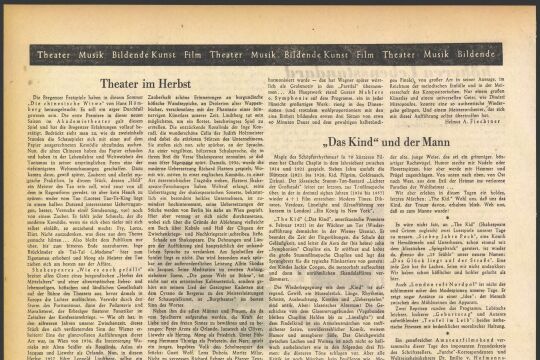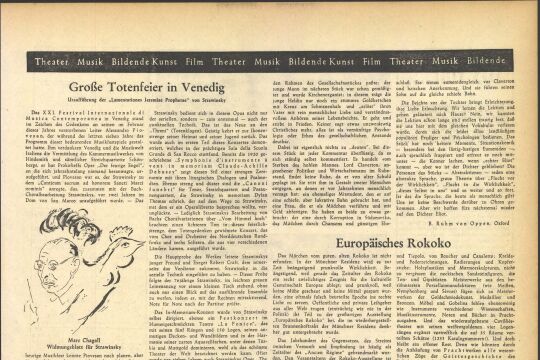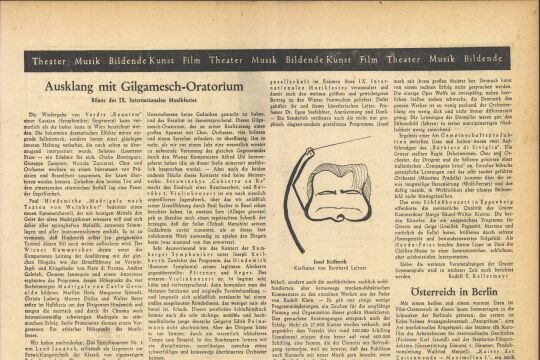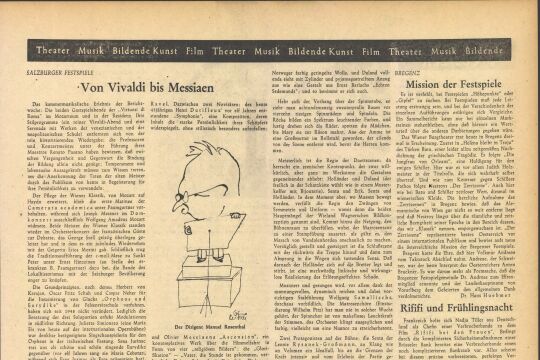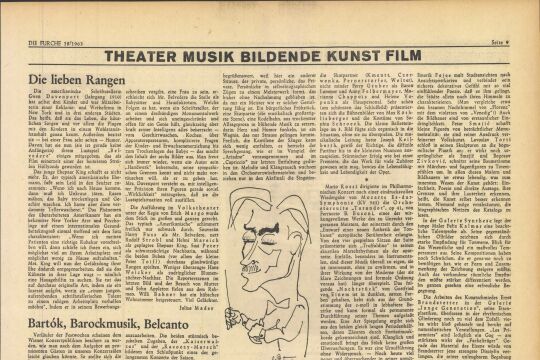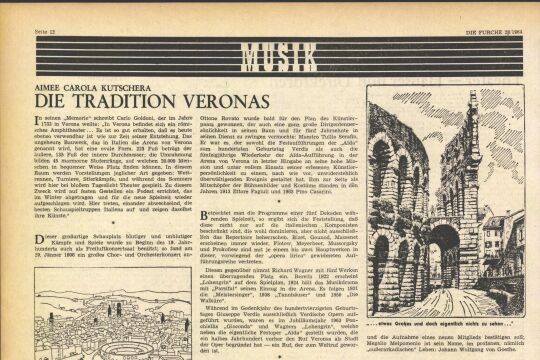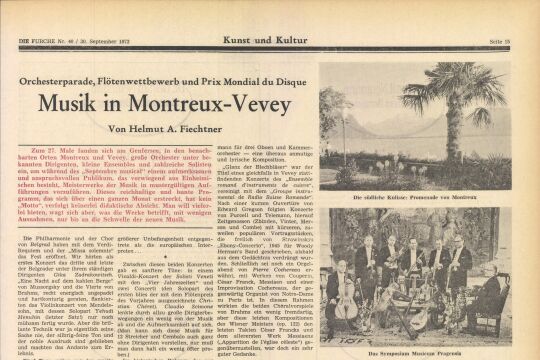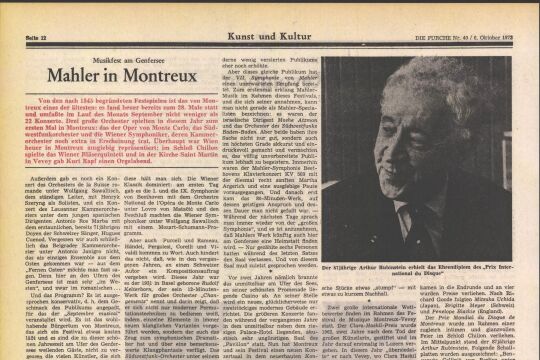Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kanäle für das Neue
Gleich zwei Festspiele hält Venedig für seine Besucher bereit: neben dem alljährlichen „Festival Internazionale di Musica Con-temporanea“ wirbt seit einiger Zeit auch das Musikkonservatorium „Benedetto Marcello“ um die Gunst der venezianischen Kunstliebhaber und ausländischen Touristen. „Vacanze Musicali“, „Musikalische Ferien“, nennt das Konservatorium den Zyklus von 48 Konzerten, den es — über fünf Wochen verteilt — zusammen mit der in der Großzügigkeit privaten Mäzenatentums einmaligen Stiftung „Giorgio Cini“ heuer veranstaltet hat. Ein Höhepunkt dieser Konzertreihe war das Auftreten des Wiener Kammerchors, der auch sonst ein gern gesehener Gast in Italien ist. Mit Hans Gillesberger führten die Wiener Sänger auf der Isola di San Giorgio Meister der venezianischen Schule auf, unter dem gerade 75 Jahre gewordenen Vittorio Gui sangen sie die Chorpartien in Monteverdis Marienvesper von 1610. Diese erklang freilich in der verdickenden und sentimentalisierenden Bearbeitung G. F. Ghedinis so, daß es die Lichtwunder Tin-torettos in der Scuola di San Rocco nichf schwer hatten, über die akustischen Eindrücke den Sieg davonzutragen.
Eine Rarität wie Robert Schumanns Oratorium „Das Paradies und die Peri“ würde man mit Recht auf dem Programm der „Vacanze Musicali“ vermuten. Doch nein: das zeitgenössische Musikfest der Biennale hat das Werk auf sein Programm gesetzt und zu seiner Aufführung Gäste von weit her geholt. Chor und Orchester des Westdeutschen Rundfunks, Köln, waren als Vermittler der deutschen Romantik ausersehen worden. Das ganz aufs Gefühl ausgerichtete Dirigententum Mario Rossis vermochte Musiker und Sänger an jene Quellen zu führen, aus denen diesem Schumann-schen Werk Schönheit und Wertbeständigkeit zufließen. Es ist der Ton lyrischer Innigkeit, der über alle Schwächen und Verlegenheiten der Komposition hinwegträgt.
Zwei Tage zuvor hatte sich das Kölner Orchester in seinem ureigensten Metier vorgestellt, mit einem modernen Programm. Spätestens nach dem Beifallssturm, der die Erstaufführung von Luigi N o n o s „C a n t o s o s p e s o“ quittierte, war es klar, daß die — schon legendäre — Fähigkeit der Kölner, heutige Musik zu spielen, ihnen die venezianische Einladung eingetragen hatte. Und das übrige Konzertrepertoire des Musikfestes bestätigte es, daß die Schumann-Aufführung nur eine willkommene „Draufgabe“ der deutschen Gäste gewesen ist. Denn ansonsten ist noch kein Musikfest der Biennale unserer Gegenwart sowenig untreu geworden wie dieses, das dreiundzwanzigste. Was Ängstlichkeit und Hochmut lange Jahre verhindert hatten, was sich im Vorjahr so überraschend wie kräftig ankündigte, das ist nunmehr vollzogene Tatsache: in Venedig ist der Durchbruch in die Moderne geglückt. Gewiß, noch immer wird dem Patron unter Italiens Musikern, Gian Francesco Malipiero, ausgiebig gehuldigt; aber schon dringt mit Luigi Nono, Ca-millo Togni, Nicolö Castiglioni und Aldo Dementi die Generation der „Enkel“ in ein Festspiel ein, das ihr bisher verwehrt war. Auch steht den zäh sich behauptenden Lokalgrößen nunmehr endlich in Goffredo Petrassi, Gino Contilli und Luigi Dalla-picccla das nötige Gegengewicht an internationalen Größen innerhalb der mittleren Komponistengeriera-tion Italiens gegenüber.
Von Gustav Mahler bis John Cage reichte diesmal der Bogen des venezianischen Festspiels; Stockhausen und Krenek, Matsudaira und Varese setzten die internationalen Akzente. Dennoch war die Atmosphäre Venedigs die ganzen Festspieltage hindurch noch voll Erwartung. Denn das Hauptereignis war dem letzten Veranstaltungstag vorbehalten. Sieben Minuten Musik waren Gegenstand von Sensation und Spannung der internationalen Fachwelt. Das Ereignis hieß: „Gesualdo Monumentum“. Es ist ein eigenartiges Ehrenmal, das sich Strawinsky zur Feier des 400. Geburtstages des Principe Gesualdo di Venosa ausgedacht hat: Er hat drei Stücke aus dessen 5. und 6. Madrigalbuch, geschrieben für fünf un-begleitete Singstimmen, in eine Instrumentalfassurag übertragen. Anders aber als bei seiner Pulcinella-Musik, die mit Pergolesis ehrwürdiger Perücke manchen Schabernack treibt, haben hier Ehrfurcht und musikhistorische Akribie Strawinskys Feder geführt. Ein sonderbares Beispiel für Strawinskys Spätstil, Fernstes und Gegensätzliches zur Einheit amal-gamierend, ist so entstanden.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!