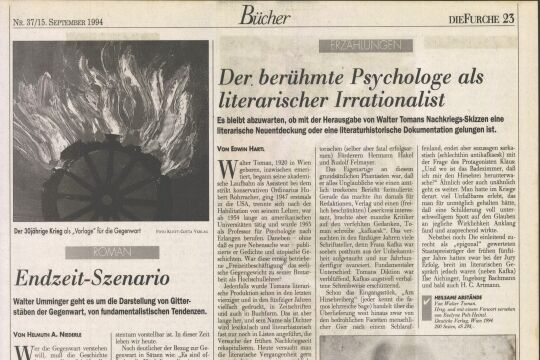Norddeutscher Dialekt, archaische Schreibweisen, historische und märchenhafte Einsprengsel, schnoddigre Vergleiche mit einer kleinen Dosis Pathos: so klingt Der unverwechselbare Sound der lyrik und Prosa von SaRah Kirsch.
Im Mai 1987 ist Sarah Kirsch mit einem „ORF-Auto“ unterwegs zu Lesungen. Von dieser „Alphabetisierungsreise“ berichtet ihr neues poetisches Journal „Krähengeschwätz“. Da stehen neben den „jungen Naturtalenten“ beim Vorarlberger Workshop die „argen Schlangen“ von Menschen in Mannheim, die „alle von den Socken“ waren „über das was ich las“, „herrliche alte Bäume“ auf dem Kamener Marktplatz werden gefällt, sie notiert ihr „flatternd Hertze“ beim Anblick des Rheins und den merkwürdigen Gleichklang der Kloster- und der Almkuhglocken. Kein Zweifel, das ist der „Sarah-Sound“, jenes für ihre Lyrik und Prosa so unverwechselbare Gemisch aus norddeutschem Dialekt, archaischen Schreibweisen, historischen und märchenhaften Einsprengseln, schnoddrigen Vergleichen mit einer kleinen Dosis Pathos.
Sarah Kirsch wurde als Ingrid Bernstein am 16. April 1935 in Limlingerode geboren, im Südharz. Mit dem Wahlnamen „Sarah“ protestiert sie gegen das große Unrecht, das den Juden in Deutschland angetan wurde. Nach dem Studium der Biologie, das sie 1959 mit dem Diplom abschloss, lernte sie das literarische Handwerk von 1963 bis 1965 in Leipzig, am damaligen Institut für Literatur „Johannes R. Becher“. Einer strengen Schule aber gehörte sie nie an. Seit 1968 in Ostberlin lebend, machte sie sich einen Namen durch unangepasste Gedichte und die frechen Geschlechtertauschgeschichten aus der „Pantherfrau“ (1974). Mit Kollegen veranstaltete sie in den 1970er Jahren grenzüberschreitende ostwestliche Schriftstellertreffen, auf denen Manuskripte gelesen und diskutiert wurden. Auch in ihrer eigenen Wohnung, in einem Hochhaus auf der Berliner Fischerinsel. Der Freund und Kollege Hans Joachim Schädlich berichtet, dass die Vorbereitungen der Treffen von der Stasi abgehört wurden.
„Und vielleicht noch weiter für immer“
Nicht aber das, was die Autoren lasen. „Der Inhalt der Beratungen konnte nicht aufgeklärt werden“, heißt es hilflos in den Stasi-Akten. Wie denn auch! In dem Gedicht „Trauriger Tag“ aus dem Jahr 1967 tigert die Dichterin durch die ummauerte Stadt, ganz buchstäblich „wie ein Tiger im Regen“, brüllt „am Alex den Regen scharf“ und setzt sich an der Spree, den Blick nach links, also nach Westen gerichtet, unter „ehrliche Möwen“. „Und wenn ich gewaltiger Tiger heule / Verstehn sie: ich meine es müßte hier / Noch andere Tiger geben“. Die gab es aber damals nicht. Die Staatssicherheit hat das in erschreckender Weise nicht verstanden. Sarah Kirsch war eine der Mutigsten. Einem Stasi-Agenten sagte sie ins Gesicht, wie schlecht er heute wieder getarnt sei. Und als es 1976 endlich zu einem Aufheulen der Gewaltigen des Wortes kam, als im Westen Reiner Kunzes „Wunderbare Jahre“ erschienen, Wolf Biermann ausgebürgert wurde und die Autoren, an erster Stelle Sarah Kirsch, dagegen bei der Staatsspitze der DDR protestierten, da antwortete der Staat seinerseits mit gewaltigen Drangsalierungen.
Sarah Kirsch sah keinen anderen Ausweg, als fortzuziehen „aus dem Haus der Stadt dem Land / Und vielleicht noch weiter für immer“. Am 28. August 1977, den soeben bewilligten Ausreiseantrag in der Tasche, verließ sie mit ihrem Sohn das Land, in dem sie nicht unverfolgt schreiben durfte. Der aus ihrer heutigen Sicht „gottlob! versunkenen deutschen demokratischen DDR“ weint sie keine Träne nach. Unter den Kritikern der „Ostalgiker“, die immer noch von einer DDR schwärmen, wie sie hätte gewesen sein können, aber in Wirklichkeit niemals war, ist sie eine der unerbittlichsten. Nach einem Intermezzo in Westberlin (1977–1983) ließ sich Kirsch in Tielenhemme in Schleswig-Holstein nieder. Mit vielen Katzen bewohnt sie dort ein altes Schulhaus, ihre „Farm“. Sie schreibt mit „Sepiatinte aus dem Tintenfass für altmodische Füller“ (und mit dem Laptop), malt Aquarelle, wandert durch Moorwiesen und Felder und beobachtet die sich im Wandel treu bleibende Natur.
„Ich nehme auf, was es alles gibt auf der Welt“
Doch Kirsch ist keine idyllische Missionarin der Naturbewahrung. Gedichte über eine heile Welt zu schreiben, würde heißen, sich und anderen Sand in die Augen zu streuen. Kirschs Dichtung gilt der desolaten Weltsituation im „Klugheitsjahrhundert“. Es geht um die „aussterbenden Bäume, Löcher im Himmelsgewölbe, die heillos werdende Luft und die vergifteten Wasser der Erde“. Das liest sich, geschrieben in den 1980er Jahren, wie eine Vorwegnahme der Klimakatastrophenberichte von heute. Kirsch sieht sich als klaglos-nüchterne Chronistin dieser „Endzeit“: „Ich nehme auf, was es alles gibt auf der Welt. Manches, wie die Bäume, kann man nur noch betrauern. Ich versuche, das alles ein wenig aufzuheben.“ Für Kirsch ist die Erde aber nicht nur ein untergangsgeweihter „Ascheplanet“ und „Krätzeplanet“, sondern auch ein erhaltenswerter „Abendstern“ und „Wandelstern“, der dem Menschen anvertraut ist, dem „Erdenkloß“. Kirsch übernimmt Luthers Übersetzung für den Namen des ersten Menschen ohne Religiosität. Aber sie erinnert daran („Adam“ steht im Hebräischen für „Erde“ und für „Mensch“), dass der Mensch seine geschöpfliche Verbindung mit dem Erdboden von sich aus nicht straflos aufkündigen kann. Wie Weiterleben angesichts der globalen Selbstgefährdung: Das ist Kirschs barock formulierte Frage: „kann denn die Wasserblas’, der leichte Mensch bestehn?“
Es ist eine politische Frage. Kirsch stellt den politischen Menschen, der für den Staat ebenso verantwortlich ist wie für seine Umwelt, ins Zentrum ihrer Dichtung. „Hätte ich keine politischen Interessen, könnte ich keinen Vers schreiben“, bekennt sie. Doch diese Interessen sind kein politischer Klartext, sondern poetische Aussage, bildhaft formuliert und auf Nachdenken, nicht aufs Nachbeten angelegt. Das literarische Ich ist die Instanz, die erschütterbar, aber widerständig die Eindrücke von Welt und Umwelt aufzeichnet. Eine chronologische „Chaostheorie“: So hat Kirsch ihre journalhafte Tagebuchprosa genannt. Die klare, manchmal besänftigende Sprache kann nicht den Schrecken von Bombenanschlägen, Flugzeugentführungen, Menschendeportationen und Reaktorunfällen vergessen machen. Davon handelt der jüngste Prosaband Kirschs, der nun zu ihrem 75. Geburtstag erschienen ist. Die Tagebuchnotate aus den Jahren 1985 bis 1987 formulieren politische Einsicht als poetische Erkenntnis. „Krähengeschwätz“ zeichnet im Sinne des antiken und christlichen Rabensymbols die guten wie die schlechten Zeichen der Natur auf, die menschliche Natur eingeschlossen. Im Wechsel der Jahres- und Ereigniszeiten bleibt die Dichterin wachsam. Sie pflanzt Rosen im Orkan und notiert (am 27. 11. 1987) den Stasi-Überfall auf die Umweltbibliothek in der Ostberliner Zionskirche, während die „Schriftversteller in der DDDR auf ihrem Kongress … quaken so viel sie noch wollen“. Kirschs Werke tun das ihre dafür, dass unser Geschichtsgedächtnis klaren Kopf behält.
Krähengeschwätz
Von Sarah Kirsch
Deutsche Verlags Anstalt 2010. 175 S., geb., e 18,50