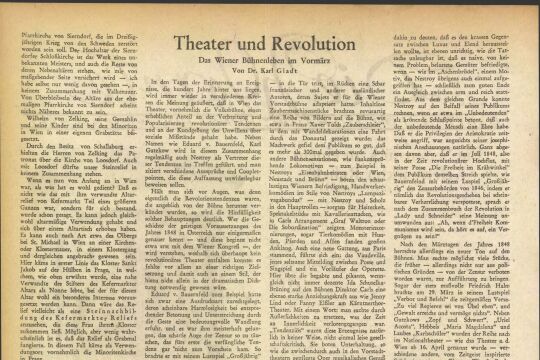Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Komödien des Lebens
Der Schriftsteller, der Dichter arbeitet mit dem Wort, es ist sein Material. Muß er sich nicht fragen, welche Funktion es hat, was es bewirkt? Bleibt das Wort, gedruckt, lediglich dem Papier verhaftet, verhallt es folgenlos im Theaterraum? Oder kommt es zu Weiterungen, ergibt sich Verantwortung? Diese Frage beschäftigte Arthur Schnitzler dreißig Jahre hindurch, von 1901 bis 1931, solange schrieb er an der Tragikomödie „Das Wort“, die er als unvollendet ansah, obwohl sie der Form nach abgeschlossen ist. Dennoch bedeutet die Uraufführung des von Friedrich Schreyvogl behutsam bearbeiteten Stücks im Theater in der Josefstadt einen Gewinn.
Der Schriftsteller, der Dichter arbeitet mit dem Wort, es ist sein Material. Muß er sich nicht fragen, welche Funktion es hat, was es bewirkt? Bleibt das Wort, gedruckt, lediglich dem Papier verhaftet, verhallt es folgenlos im Theaterraum? Oder kommt es zu Weiterungen, ergibt sich Verantwortung? Diese Frage beschäftigte Arthur Schnitzler dreißig Jahre hindurch, von 1901 bis 1931, solange schrieb er an der Tragikomödie „Das Wort“, die er als unvollendet ansah, obwohl sie der Form nach abgeschlossen ist. Dennoch bedeutet die Uraufführung des von Friedrich Schreyvogl behutsam bearbeiteten Stücks im Theater in der Josefstadt einen Gewinn.
Bekannte Wiener Persönlichkeiten aus dem ersten Viertel unseres Jahrhunderts boten die Anregung zu
den Gestalten: Vor allem Peter Altenberg, Urbild eines Dichters und Bohemiens, der Architekt Adolf Loos und seine umschwärmte Frau Lina, die eine bekannte Schauspielerin war, weiter Frieda Strindberg, die Schriftsteller Alfred Polgar und Stefan Grossmann. Ein großartiger, überaus wirksamer erster Akt führt in ein kleines Nachtcafė, wo Anastasius Treuenhof — alias Altenberg, von Literaten, Bewunderern und Straßenmädchen umgeben, im Zigaretten- und Weindunst geistvoll Cercle hält. Hier lernt der junge Maler Willi Langer die kokett schillernde Lisa van Zack kennen, die seine Geliebte wird, ihn aber nasführt, worauf er sich, einem verantwortungslos hingeworfenen Wort Treuenhofs folgend, ohne lang zu überlegen, erschießt.
Wenn erst die ganze Literatur dieser Zeit vergessen ist, schrieb Hermann Bahr, wird das unvergängliche Gedicht, das Peter Altenbergs Leben war, noch dankbaren Enkeln erglänzen. Anders Schnitzler, der zwar Altenberg als Dichter bewunderte, ihn aber wegen seiner Lebenshaltung verachtete. So entstand die Gestalt des Treuenhof, dieses Meisters des Worts, der, wegen Willis Tod zur Bede gestellt, erklärt: „Es waren doch schließlich nur Worte.“ Damit desavouiert ihn Schnitzler. Anderseits kam er von Altenberg doch nicht los, so ist es zu erklären, daß diese packende Gestalt im Gefüge der fünf Akte nicht zentral genug gestellt ist, woduch die banale Liebesgeschichte Willi-Lisa allzusehr debordiert. Hierin liegt die Schwäche des Stücks. Atmosphärisch dicht ersteht das Wien der Secessionszeit, der Kaffeehausliteraten, der schöngeistigen Salons. Die Bearbeitung? Schreyvogl strich klug, stellte eine Szene um, verlagerte berechtigt die Überspanntheit einer Gestalt auf eine andere, hierfür geeignetere.
Ernst Häusserman als Regisseur meidet es mit Recht, die Darsteller jenen Persönlichkeiten äußerlich anzugleichen, die Schnitzler für die Figurengestaltung anregten. Doch müßte man bei Leopold Rudolf die trunken-egomane Freude am Wort spüren, er bleibt aber ein dürr-trok- kener Patron. Auch begnügt sich Eva Kerbler als Lisa lediglich mit Kätzdhenhaftigkeit. Klaus Maria Brandauer ist ein glaubhafter Willi, Kurt Heintel gibt dem betrogenen Gatten Mannhaftigkeit Besetzung weiterer Rollen mit geschätzten Darstellern: Vilma Degischer, Hans Holt, Guido Wieland, Kurt Sowi- netz, Ernst Waldbrunn. Toni Hitz überzeugt als Berlinerin, die Wien studiert. Die Bühnenbilder von Lois Egg und die Kostüme von Monika
Zallinger werden der Zeit bestens gerecht und tragen sehr wesentlich zum Gesamteindruck der Aufführung bei.
Vor wenigen Wochen wurde in Graz das letzte noch ungespielte Stück von Ödön von Horvath uraufgeführt, eines seiner frühesten, die Komödie „Zur schönen Aussicht“. Nun ist sie im Wiener Ateliertheater zu sehen. Während aber Horvath später Menschen zeichnete, die weder Engel noch penetrante Schurken sind, mögen sie auch eine starke Schlagseite zu mancherlei Niedertracht besitzen, so führt er hier in einem völlig heruntergewirtschafteten Hotel
sechs ausschließlich Schwarz in Schwarz dargebotene Gestalten — fünf Männer, eine stets betrunkene, nymphomanische Baronin — vor, denen ein junges Mädchen, holdselig ahnungslos, gegenübersteht, das von dem Direktor des Hotels ein Kind erwartet. Um ihn von Vaterpflichten zu befreien, erklärt jeder der Männer, die Lautere sei seine Geliebte gewesen. Horvath war da noch so unbeholfen, eine Wendung dadurch herbeizuführen, daß dieses Mädchen durch eine Erbschaft plötzlich für alle als Gattin begehrenswert wird. Das Verhalten der Gutmütigen wirkt unglaubwürdig weltfremd, ja nur dumm. Der Reiz der späteren Stücke Horvaths besteht in der Mischung von Schwarz und Rosarot. Hier knallt er diese beiden Farben unvermischt nebeneinander und gelangt dadurch über primitive Theatermache nicht hinaus. Der Name Horvath garantiert nicht für jedes Stück. Mit Trude Marlen in der Rolle der stets Betrunkenen, mit sechs weiteren Darstellern bietet Peter M. Birkhofer als Regisseur eine Aufführung von mittlerer Qualität.
Das Volkstheater führt nach achtzehn Jahren wieder die Posse „Der Talisman“ auf, in der Nestroy bekanntlich zeigt, wie der Mensch durch ein geringfügiges Anderssein — rote Haare — zum Ausgestoßenen der Gesellschaft werden kann. Das gilt für Titus Feuerfuchs wie für die Gänsehüterin Salome Pockeri. Eine bittere Geschichte, die eine der unerfreulichen menschlichen Grundveranlagungen bloßstellt und heute weitreichende Assoziationen auslöst. Eben diese Bitternis arbeitet der Regisseur Gustav Manker durch unkonventionelle Besetzung der Hauptrollen besonders heraus. Helmut Qualtinger macht als Titus zwar durch sein voluminöses Äußeres weder den verhungerten Arbeitsuchenden noch den jungen Kerl glaubhaft, der auf Frauen wirkt, aber die Intensität und fast satanische Lust an Angriffen gegen
menschlichen Widersinn und schicksalhaft Unsinniges wird in eminentem Maß spürbar. Brigitte Swoboda ist ganz die getretene Kreatur, die durch ihr Ausgestoßensein zur Aggressivität neigt. Damit sind die Akzente dieser Aufführung ganz auf die essentielle Schärfe Nestroys gesetzt. Maxi Tschunko rückt demgemäß die Bühnenbilder von süßlich-konventionellem Biedermeier weg, beeindruckt aber zu wenig. Auch in den Kostümen wird das Vormärzliche gemieden, durch die Mode späterer Jahrzehnte ersetzt.
Im Theater in der Josefstadt gab es an vier Abenden ein Gastspiel des Tourneetheaters Basel mit der Komödie „Unter der Treppe“ von Charles Dyer, von dem man vor sechs Jahren das Dirnenstück „Laufkundschaft“ im Kleinen Theater der Josefstadt sah. In dem neuen Stück werden zwei alternde Männer vorgeführt, die seit zwanzig Jahren Zusammenleben und sich nun nicht mehr ausstehen können. Wegen Nichtigkeiten wird unentwegt gestritten, gekeift, gestichelt, aber sie kommen doch nicht voneinander los. Innere Einsamkeit turbuliert, Seelisches ist trefflich beobachtet. Derlei hat es im Boulevardtheater genügsam gegeben. Einziger Unterschied: Die „Ehe“ wird von zwei Männern geführt, Friseuren, die in einem schäbigen Laden hausen. Erotisches ist längst erloschen, es wird kaum davon gesprochen. Dyer stellt diese Beziehung als selbstverständlich dar, es begibt sich nichts anderes als zwischen gealterten Eheleuten, das ist das Neue und zugleich wohl der einzige Grund, weshalb das Stück gespielt wird. Es kann arg langweilig wirken, wie Aufführungen in Basel und Bern gezeigt haben. Doch in der Wiedergabe unter der Regie von Harry Meyen mit Will Quadflieg und Leonard Steckei ergibt sich Faszination vom Schauspielerischen her durch meisterhafte Durchzeichnung der Gestalten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!