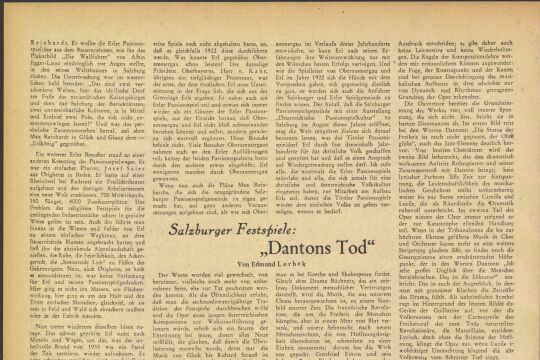Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kreneks „Goldener Bock”
Ernst Krenek belegt mk Spott, was er heimlich liebt. Er ist ein Mythensucher, aber er macht sich über die Mythen auch lustig. Er steht in Opposition zur herkömmlichen pathetischen Oper und übersteigert die Parodie, bis sie wieder umschlägt in Pathos. Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, weinte „mit ungeheurem Klagelaut” — Medea, die soeben einen Schiffsbauer zur Suppe verkocht, dessen liebreizende Tochter mit dem Giftgeruch eines Parfüms umgebracht und darauf ihre eigenen Kinder verzehrt hat, bricht in ein sardonisches Lachen aus. Immer noch wandelt Ernst Krenek auf antiken Pfaden, wie schon in den zwanziger Jahren mit „Orpheus und Eurydike”, mit dem „Leben des Orest”, und wie 1955 mit der in Hamburg uraufgeführten Oper „Pallas Athene weint”. Aber als er an das Libretto zu seinem jüngsten Werk, „Der goldene Bock”, eine Art Paraphrase über den Argonauten- und Medea-Motivkreis, heranging, packte ihn mephistophelische Spottlust: „Er sei”, schrieb er, „des trockenen Tons nun satt.”
Was er an dessen Stelle setzte, enthüllte sich bei der Hamburger Uraufführung als ein gleichsam surrealistisches Abenteuer, als ein freies Spiel mit Raum und Zeit, als eine provozierende Revue, halb Kabarett und Grand Guignol, halb Proklamation und Lehrstück. In dem selbstverfaßten Libretto schildert er — über Jahrtausende hinweg — die Schwierigkeiten einer Heldenlaufbahn. Der Begriff des Helden, personifiziert in Jason, wird in Frage gestellt. Jason gelangt, den fliegenden Widder Chrysomal- los verfolgend, an die Gestade Amerikas und trifft dort auf Medea, die als versteinertes Drachenmonstrum an der Highway von Touristen bestaunt wird. Seine Liebe verleiht ihr menschliche Gestalt, doch beides ist nicht von Dauer.
Barbarei scheint unausrottbar, Greuel häufen sich auf Greuel. Am Ende kehrt das Goldene Vlies — Ursprung allen Übels — von selber dorthin zurück, wo der goldene Widder entstand. Held Jason lebte und litt im Angesicht der Ewigkeit umsonst. Vor lauter Story entsteht keine Handlung. Es ist, als ob der Autor dem amerikanischen Glauben an die alleinseligmachende Tatsächlichkeit, über den er sich lustig macht, selber erlegen sei. Als Europäer in Amerika hat er mit dem Gastland ein Agreement geschlossen. Auch seine Oper ist ein solches Agreement, aber ärger noch: Sie ist textlich ein Ragout wie Medeas Metzel- tuppe.
Musikalisch beschritt Krenek, der noch in einem 1960 geschriebenen Orchesterwerk — „Quaestio Temporis” — ein penibles Auszählverfahren bewußt auf die Spitze getrieben hat, den Weg zu einer neuen Freiheit. Ein wenig sensationell klingt seine Mitteilung, daß er — bei dem Sprung über Zeit und Raum — exakte Berechnungen zu dem Zweck angewandt habe, den Eindruck des Chaotischen zu erzeugen. Das Zufällige, nicht mehr Determinierte, ist verdeutlicht als das Ergebnis totaler Determination. Kontrapunktische Varianten verweisen auf die Relativität von „Zeit”, ironisch wirkende Koloraturen des Wolkenwesens Nephele, auf luzidem, fast romantischem Instrumentalgrund, stellen die serielle Textur in Frage. Der immer durchsichtige, überwiegend solistisch gehaltene, gelegentlich trockene und doch recht abwechslungsreiche Orchestersatz ist mit elektronischen Klangsequenzen — zur Illustration der Wunder — angereichert. Kreneks Komposition enthüllt sich, wie so viele musikalische Werke der jüngsten Zeit, als ein Zeugnis gefrorener Romantik. Ein gleisnerisches „Salome”-Motiv, das sich ein-, zweimal aus dem Klanggrund hervorwagt, ist gewiß nicht zufällig in die Partitur geraten. Mit dem Gestus des perfekten Souveräns, dem auch die ausgefallensten Wendungen der Terminologie jederzeit präsent sind, ist Ernst Krenek tatsächlich ein anderer Richard Strauss — auf der Ebene des Seriellen, der musiksprachlichen Konventionen in der Nachfolge Schönbergs und Weberns.
Die handwerklich perfekte Inszenierung von Egon Monk verhielt sich den Brüchen des Werkes gegenüber unentschieden. Musikalisch ist die Aufführung — unter der Leitung des Komponisten — exzellent. Helga Pilarczyk als Medea, Tom Krause als Jason, Helmut Melchert und Ilse Hollweg — Träger der umfangreichsten und schwierigsten Partien — vollbringen Leistungen, wie sie Gängern nur selten abverlangt werden. Der Weg des zeitgenössischen Musiktheaters ist dornenvoll. Das kam auch an der Reaktion des Publikums zum Ausdruck. Nahezu zorniger Widerspruch und stürmische Zustimmung waren bis zur völligen Unklarheit vermengt. — Die Uraufführung war der Auftakt einer imponierenden, 16 Tage währenden Präsentation zeitgenössischen Musiktheaters an der Hamburgischen Staatsoper.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!