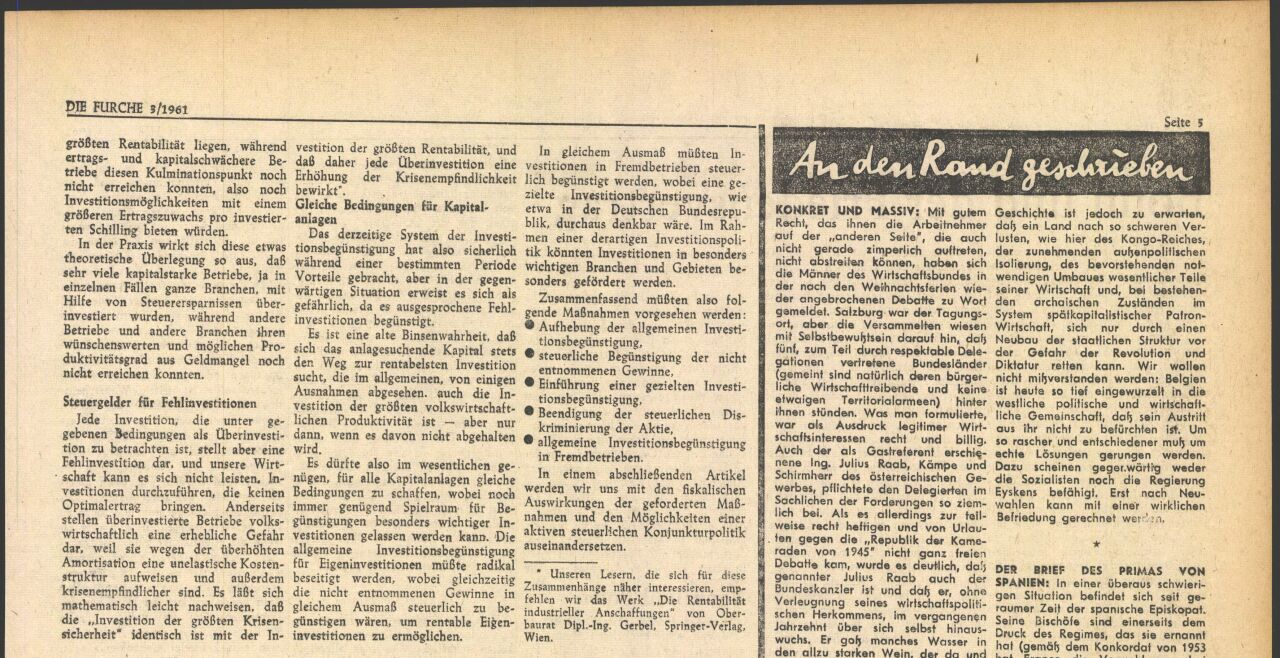
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Das süße Leben ohne Arbeit
In der „Furche“, Folge 52 53, 1960, i wurde festgestellt, wie Anhänger heute gewonnen werden: „ … durch Zugeständnisse — auf dem Lohnsektor, ! auf dem Arbeitsunlustsektor.“
Ja, sely richtig, durch Predigen, wie schön doch das Leben ohne Arbeit ist, : und daß man die Arbeit möglichst schnell, möglichst, ohne sich zu „echauffieren“, aber möglichst lukra- . tiv hinter sich bringen muß.
Blicken wir nur um uns; alles ist ; darnach ausgerichtet, daß das eigentliche Leben das Leben nach der Arbeit ist, die Freizeit, der Urlaub, der private Mensch und Bereich; und daß die, die arbeiten, das eben müssen, daß sie die Dummen dabei sind, daß sie es eben nicht besser verstehen oder — was das Schlimmste ist — daß sie sogar mit „tierischem Ernst” arbeiten: unmögliche Menschen, die an der Arbeit eine Freude haben. Ja, wenn sie’s wenigstens für sich allein täten, aber meist wollen sie noch andere dazu nötigen, auch zu arbeiten, interessiert, intensiv zu arbeiten; diese Terroristen sind Menschen, denen jeder Charme abgeht, also „Unmenschen".
Alltag und Jahr sind erfüllt von allem möglichen Getue, nur nicht von der Rede davon, daß die Arbeit ein Beitrag ist. eine Leistung an das Leben des einzelnen wie der Gemeinschaft, daß Arbeit adelt, daß Arbeit erhebt, erfüllen kann.
Arbeit und Freizeit Daß die Arbeitszeit von 48 Stunden auf immer weniger herabsinkt, ist grundsätzlich zu begrüßen, eingedenk jener grauverhangenen Zeit, da sie 60 Stunden und mehr betrug. Wobei freilich nicht immer sicher ist, daß damals alle wirklich unglücklich und heute alle um so glücklicher sind, was «uszusprechen freilich schon eine Binsenweisheit ist. Aber nun wird Vernunft Unsinn und Wohltat Plage, wenn die Freizeit immer länger wird, ohne Behagen dabei, und die Arbeit restlos ein Muß. eine Fron, Knechtschaft. Dabei leugnet kein Einsichtiger, daß acht Stunden Arbeit am eintönigen Fließband, auch selbst vor eintönigen Aktenbergen wirklich entnervend sein müsse. Wirkt diese Arbeit aber weniger entnervend, wenn man sie noch dazu in höchster Unlust, als Qual, vorgesetzt bekommt? Wer kennt nicht den Zustand, daß das Unangenehmste dadurch mit einem Male eher bewältigbar geworden ist, weil man es eben anpackte, sich ihm stellte, es, „so gut es ging", bewältigte, und dann auf einmal aus dem „Baraberer“ wirklich „der Held der Arbeit’ geworden ist, dem die goldene Freizeit dann deswegen golden ist, weil sie nun wirklich Lohn nach Leistung wurde und nicht „Zwischenzeit“ in dem nur als unerträglich empfundenen Arbeitstrott?
Früher einmal galt es als selbstverständlich, ohne deswegen von Arbeitswut befallen sein zu müssen, Arbeiten, die einem gestellt wurden oder denen
man sich gestellt, so gut, so genau, so pünktlich durchzuführen, nicht zu „erledigen" — das tut man mit allem heute! Selbstverständlich war jeder froh, wenn die Arbeit getan war. Aber er war erst froh, wenn sie eben recht getan, und war nicht froh, wenn sie halb getan war. Heute ist das anders: Wer getraut sich denn noch, einem Mitarbeiter eine Arbeit abzuverlangen, wenn einmal die Arbeitsschlußglocke geschlagen hat, wenn Gefahr besteht, daß der Mitarbeiter nervös auf die Uhr schaut, wenn tatsächlich schon etwa die anderen vor den Toren der Arbeitsstätte freizeitlich herumflanie- ren, wenn schon die Kinos, die Sportplätze, die Bäder locken, die Motoren dröhnen, wenn schon die freizeitliche Unruhe „Entspannung von der Last der Arbeit" laut und übermächtig verspricht. Wer getraut sich das? Welcher Chef ist solch ein Schaf, daß er die berechtigten Freizeitwünsche des Mitarbeiters nicht spürt; ist solch ein Ausbeuter, daß er die Freizeit des Mitarbeiters nicht respektiert; entwickelt so eine unmöglich tierische Arbeitswut, daß er nicht doch kapitulierte — und entweder auch auf Freizeit geht oder in tierischem Ernst
(oder etwa gar „erfüllt“ von seiner Arbeit?) nacharbeitet — oder es laufen läßt? Man schaue nur herum, w i e es läuft. Solange Konjunktur ist, mag man durch immer Neues das Verwahrlosende übersehen; was aber ohne Arbeitsmoral, wenn keine Konjunktur sein sollte?
Schule und Ferien
Schüler und Studenten haben zu allen Zeiten nicht unbedingt mit größtem Einsatz ihre Lernkraft, ihr Pensum zu erledigen getrachtet. Bisher aber war es doch so gewesen, daß der bessere und eifrigere Schüler, wenn er bloß nicht ein Strebertyp war, doch irgendwie, wenn schon nicht Vorbild, so doch Bild war, anerkanntes Bild. Heute ist das abgeschrieben. Ein Lehrer, der apostrophiert, daß ein guter, erfolgreicher Schüler zu sein doch ein Ziel ist, daß, auch wenn es nicht auf „gute Noten“ ankommt, die gute Note doch immerhin zumindest soviel wert ist wie eine „gute Zeit“ in irgendeinem Rennen — der Lehrer wird nicht allzuviel Erfolg für sich buchen können. Oder nur der echte Lehrer, der gegen alle Zeitströmung, gegen all das, was als Ungeist auf die Jugend einstürmt, Kraft und Idee genug hat, die auch heute unvermindert begeisterungsfähigen jun-
gen Leute für „geistige Erfolge’ zu begeistern.
Eigentlich erschreckend, wenn er dabei etwa daran erinnern muß, daß in den Oststaaten das Studieren und Lernen großgeschrieben und als Verdienstvolles angesehen bzw. mit zahlreichen Stipendien prämiiert wird. Erfolgreich Lehrer im heutigen Stil kann der eher sein, der das „Schülermaterial“ daran erinnert, daß man mit besseren Kenntnissen bessere Berufsaussichten hat, zu mehr Schillingen und Lebensstandard kommt, zu besseren Aussichten im „Konkurrenzkampf“. Und wer wundert sich dann, wenn eine Jugend, die so nüchtern angesprochen wird, sich von den Hallen des Geistes zu den Traumpalästen der Kinos und Tanzlokale abwendet?
Früher einmal gab es zu den Weihnachtstagen etwa eine Woche Schulferien. Heute sind aus den Weihnachtsferien die Winter- und Skiurlaubsferien geworden. Die können gar nicht lange genug sein, und es gehört zum guten Ton der besseren Gesellschaft und derer, die das auch nötig haben, daß man „wegfährt“. Der letzte Posten wankt
Nur noch ein letztes, besonders gefährliches, weil noch dazu zwielichtiges Beispiel: Nach 17 Uhr oder an Samstagen schon vormittags; die Autokolonnen, die freizeitlich Gewandeten fahren oder stapfen vorbei an noch mit Bergen von Erntegut sich abmühenden Landarbeitern: „Ach, laßt das, andere erzeugen den Weizen ja doch billiger.“ — Und die jungen Landwirte: „Wieso ist es, daß die da herumflanieren und wir ,barabern’ müssen?“ Und nun, statt daß der Vater alles mögliche sagt vom Rhythmus bäuerlicher Arbeit, vom Sinn bäuerlicher Arbeit, vom Lebensstandard, eigener Herr zu sein auf eigenem „Heimatl“, wettert er nur los auf die „Städter“, für die der Bauer schuften muß, bringt die in der nachwachsenden Bauerngeneration oft schon sehr labil gewordene Berufsfreude vollkommen zum Zusammenbrechen und unterstreicht die Arbeitsunlust der anderen: Arbeit eine Qual, Arbeit als Bauer doppelte Qual.
Vielleicht ist da einiges zu scharf gezeichnet. Es gibt eine Menge Menschen, auch junge Leute, um uns, die nach wie vor schwitzen und sich mühen. Aber die Schicht der „Mannequins“, die auf den Schultern dieser ein arbeitsloses Leben vorgaukelt, die wildgewordene Freizeitkultur und Freizeitpropaganda, wird immer größer. Nachdem in Generationen der Mensch vom Zwang zu fast rechtloser Arbeit befreit wurde und Arbeiter sein aus einem geringschätzenden Wort zu einer wohlanerkannten Standesbezeichnung geworden ist, wird es gut sein, daß wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten, und Arbeit als das erkennen, was sie ist: nicht wohlfeile oder teure Ware, sondern auch ein und wahrscheinlich sogar ein sehr besonderer Lebensinhalt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!









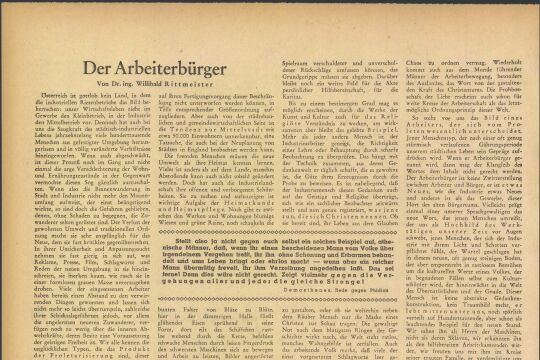



















































































.png)






