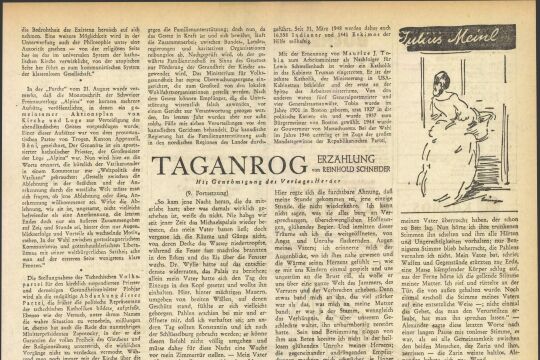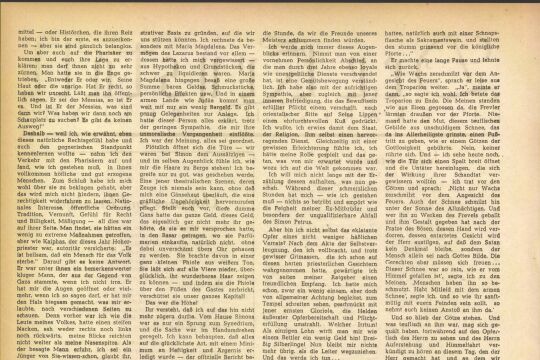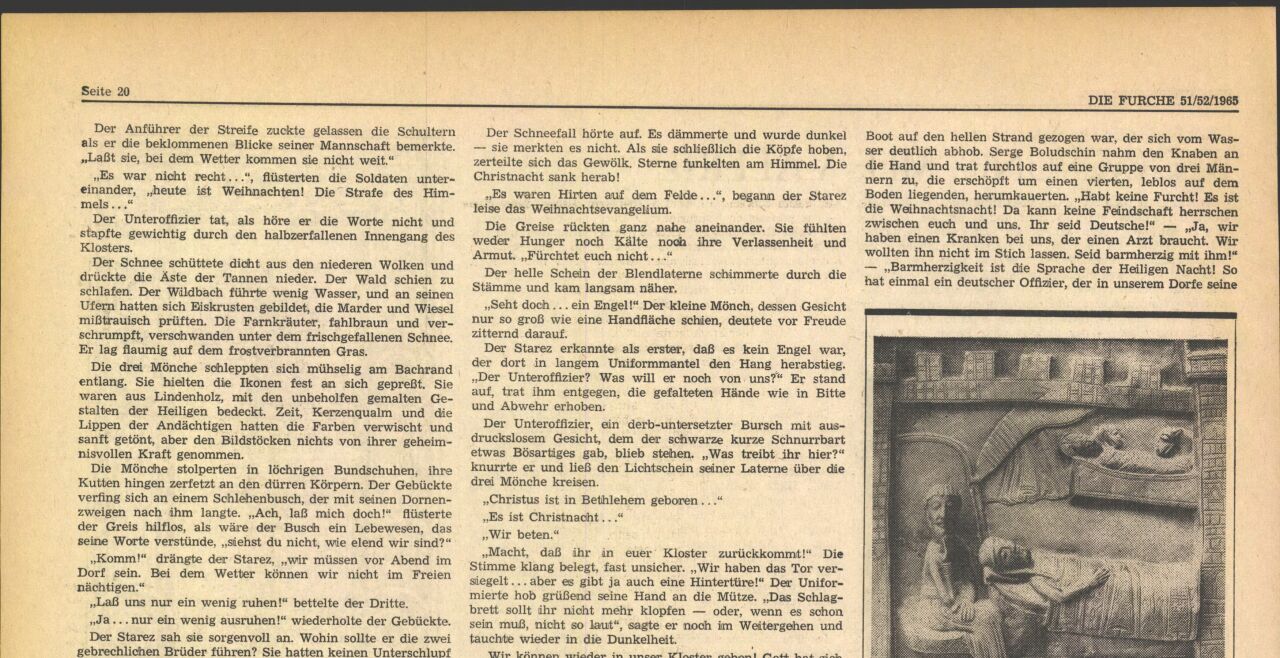
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
LICHT IN DER WEIHNACHTSNACHT
Dieses wird erzählt aus der schlimmen Zeit des Dezember 1944, als die deutschen Armeen in die Heimat zurückströmten und das Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen, nicht aber der Friede nahe war.
Das wilde Bergland Dalmatiens befand sich in der Hand von Titos Partisanen, die zur regulären Armee geworden waren. Das Schicksal unzählbarer deutscher Soldaten versank in die Nacht der Ungewißheit und des Vergessens. Ganze Truppenteile blieben wie vom Erdboden verschluckt. Man hat nie wieder etwas von ihnen erfahren.
Das Land, von den Touristen aus aller Welt in friedlichen Zeiten wegen seiner Schönheit und seines milden Klimas gepriesen, wußte nichts mehr von seiner eigentlichen Bestimmung, die Menschen glücklich zu machen. Die Furie des Krieges war darüber hinweggerast und hatte die Leidenschaften hüben und drüben zur dunkelsten Dämonie hinabsinken lassen. Nun schwieg hier der Lärm der Waffen. Die Hirten und Bauern waren in ihre stillen Bergdörfer und in die Täler zurückgekehrt, während weiter im Norden und Westen der erbitterte Endkampf des Krieges tobte.
Man schrieb den 24. Dezember. Auch in die Dörfer des nördlichen Dalmatien wollte der Friede der Weihnachtsnacht einkehren. Die Glocken der kleinen Kirchen riefen die Gläubigen zum Gebet.
Da zeigte sich in der Ferne vom offenen Meere her ein schwankendes Licht, das sich langsam dem Lande näherte. Serge Boludschin, der noch in seinem Fischerboot gesessen hatte, wie er das seit Jahren Abend um Abend tat, seit er nicht mehr selbst hinausfahren konnte, weil ihm durch eine verirrte Granate in den ersten Kriegstagen ein Arm und ein Bein weggerissen worden waren, bemerkte es zuerst. Er rief seinen kleinen Enkelsohn Dimdtri herbei, den man bei dem Alten gelassen hatte, damit er während der Weihnachts-naoht nicht ganz allein bliebe. Die anderen Bewohner des kleinen Fischerdorfes waren die weite Strecke zur nächsten Stadt gepilgert, um an der Mitternachtsmette, die dort zelebriert werden sollte, teilzunehmen. Seit Jahren hatten sie nicht mehr alle gemeinsam die Wedhnachtsmette besuchen können, weil die Männer als Partisanen in die Berge gegangen waren und die Frauen und Kinder den weiten Weg in den unsicheren Zeiten allein nicht wagen durften.
„Dimitri“, sagte der Alte und wies dem Enkel das Licht, „setze dich zu mir! Ich will dir etwas erzählen!“ Der Knabe gehorchte und setzte sich eng neben den Großvater. Das Fischerboot dümpelte auf dem ruhigen Wasser des kleinen Hafens, den die Natur einst eindrucksvoller, als Menschen es vermochten, in die Bucht am Rande des Inselbogens hineingearbeitet hatte. Man blickte von hier aus auf das Meer hinaus und ahnte irgendwo in der Ferne die Küste Italiens. Aber man saß selbst im Schutze des Landes, eng angeschmiegt an die Mauer des Kalkgebirges, das sich drohend und geheimnisvoll darüber auftürmte. Dieses Land war ebenso schön wie karg, und die Menschen wußten um beides: um seine Schönheit, die sie liebten, wie um seine Armut, die sie ertragen mußten. Aber sie träumten davon, daß sie bald wieder ungestört hinausfahren könnten auf ihr Meer und die Minen als letztes böses Zeichen des unseligen Krieges geräumt sein würden. Der Knabe schaute den Alten an. Hatte er vergessen, daß er ihm etwas zu erzählen versprochen hatte? Nein, er war ganz damit beschäftigt, auf das Meer hinauszublicken. „Das Licht kommt näher“, sagte der Großvater endlich, „es meint uns!“ — „Wie soll ich das verstehen? Es meint uns?“ — „Es ruft uns! Warte ab, was ich dir erzählen werde. Da ist schon einmal in einer Weihnachts-naoht ein Boot zu uns gekommen. Das war im gleichen Jahr, als ich Arm und Bein verloren hatte. Drei Jahre sind seitdem vergangen, aber ich weiß es noch genau. Das Boot zeigte sein Licht erst viel später als dieses. Und das mag seinen guten Grund haben. Damals war unser Dorf von den Deutschen besetzt. Die Leute dm Boot kannten die Küste. Sie wußten, wo sie an Land gehen mußten. Aber sie zeigten ein Licht, weil sie einen Todkranken an Bord hatten, ja, damals in der Weihnachtsnacht war das. Im Boot saßen Partisanen aus den Bergen. Dein Vater war mit dabei.
Dimitri, damals lebte er noch. Er war es, der das Boot steuerte. Aber am Strand lagen die Deutschen im Hinterhalt und nahmen alle gefangen, auch den Todkranken. Sie schleppten sie in die Kommandantur. Aber dann geschah das Wunder! Horche darauf! Das Wunder, habe ich gesagt. Der deutsche Offizier sagte: In der Wedhnachtsnacht beugen wir uns alle vor dem WUlen eines Größeren, Freund und Feind. Barmherzigkeit ist die Sprache der Hedligen Nacht. Die Gefangenen sind frei! Pflegt den Kranken, gebt ihm Medikamente und laßt die Flüchtlinge nach dem Fest in Frieden ziehn! Was der deutsche Offizier damals befahl, geschah auch. Der Vater kam zu uns ins Haus und hat uns selbst davon berichtet. Der Todkranke genas wieder und kehrte später in die Berge zurück, genau wie dein Vater und die anderen. Da galt nicht mehr das Gesetz der Barmherzigkeit, der Krieg hatte es ganz verstoßen. Sieh mal, Dimitri, seitdem sitze ich in der Weihnachtsnacht hier und warte. Vielleicht, daß wir einmal Barmherzigkeit mit Barmherzigkeit vergelten dürfen.“ — „Aber wenn das nun Deutsche sind, die da kommen?“ fragte der Enkel. „Eben daran dachte ich“, erwiderte der Großvater, und ein seltsames Leuchten trat in seine Augen, „es ist ja wieder Wedhnachtsnacht!“
Und dann warteten die beiden in ihrem Boot. Die Stunde der Mitternacht war gekommen. Kein Stern zeigte sich am
Himmel, der von unruhigen Wolken bedeckt war und nichts vom Frieden der Weihnacht zu wissen schien. Das Licht kam näher, aber es wurde immer schwächer. Da aber mußte das Boot schon ganz nahe sedn. Der Alte horchte. Dann nickte er plötzlich langsam und befriedigt, rief seinem Enkel „Komm“! zu und erhob sich unverzüglich. Mit fast nachtwandlerischer Sicherheit erreichten sie die Stelle, wo das
Boot auf den hellen Strand gezogen war, der sich vom Wasser deutlich abhob. Serge Boludschin nahm den Knaben an die Hand und trat furchtlos auf edne Gruppe von drei Männern zu, die erschöpft um einen vierten, leblos auf dem Boden liegenden, herumkauerten. „Habt keine Furcht! Es ist die Wedhnachtsnacht! Da kann keine Feindschaft herrschen zwischen euch und uns. Ihr seid Deutsche!“ — „Ja, wir haben einen Kranken bei uns, der einen Arzt braucht. Wir wollten ihn nicht im Stich lassen. Seid barmherzig mit ihm!“ — „Barmherzigkeit ist die Sprache der Heiligen Nacht! So hat einmal ein deutscher Offizier, der in unserem Dorfe seine
Kommandantur hatte, gesagt, als Leute von uns so in Not waren in einer Weihnachtsnacht wie ihr jetzt Ich frage euch nicht, wer ihr seid und woher ihr kommt Habt also keine Furcht! Kommt mit! Bringt euren Kranken zu mir in die Hütte! Es wird für euch gesorgt werden. In diesem Dorf wird euch kein Leid geschehen!“
Die Flüchtlinge, die seit Wochen mit einem erbeuteten Fischerboot an der Küste Dalmatiens unterwegs waren und schon seit Tagen kaum etwas zu essen gehabt hatten, seitdem ihnen nach einer Schießerei ihr kleines Beiboot mit dem Proviant verlorengegangen und ihr Kamerad schwer verwundet worden war, vertrauten sich dem Alten an, der langsam vor ihnen her schritt und sie in seine Hütte nahe dem Strande führte.
Sie bereiteten dem Wunden ein Lager, der Alte braute aus Kräutern einen Absud zusammen, mit dem er Tücher tränkte und sie dem stöhnenden, hochfiebernden Deutschen umlegte. Die Notverbände nahm er ab und warf sie ins Feuer. All seine Bewegungen strahlten Ruhe und eine fast priesterliche Feierlichkeit aus. Der Enkel saß währenddes stumm am Feuer und starrte die Fremden an. Nach der Versorgung des Wunden, dem der Großvater auch noch edne stärkende Suppe eingeflößt hatte, bot er den hungrigen Männern Brot und Milch, Käse und Fleisch und hieß sie, sich zu stärken. Dann stellte er eine neue Kerze hinter das Muttergottesbild und neigte sich mit seinem Enkel lange im Gebet, während die Landfremden still verharrten. Der Schlaf trat an das Lager des Verwundeten, linderte seine Schmerzen, dämpfte die Fieberphantasien und bannte auch den dunklen Engel noch einmal wieder, der ihn seit Tagen getreulich begleitet hatte.
Am frühen Morgen kehrten die übrigen Bewohner der Hütte leise heim. Draußen hörte man unterdrückte Rufe, Schritte, Türen schlugen zu. Dann herrschte wieder Stille. Serge sprach unterdrückt mit seinen Leuten und wies auf die Fremden, die eng aneinandergelehnt in der Nähe des Ofens hockten. Dabei machte er hin und wieder eine beruhigende Gebärde zu ihnen hinüber. Der Enkel und ein junges Mädchen verließen die Hütte. Bald kam Stimmengewirr auf, eine deutlich wahrnehmbare Welle der Unruhe breitete sich ringsum aus. Leise wurde die Tür geöffnet. Der Dorfälteste erschien, hinter ihm andere Bewohner des Dorfes. „Serge Boludschin hat die Wahrheit gesprochen. Seid ohne Furcht. Wer ihr auch seid, der Friede der Weihnachts-nachit schützt euch. Wir werden euren Kranken gesund pflegen. Dann sollt ihr sicher in eure Hedmat zurückkehren. Das soll wahr sein, soweit wir es vermögen!“ Der Dorfälteste sagte das auf serbisch, das einer der Soldaten, die hier Zuflucht gefunden hatten, verstand und seinen Kameraden dolmetschte. Der Älteste unter den Deutschen erhob sich und griff in seine Tasche. Langsam zog er seine Armeepistole heraus und legte sie auf den Tisch. Die anderen folgten seinem Beispiel. „Damit Friede unter uns herrsche und weil wir euch vertrauen!“ sagte er dazu. Den Ältesten, der Wedb und Kinder in der fernen Heimat wußte, übermannte es plötzlich. Er senkte den Kopf und sang leise das Lied von der „Stillen Nacht“. Seine Kameraden fielen ein. Sie sangen das Lied zu Ende mit einer Innigkeit, wie sie es , nie gesungen hatten, und spürten den Frieden in sich aufsteigen, von dem es kündet. i
Als sie aufblickten, sahen sie, daß die Menschen in der Hütte und die davor, die schweigend verharrten, ebenfalls die Köpfe gesenkt hielten.
Dieses geschah in der Wedhnachtsnacht 1944 in einem kleinen Fischerdorf Dalmatiens — und mehr ist darüber nicht zu sagen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!