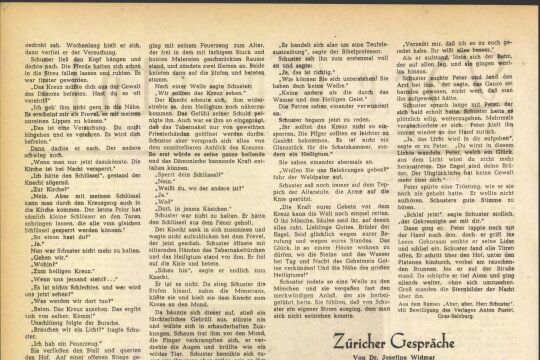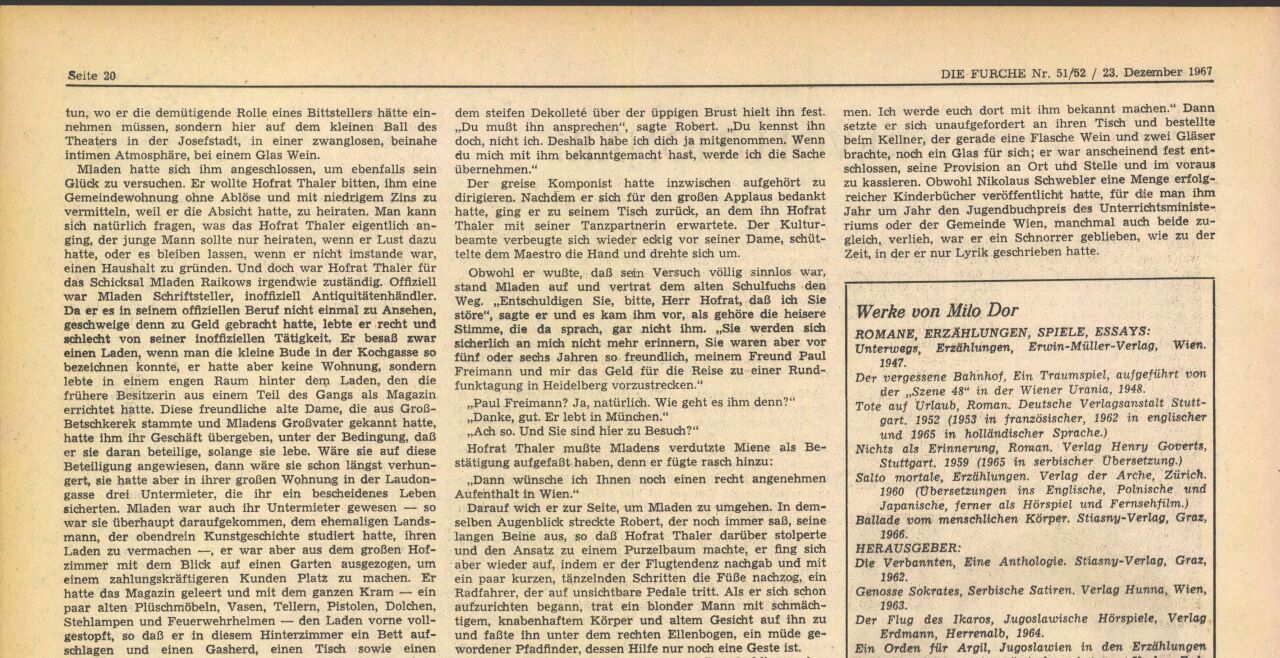
tun, wo er die demütigende Rolle eines Bittstellers hätte einnehmen müssen, sondern hier auf dem kleinen Ball des Theaters in der Josefstadt, in einer zwanglosen, beinahe intimen Atmosphäre, bei einem Glas Wein.
Mladen hatte sich ihm angeschlossen, um ebenfalls sein Glück zu versuchen. Er wollte Hofrat Thaler bitten, ihm eine Gemeindewohnung ohne Ablöse und mit niedrigem Zins zu vermitteln, weil er die Absicht hatte, zu heiraten. Man kann sich natürlich fragen, was das Hof rat Thaler eigentlich anging, der junge Mann sollte nur heiraten, wenn er Lust dazu hatte, oder es bleiben lassen, wenn er nicht imstande war, einen Haushalt zu gründen. Und doch war Hofrat Thaler für das Schicksal Mladen Raikows irgendwie zuständig. Offiziell war Mladen Schriftsteller, inoffiziell Antiquitätenhändler. Da er es in seinem offiziellen Beruf nicht einmal zu Ansehen, geschweige denn zu Geld gebracht hatte, lebte er recht und schlecht von seiner inoffiziellen Tätigkeit. Er besaß zwar einen Laden, wenn man die kleine Bude in der Kochgasse so bezeichnen konnte, er hatte aber keine Wohnung, sondern lebte in einem engen Raum hinter dem Laden, den die frühere Besitzerin aus einem Teil des Gangs als Magazin errichtet hatte. Diese freundliche alte Dame, die aus Groß-Betschkerek stammte und Mladens Großvater gekannt hatte, hatte ihm ihr Geschäft übergeben, unter der Bedingung, daß er sie daran beteilige, solange sie lebe. Wäre sie auf diese Beteiligung angewiesen, dann wäre sie schon längst verhungert, sie hatte aber in ihrer großen Wohnung in der Laudongasse drei Untermieter, die ihr ein bescheidenes Leben sicherten. Mladen war auch ihr Untermieter gewesen — so war sie überhaupt daraufgekommen, dem ehemaligen Landsmann, der obendrein Kunstgeschichte studiert hatte, ihren Laden zu vermachen —, er war aber aus dem großen Hofzimmer mit dem Blick auf einen Garten ausgezogen, um einem zahlungskräftigeren Kunden Platz zu machen. Er hatte das Magazin geleert und mit dem ganzen Kram — ein paar alten Plüschmöbeln, Vasen, Tellern, Pistolen, Dolchen, Stehlampen und Feuerwehrhelmen — den Laden vorne vollgestopft, so daß er in diesem Hinterzimmer ein Bett aufschlagen und einen Gasherd, einen Tisch sowie einen Schrank aufstellen konnte, der ihm zugleich als Kredenz diente. Es war ihm gelungen, auch Wasser einleiten zu lassen, das Klosett befand sich jedoch draußen auf dem Gang, zu dem eine schmale Tür führte.
Solange man ihn in Ruhe ließ, war er mit seiner Behausung zufrieden. Man ließ ihn aber nicht in Ruhe. Die
Zeit war gekommen, das vor zwölf oder dreizehn oder vierzehn Jahren, er wußte nicht mehr genau, wie lange es schon
her war, gegebene Eheversprechen einzulösen. Verjährte Eheversprechen gingen, wie gesagt, Hofrat Thaler nichts an, es ging ihn aber wohl an, daß ein Schriftsteller, und Mladen Raikow galt nach der Veröffentlichung seines Erzählungs-bändchens „Der Aufbruch“ seit Jahren als solcher, keine ordentliche Bleibe hatte. Die Gemeinde Wien hatte schon Leuten Wohnungen zugeschanzt, von denen nur ein paar gereimte Grüße zum 1. Mai oder zum Muttertag in einer Gewerkschaftszeitung erschienen waren. Mladen Raikow war also durchaus berechtigt gewesen, sich Hoffnungen in dieser Richtung zu machen, als er sich in geliehenem Smoking zum Ball aufgemacht hatte, er hatte aber nicht damit gerechnet, wie schwer es sein würde, den kleinen Kulturbeamten anzusprechen und ihn in ein Gespräch zu verwickeln.
Mit einer für sein Alter erstaunlichen Beweglichkeit flitzte Hofrat Thaler von dem Augenblick an, in dem er das Foyer des Theaters in der Josefstadt betreten hatte, von einer Gruppe zur anderen, schüttelte die Hände der Schauspieler und Regisseure und küßte die Hände der Salondamen, der Naiven sowie die der Damen des Charakterfachs und der jungen Elevinnen, die sich noch nicht entschieden hatten, was sie spielen sollten.
Mladen und Robert, die sich an einem kleinen Tisch im Foyer postiert hatten, um ihn abzufangen, folgten ihm in den eigentlichen Ballsaal, die sogenannten Sträußlsäle, in denen ein Büfett mit einer Kaffeemaschine untergebracht war und in denen an normalen Theaterabenden die Zuschauer während der Pausen umherwandelten; jetzt drängten sie sich mit ihren Lieblingsschauspielern auf der Tanzfläche. Auch hier machte Hofrat Thaler, sich geschickt zwischen den Tischen windend, seine Honneurs; ein Kulturpolitiker auf der Wahlreise. Dann begab er sich in den nächsten und letzten Raum, der zum Restaurant „Weißer Hahn“ gehörte, an die Sträußlsäle grenzte und mit ihnen durch eine Tür verbunden war; dort setzte er sich an den Tisch des berühmten Operettenkomponisten und nun tanzte er mit dessen Frau; eine schwungvolle Drehung drohte ihn gerade wie aus einer Zentrifuge hinauszuschleudern, doch die resolute Dame mit
dem steifen Dekollete über der üppigen Brust hielt ihn fest. „Du mußt ihn ansprechen“, sagte Robert. „Du kennst ihn doch, nicht ich. Deshalb habe ich dich ja mitgenommen. Wenn du mich mit ihm bekanntgemacht hast, werde ich die Sache übernehmen.“
Der greise Komponist hatte inzwischen aufgehört zu dirigieren. Nachdem er sich für den großen Applaus bedankt hatte, ging er zu seinem Tisch zurück, an dem ihn Hofrat Thaler mit seiner Tanzpartnerin erwartete. Der Kulturbeamte verbeugte sich wieder eckig vor seiner Dame, schüttelte dem Maestro die Hand und drehte sich um.
Obwohl er wußte, daß sein Versuch völlig sinnlos war, stand Mladen auf und vertrat dem alten Schulfuchs den Weg. „Entschuldigen Sie, bitte, Herr Hofrat, daß ich Sie störe“, sagte er und es kam ihm vor, als gehöre die heisere Stimme, die da sprach, gar nicht ihm. „Sie werden sich sicherlich an mich nicht mehr erinnern, Sie waren aber vor fünf oder sechs Jahren so freundlich, meinem Freund Paul Freimann und mir das Geld für die Reise zu einer Rundfunktagung in Heidelberg vorzustrecken.“
„Paul Freimann? Ja, natürlich. Wie geht es ihm denn?“
„Danke, gut. Er lebt in München.“
„Ach so. Und Sie sind hier zu Besuch?“
Hofrat Thaler mußte Mladens verdutzte Miene als Bestätigung aufgefaßt haben, denn er fügte rasch hinzu:
„Dann wünsche ich Ihnen noch einen recht angenehmen Aufenthalt in Wien.“
Darauf wich er zur Seite, um Mladen zu umgehen. In demselben Augenblick streckte Robert, der noch immer saß, seine langen Beine aus, so daß Hofrat Thaler darüber stolperte und den Ansatz zu einem Purzelbaum machte, er fing sich aber wieder auf, indem er der Flugtendenz nachgab und mit ein paar kurzen, tänzelnden Schritten die Füße nachzog, ein Radfahrer, der auf unsichtbare Pedale tritt. Als er sich schon aufzurichten begann, trat ein blonder Mann mit schmächtigem, knabenhaftem Körper und altem Gesicht auf ihn zu und faßte ihn unter dem rechten Ellenbogen, ein müde gewordener Pfadfinder, dessen Hilfe nur noch eine Geste ist.
Hofrat Thaler murmelte etwas zur Entschuldigung, bedankte sich bei dem blonden Mann und steuerte dann entschlossen auf einen dicken Mann mit melancholischem Hundeblick zu, in dem Mladen den Stadtrat für Wohn- und Bauwesen erkannte; er hatte sein Bild schon oft in Zeitungen gesehen.
„Nachdem wir diese Sache glücklich hinter uns gebracht haben“, sagte Robert und zog seine Beine zurück, „können wir uns endlich angenehmeren Dingen widmen. Herr Ober, bringen Sie uns bitte eine Flasche Kremser Sandgrube.“
„Das habt ihr nicht gut eingefädelt“, sagte der gealterte Pfadfinder, der an ihren Tisch getreten war, und sah sie mit seinen porzellanblauen Augen treuherzig an; sein Knabenlächeln deutete aber an, daß er die beiden Freunde durchschaut hatte. „Wenn ihr mit dem Hofrat in Ruhe reden wollt, dann müßt ihr in den Klub sozialistischer Akademiker kom-
men. Ich werde euch dort mit ihm bekannt machen.“ Dann setzte er sich unaufgefordert an ihren Tisch und bestellte beim Kellner, der gerade eine Flasche Wein und zwei Gläser brachte, noch ein Glas für sich; er war anscheinend fest entschlossen, seine Provision an Ort und Stelle und im voraus zu kassieren. Obwohl Nikolaus Schwebler eine Menge erfolgreicher Kinderbücher veröffentlicht hatte, für die man ihm Jahr um Jahr den Jugendbuchpreis des Unterrichtsministeriums oder der Gemeinde Wien, manchmal auch beide zugleich, verlieh, war er ein Schnorrer geblieben, wie zu der Zeit, in der er nur Lyrik geschrieben hatte.
Zweimal wurden Dichtern Lateinamerikas Nobelpreise zuteil. Im. Jahre 1945 erhielt ihn Gabriela Mistral, 1889 bis 1957, die aus Vicuna im Land Chile stammte, 1967 heißt der Nobelpreisträger Miguel Angel Asturias, 1899 geboren in Guatemala City. Vor diesen beiden war es Rüben Dario (1867 bis 1916) gewesen, der als Schriftsteller aus Lateinamerika größte Beachtung und Bewunderung gefunden hatte. Er entstammte der kleinen mittelamerikanischen Republik Nicaragua, hatte jedoch den gesamten lateinamerikanischen Raum als seine unermeßlich große Heimat empfunden. Sein Lebenswerk war es, für sie eine eigenständige Literatur gleichsam aus dem Nichts neu zu schaffen. Vor ihm hatte kaum eine lateinamerikanische Dichtung, die nicht völlig von der spanischen Literatur abhängig gewesen wäre, existiert.
Kommt diesen iberoamerikanischen Dichtern in der Tat ein überragender Rang zu? Gewähren die den Nobelpreis verteilenden Preisrichter ihnen die hohe Auszeichnung vielleicht nur als eine etwas vergeistigte „Entwicklungshilfe“1? Gleichsam als eine Art „Ermutigung“ für „Unterentwickelte“? Diese Fragen hörte man vor einigen Monaten nicht selten.
Die Antwort erfolgt hier nicht im Gewand eines literaturgeschichtlichen Essays, sondern in einem einfacheren Verfahren: in der Gegenüberstellung einiger wesentlicher Textproben. Die erste, aus dem Beginn unseres Jahrhunderts, von Rüben Dario; die zweite, aus den dreißiger Jahren, von Gabriela Mistral; die letzten, aus der Jahrhundertmitte, von Miguel Asturias stammend. In dieser Andeutung eines Querschnitts zeigen sich die Phasen einer lebendigen Entwicklung in der lateinamerikanischen Literatur, und man erkennt: Ähnlich wie in der Literaturentwicklung in Europa hat auch in Lateinamerika die Daseinssituation und das Weltgefühl der Dichter aus anfänglicher Positivität und Hoffnungsfreude in die Bereiche einer immer schwärzeren Düsternis geführt.
*
Mit Hoffnungsfreude hatte es begonnen: Die Jahre 1900 bis 1914 waren auch für Lateinamerika vielfach eine Periode des noch ungetrübten Friedens und der Daseinsfreude. Damals erhielt Rwben Dario, der seine Aufgabe als Pionier einer eigenständigen Literaturschöpfung auch in der dichterischen Verherrlichung einzelner lateinamerikanischer Nationen sah, den Auftrag, eine Dichtung anläßlich der Hundertjahrfeier des argentinischen Staates zu gestalten. Die Republik Argentinien war 1810 gegründet worden. Damals beirrte den Dichter nichts in seinem Glauben, daß die Segnungen des Friedens und der Freiheit in dieser jungen Republik, die, wie er es eindringlich beschreibt, Einwanderer aus allen Ländern Europas aufnahm, ungetrübt dauern sollten. Aus seinem „Gesang an Argentinien“ sei der Text jenes Gedichtes vorgestellt, worin er die argentinische Frau preist — die „Venu* der Kreolen“'.
Der Schilderung der „Venus“, die hier nicht die Liebesgottheit, sondern nur die höchste Verkörperung weiblicher Schönheit meint, läßt er die Frauentypen anderer Nationen vorausgehen. Zunächst schwebt dem Dichter, freilich nur in Verbindung mit dem Walzer genannt, an erster Stelle die Wienerin vor. Eine ganze Strophe spricht dann von der jungen Engländerin, der „Miß“. Zwei Zeilen widmen sich der Pariserin, und zwei weitere malen den „Fries“ der um Paris sich rankenden Provinzen Frankreichs. Darnach gelten zwei Schlußstrophen dem Porträt der Argentinierin, mosaikhaft zusammengesetzt aus inneren Widersprüchen: Sie verkörpert „Lustleben, aber auch Illusion“. Sie ist „Löwin, wenn sie
liebt“, und oft auch ein „zärtlicher Feind“. Doch ihre inneren Gegensatzspannungen sollen ihr Bild als das vielgestaltigste und reichste illustrieren; für Rüben Dario ist und bleibt sie die „Siegerin“.
DIE ARGENTINIERIN
Walzerlust ist daheim in Wien.
Spanien blickt aus dem maurischen Auge.
Der Sirene Italiens tauge
Wimper, die kühn schwingt zur Iris hin.
Britisch ist diese Milch-Haut gewiß, Die — zarteste Lilien-Substanz — Mit milden Errötens Glanz Engelgleich bildet das Antlitz der Miß.
Eleganz in duftenden Wellen Umhaucht Frau'n im rühmreichen Paris. Frankreichs Landschaft rankt um sie hellen, Buntflammend umgreifenden Fries.
O du Ansammlung vielfältigster Orden, O Mischung der Gepräge, der Kräfte! Parischer Marmor, Gold aus dem Norden, Perlenglanz, Schimmer in Lilien aufsteigender Säfte.
Musik, die zu Raum ward; Vision Einer in Wahrheit verzaubernden Pein; Lustleben und auch Illusion, Sanftmut, die allsänftigend scheint —
Heftige Glut, lodernd in tausend Idolen,
Löwin, die liebt — oft in Weibes Gestalt zärtlicher
Feind —: All dies ist sie —
Siegerin —;
Venus der Kreolen!
Als Preislied konnte sich diese Idee formen, da jene Epoche noch eine gewisse Geborgenheit ausstrahlte. Doch diese Geborgenheit wurde seit 1914 keineswegs nur in Europa grausam zerstört. Auch in Lateinamerika blieb eine solche Grundstimmung des Frohsinns und der Daseinsfreude nicht erhalten; die Tatsache, daß Europa — der Kontinent, der bei den Lateinamerikanern noch bewundernde Verehrung genossen hatte — sich im ersten Weltkrieg selbst zu zerfleischen vermochte, bereitete herbe Enttäuschung; vielerlei Zeugnisse erweisen es, daß sich nun auch das geistige Klima um die Dichter Lateinamerikas erkältete. Fast ein Menschenalter trennt das Geburtsjahr des Rüben Dario von Gabriela Mistral.
*
Der Raum, der die Kindheit der Gabriela Mistral umgab, war zuerst noch jener der schönen Geborgenheit. Nicht wesentlich verschieden vom Durchschnitt der chilenischen Mädchen, nannte sie, der es bestimmt sein sollte, zu einem Star der Weltliteratur aufzusteigen, sich selbst schlicht mit ihrem bürgerlichen Namen, Lucila Godoy de Alcayaga. Sie glaubte an ihren Lehrerinnenberuf; sie war ihrem Verlobten, dem jungen Miguel, aufs zärtlichste zugetan. Da brach das Chaos in die Sphäre des Glücks: der Verlobte starb unvermutet. Das zarte Gemüt der Lucila sah sich von Wahn-
STEFAN NEMANJIC
GEBET EINES KÖNIGS
Vergift mich nicht, deinen armen Bettler! Vergifj mich nicht,
der ich Sn der Gesetzlosigkeit lebel Vergifj mich nicht,
der ich mich In dem tüfiem Schlamm wälze,
sondern reich mir deine heilige Rechte,
mit der du mich gesegnet hast
in diesem trügerischen Leben,
und lehre mich führend
in deine Fufjstapfen zu treten,
wenn ich auch unwürdig,
wenn ich auch unnütz,
wenn Ich auch Uberflüssig bin.
STEFAN NEMANJIC, der ersIgekrSnl serbische König, 1165—1227. Aul dem Serbischen von Milo Dor.
Werke von Milo Dor
ROMANE, ERZÄHLUNGEN, SPIELE, ESSAYS: Unterwegs, Erzählungen, Erwin-Müller-Verlag, Wien. 1947.
Der vergessene Bahnhof, Ein Traumspiel, aufgeführt von der „Szene 48“ in der Wiener Urania, 1948.
Tote auf Urlaub, Roman. Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart. 1952 (1953 in französischer, 1962 in englischer und 1965 in holländischer Sprache.)
Nichts als Erinnerung, Roman. Verlag Henry Goverts, Stuttgart. 1959 (1965 in serbischer Übersetzung.)
Salto mortale, Erzählungen. Verlag der Arche, Zürich. 1960 (Übersetzungen ins Englische, Polnische und Japanische, ferner als Hörspiel und Fernsehfilm.)
Ballade vom menschlichen Körper. Stiasny-Verlag, Graz, 1966.
HERAUSGEBER:
Die Verbannten, Eine Anthologie. Stiasny-Verlag, Graz, 1962.
Genosse Sokrates, Serbische Satiren. Verlag Hunna, Wien, 1963.
Der Flug des Ikaros, Jugoslawische Hörspiele, Verlag Erdmann, Herrenalb, 1964.
Ein Orden für Argil, Jugoslawien in den Erzählungen seiner besten zeitgenössischen Autoren. Verlag Erdmann, Herrenalb, 1965.
Der Sohn des Wesirs, Jugoslawische Märchen. Verlag für Jugend und Volk, Wien, 1965,
und weitere.
IN ZUSAMMENARBEIT MIT REINHARD FEDERMANN: Romeo und Julia in Wien, Verlag Kindler, München, 1954. Othello von Salerno, Verlag Kindler, München, 1956. Vier Kriminalromane und Abenteuerromane.
ÜBERSETZUNGEN:
Von Ivo Andric, Isaak Babel, Miroslav Krzela und anderen.
Dazu eine ganze Reihe Hörspiele und Theaterstücke aus dem Serbokroatischen.