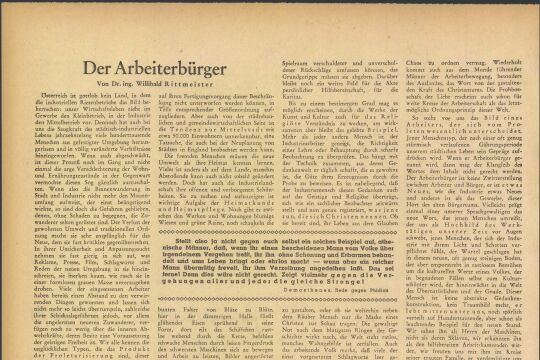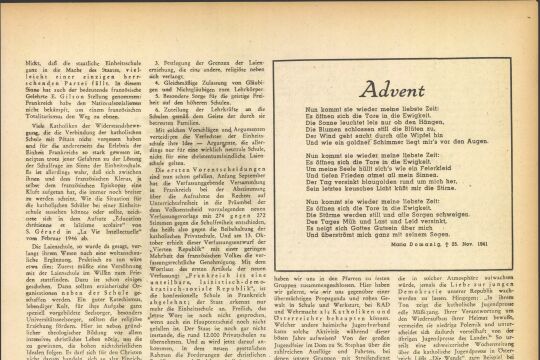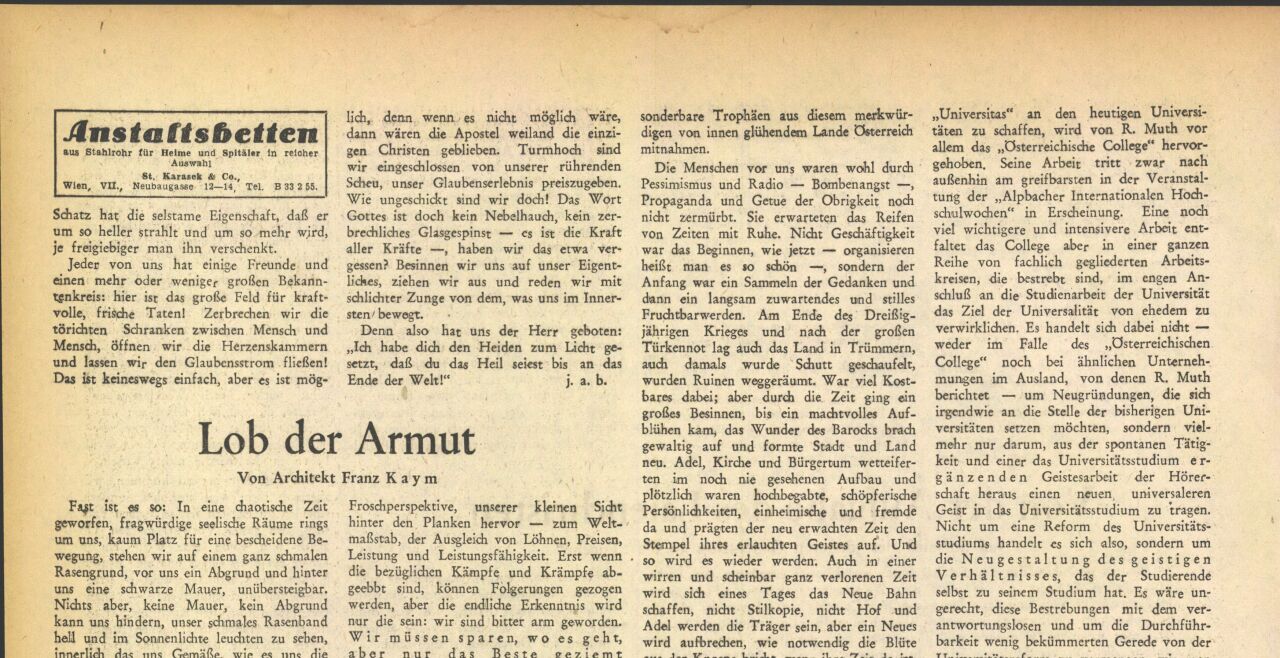
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lob der Armut
Fa t ist es so: In eine chaotische Zeit geworfen, fragwürdige seelische Räume rings um uns, kaum Platz für eine bescheidene Bewegung, stehen wir auf einem ganz schmalen Rasengrund, vor uns ein Abgrund und hinter uns eine schwarze Mauer, unübersoeigbar. Nichts aber, keine Mauer, kein Abgrund kann uns hindern, unser schmales Rasenband hell und im Sonnenlichte leuchten zu sehen, innerlich das uns Gemäße, wie es uns die Phantasie gibt, zu gestalten und Pläne zu schmieden.
Aber in dieser Lage wirklich bauen? Bauen heißt: für Generationen festlegen.
Drei Jahre nach den Frühlingstagen von 1945 ist der Aufbau kaum begonnen, es sei denn vorsichtiges Rekonstruieren historischer Werke oder Flick werk für des Tages Notdurft und es wird wahrscheinlich so gut und notwendig sein.
Der Aufbau versagte, mußte versagen, da er in einer Atmosphäre voll Luftlöcher vor sich gehen sollte. Dem materiellen Aufbau muß der Gedanke vorausgehen. Vergessen wir nicht, daß Ardiitektur viele, sehr viele äußerliche Voraussetzungen hat. Die Bildhauer sind schon in besserer Lage, sie brauchen zur Arbeit ein Stück Stein, Holz und wenig Werkzeug. Die Dichter haben sich in den letzten Wochen gewaltig gewehrt gegen den Auftrag, der ein Vorwurf war, zeitnahe zu produzieren, und man könnte glauben’, sie brauchen zu ihrem Schaffen doch bloß Tinte und Papier, also sehr wenig Materie. Die Leute vom Bau achten die Haltung der Dichter, weil sie wissen, daß vor dem Bau das Fundament kommt und wo wäre heute ein Fundament? Allen Künsten fehlt noch die seelische Grundlage. Denkbar wäre vielleicht, daß die Musik als die immateriellste Kunst zuerst zur Tat kommt, jedoch auch für den Musiker gelten die Voraussetzungen der Tage, in welchen er lebt. Gerne glaubt man die Erzählung, Michelangelo sei mit seinen rohen ui\d halbfertigen Steinen durch die Wirren seiner Zeit gezogen, rastlos von einer Arbeitsstätte zur anderen. Aber wie könnte man jene grausamen Zeiten mit unseren heutigen vergleichen, die aus allen Fundamenten gehoben sind und äußerster Pessimismus wie ein schieches Tier durch alle Länder und Hirne kriecht.
Bauen, schöpferisch tätig sein, kann man nur aus einer lebensbejahenden Anschauung heraus — pessimistische, zerrissene Tage wie die unseren können nur Flick werk machen. Wir haben es bewiesen. Mit seltsam unwirklicher Überheblichkeit, dabei voll von Zweifeln ging man daran, aufzubauen, gleichzeitig alles: Oper, St. Stephan, Burgtheater, Kriegsministerium und so weiter eine lange Liste, alles auf einmal. Dies wäre für eine starke Zeit, für ein ganz reiches Land zuviel gewesen, aber für unser so schwer angeschlagenes Land war es vermessen. Fehlte doch nicht nur unendlich viel Stoffliches, es fehlten die bejahenden Gedanken und es fehlten die tragenden Persönlichkeiten, die Positiven, die Kräfte, die ganze Zeiten formen könnten. Otto Wagner ist cot, am Ende des ersten Weltkrieges ist er von uns gegangen. Er hätte vielleicht das Schauerliche wagen können, aber auch nur er, der Genius, auch Adolf Loos nicht. Müßig zu träumen, ob und wie ein Otto Wagner dieses, durch Frevel und Brand verwüstete Wien hätte aufbauen wollen, aber: kein Volk ist so reich, daß es sich den Luxus des verfehlten Aufbaues einer Stadt, ja ganzer Teile des Landes leisten könnte. Fehler darf man machen, aber nicht bauen.
Wirtschaftlich ist ein weiter Weg zu gehen und wahrlich kein leichter — aus unserer Froschperspektive, unserer kleinen Sicht hinter den Planken hervor — zum Weltmaßstab, der Ausgleich von Löhnen, Preisen, Leistung und Leistungsfähigkeit. Erst wenn die bezüglichen Kämpfe und Krämpfe abgeebbt sind, können Folgerungen gezogen werden, aber die endliche Erkenntnis wird nur die sein: wir sind bitter arm geworden. Wir müssen sparen, wo es geht, aber nur das Beste geziemt dem, der sparen muß, jede Fehlleistung ist Vergeudung, jeder Ersatz Verschwendung, jedes Provisorium von üblen Folgen. Aus dem Bewußtsein unserer Armut heraus dürfen wir nur Höchstwertiges leisten, keinen Ausschuß züchten. Nicht betteln darf die Devise der kommenden Jahre sein, nicht schmarotzen von den Tafeln der Reichen, sondern ein Stolz ohne Überheblichkeit muß der neue Stil werden. Nicht aus Verzagtheit, sondern aus der Erkenntnis unserer Armut heraus, aus dem Wissen um die Kräfte in uns, aus dem Hoffen heraus, müssen wir die Zähne zusammenbeißen, diese neinsagenden Zeiten überwinden wollen. Stolz auf unsere Armut nenne man Bauernarroganz, aber Armut ist keine Schande.
Vom seligen Bundespräsidenten Doktor Hainisch geht die Mär, daß er unbekümmert bei Diplomatenempfängen gedoppelte Schuhe trug. Der innere Glanz des Menschen überstrahlte alle Hüllen. Vielleicht ist es auch ein Märchen, daß die Reichen dieser Welt, Ausländer, als sie seinerzeit nach Salzburg kamen, abgetragene Hüte aus Bauernbesitz als kostbares Andenken kauften und sich als sonderbare Trophäen aus diesem merkwürdigen von innen glühendem Lande Österreich mitnahmen.
Die Menschen vor uns waren wohl durch Pessimismus und Radio — Bombenangst —, Propaganda und Getue der Obrigkeit noch nicht zermürbt. Sie erwarteten das Reifen von Zeiten mit Ruhe. Nicht Geschäftigkeit war das Beginnen, wie jetzt — organisieren heißt man es so schön —, sondern der Anfang war ein Sammeln der Gedanken und dann ein langsam zuwartendes und stilles Fruchtbarwerden. Am Ende des Dreißigjährigen Krieges und nach der großen Türkennot lag auch das Land in Trümmern, auch damals wurde Schutt geschaufelt, wurden Ruinen weggeräumt. War viel Kostbares dabei; aber durch die Zeit ging ein großes Besinnen, bis ein machtvolles Aufblühen kam, das Wunder des Barocks brach gewaltig auf und formte Stadt und Land neu. Adel, Kirche und Bürgertum wetteiferten im noch nie gesehenen Aufbau und plötzlich waren hochbegabte, schöpferische Persönlichkeiten, einheimische und fremde da und prägten der neu erwachten Zeit den Stempel ihres erlauchten Geistes auf. Und so wird es wieder werden. Auch in einer wirren und scheinbar ganz verlorenen Zeit wird sich eines Tages das Neue Bahn schaffen, nicht Stilkopie, nicht Hof und Adel werden die Träger sein, aber ein Neues wird aufbrechen, wie notwendig die Blüte aus der Knospe bricht, wenn ihre Zeit da ist. In der Zwischenzeit dürfen wir nicht vergessen, daß die Kommenden nicht mit Fehlleistungen belastet werden dürfen. Wir wissen, daß ungeheure Gefahren aus einem verpfuschten Aufbau drohen, aus überhasteten Be- und Entschlüssen. Lassen wir Ruinen ruhig stehen, seien wir stolz auf unsere Armut. Pflanzen wir auf die Schuttberge Rasen und innerhalb der Mauertrümmer die raschkletternde Ampelopsis Veitschi und hie und da einen Blütenstrauch am richtigen Ort. Die Landschaft wird ohne viel Aufwand in Kürze nicht nur staubfrei sein, sie wird ein zauberhaftes Bild bieten, wohl von einem leisen Unterton von Grauen umgeben. Aber jede historische Ruine ist schließlich von schweren Schicksalschlägen geformt, und der menschliche Zug ist verständlich und liebenswert, daß die Beschauer leicht vergessen, daß sie vor einem Mahnmal stehen und angesichts von Ruinen ausrufen: Welche Ruhe, welche Idylle!
Uber alles Grauen breitet die Zeit Ver- gessen.
Laßt uns Grassamen streuen, bis wir wieder zu Entschlüssen fähig sind.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!