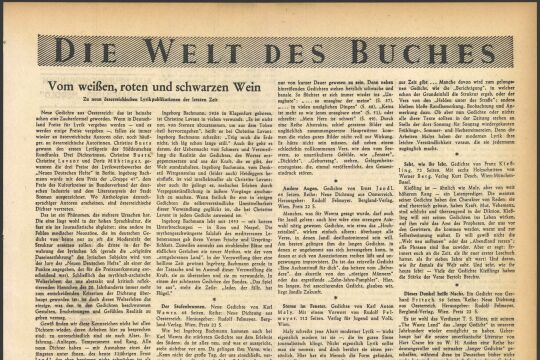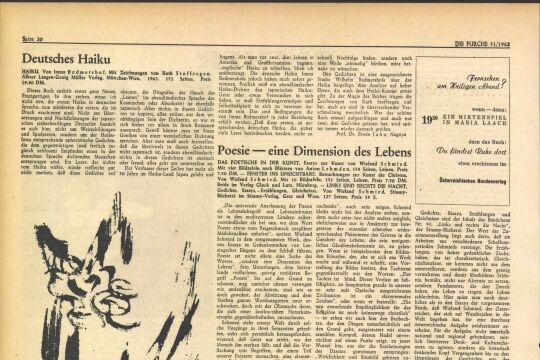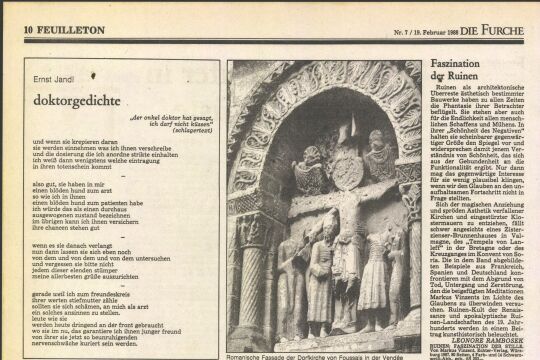Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lyrische Zauberspeise
Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn man beim Lesen moderner Gedichte die Problematik der Gegenwartslyrik vergißt. Das poetische Gebilde muß standfest sein und auf theoretische Stützen verzichten können. Die Gedichte Wieland Schmieds empfindet; wir als Gebilde. In dem Titel „Landkarte des Windes“ (Otto-Müll er-Verlag, Salzburg) vereinigt sich das Greifbare mit dem Ungreifbaren. Darin erblicke ich ihre symptomatische Bedeutung. Denn die Binnenwelt der Gefühlslyrik ist ebenso zerfallen wie die historisch geprägte Außenwelt. Aber es gibt eine dritte Dimension. Das Gedicht wird als ein Gefäß in sie hineingestellt.
„Die Töpfer“ stehen am Eingang. Mit den Gedichten „Die Fischer“ und „Die Hirten“ bilden sie ein Triptychon. Darin fällt der Name Vergil. Und wir denken an das Hirtengedicht im „Faust“, das zum zweiten Helenaakt hinüberleitet.
„Rezept für ein Gedicht“ erläutert den poetischen Vorgang im gleichen Sinne wie „Die Töpfer“. Es ist das Rezept einer Zauberspeise. Für Schmied ist das Ambrosia der Dichtung nicht Symbol, sondern Gebackenes.
' iß dein Gedicht langsam.
Es ist eine Speise, die wird dich immer nähren.
Es fehlt nicht an Gedichten, in denen Schmied beim Zusammenspannen von Realem und Spirituellem ins Preziöse gerät.
Eng sind die Linien aneinandergerückt auf der Landkarte des Herzens.
Oder:
Auf der Landkarte des Windes liegen die Hügel unseres Lebens.
Am reinsten gelingen Schmied Gedichte, in denen er sich der Förmwirklichkeit südlicher Landschaft hingibt. „Endlich und unbegrenzt“ nennt er sie mit charakteristischer Antithese. Denn „endlich“ ist auch die Landkarte, endlich ist das poetische Gebilde, das zu möglichster Dichte und Geschlossenheit gebracht werden muß, aber unbegrenzt ist der fortschwingende Geist der Landschaft, unbegrenzt ist die Resonanz des Windes und des klingenden Verses, der die Empfindung weitergibt, die ihn ins Dasein rief.
In dieser Spannung zwischen einem dennoch Gleichbleibenden, das vom keiner Vergänglichkeit abgetragen wird, und seinem unbegrenzten Widerhall im Erleben steht die Dichtung von Wieland Schmied.
Gelegentlich notiert er die ironische Existenz von Zeichen, deren Bedeutungswert für uns verlorengegangen ist. Gelegentlich tastet er — wie Günter Eich — den Botschaften und Schriftzeichen nach, die in Baumrinde oder Fels geschrieben sind. Die Neigung zu mystischer Semantik, deren Bedeutungswert hinter dem reinen Daseinswert zurücktritt, teilt Schmied mit anderen Vertretern der jüngeren Dichtergeneration. Seine Huldigung an Ezra Pound gilt nicht so sehr dem Vorbild als dem Flaggenwechsel im poetischen Kommando. Schmieds Gedichte zeigen, daß auch die junge Lyrik auf Bildungselemente nicht verzichtet („Nachricht aus Verona“ zeigt es fast allzu deutlich, denn hier wird das literarische Konzept überspannt.) Aber Bildung tritt jetzt in anderer Form auf. Sie steht nicht im Zeichen des Kosmos — des äußeren so wenig wie des inneren —, der verbürgt ist durch eine Wertördnutig, der sich der Gebildete strebend angleicht, sondern sie manifestiert sich in spontanen Momenten, wenn das Einerlei der Dinge jäh zu magischer Ordnung zusammenschießt.
Dieses Bildungserlebnis wurde den amerikanischen Dichtern früher als uns zuteil. Erst heute, da viele unserer geschichtlichen und moralischen Ordnungen-, endgültig der Inflation verfallen sind, bahnt sich das dichterische Erleben einen neuen schöpferischen Weg. Daß es sich als jüngstes Erleben im ältesten wiederfindet, daß es den ästhetischen Schein mit der Realität von Zeichen und Ding vertauscht, daß es mystische Erfahrungen materialisiert, gehört zum paradoxen Charakter einer Epoche, die älteste Konflikte der abendländischen Kultur in sich auszutragen hat. i
Was sich der Analyse entzieht, aber den eigentlichen Zauber des Gedichts ausmacht, ist die lyrische Stimme in den Versen von Wieland Schmied. Es ist eine Stimme von beherrschtem Klang, eine Stimme, die ihre Reichweite nicht überschätzt, die Grenze, Umriß und Gestalt liebt und sie ruhig sagend mit dem Wort erfüllt. So ist das Gedicht „Die große Grenze“ trotz der Grenzenlosigkeit, die es beschwört, in sich gefaßt und voll gelassener Wehmut. Die Dinge liegen auf der Waage der Poesie:
Jeder von uns ist Atlas.
Jeder trägt auf seinen Schultern
den Erdkreis Homers.
Tagseite und Nachtseite der Welt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!