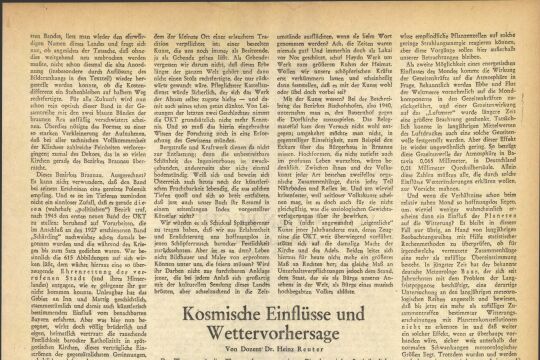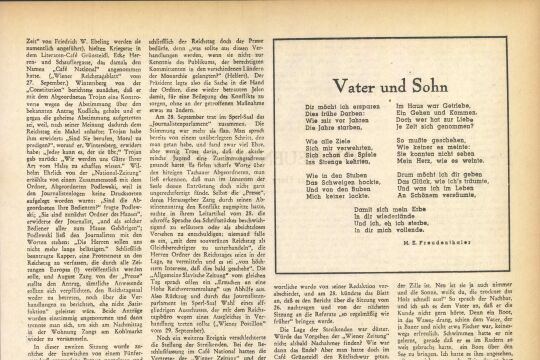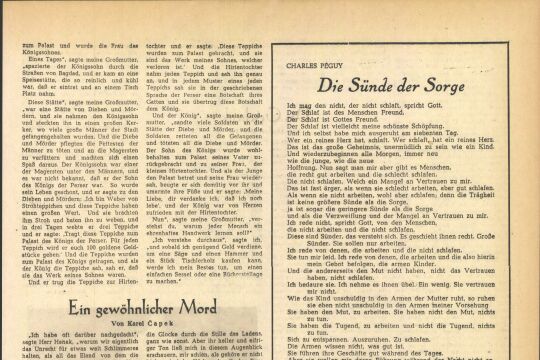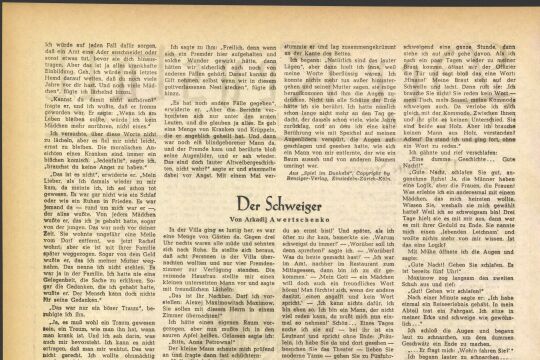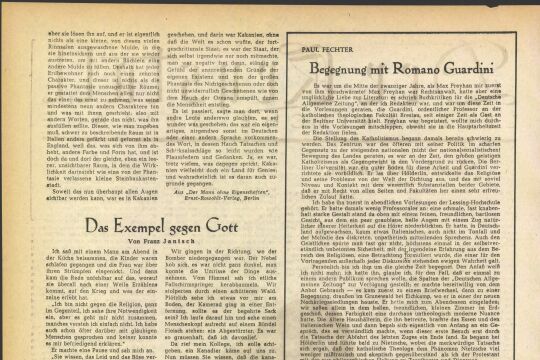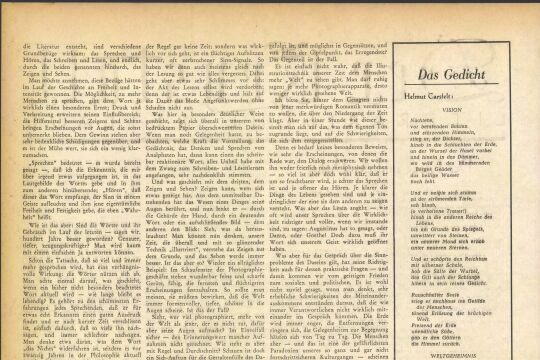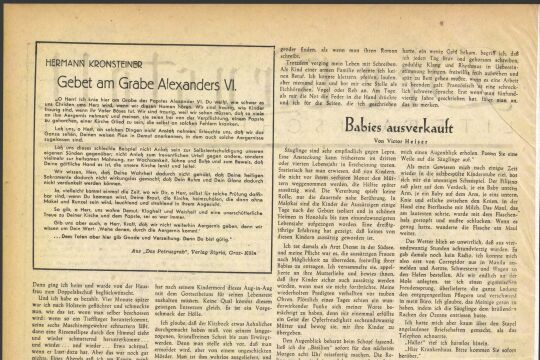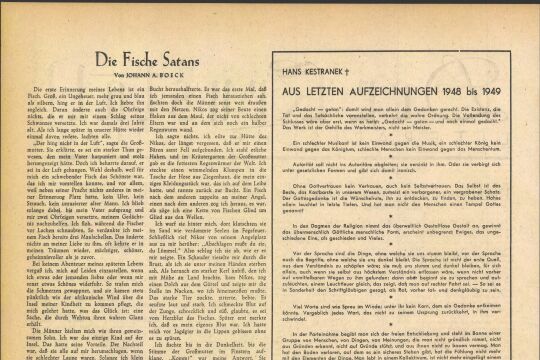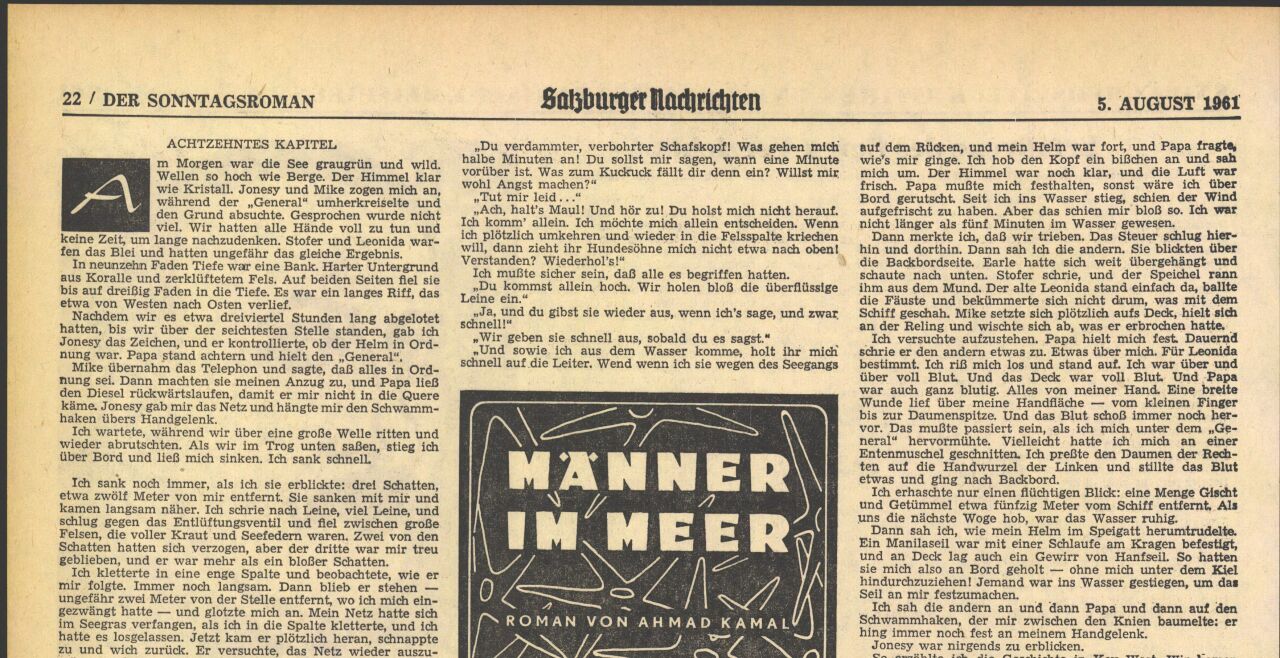
Am Morgen war die See graugrün und wild. Wellen so hoch wie Berge. Der Himmel klar wie Kristall. Jonesy und Mike zogen mich an, während der „General“ umherkreiselte und den Grund absuchte. Gesprochen wurde nicht viel. Wir hatten alle Hände voll zu tun und keine Zeit, um lange nachzudenken. Stofer und Leonida warfen das Blei und hatten ungefähr das gleiche Ergebnis.
In neunzehn Faden Tiefe war eine Bank. Harter Untergrund aus Koralle und zerklüftetem Fels. Auf beiden Seiten fiel sie bis auf dreißig Faden in die Tiefe. Es war ein langes Riff, das etwa von Westen nach Osten verlief.
Nachdem wir es etwa dreiviertel Stunden lang abgelotet hatten, bis wir über der seichtesten Stelle standen, gab ich Jonesy das Zeichen, und er kontrollierte, ob der Helm in Ordnung war. Papa stand achtern und hielt den „General“.
Mike übernahm das Telephon und sagte, daß alles in Ordnung sei. Dann machten sie meinen Anzug zu, und Papa ließ den Diesel rückwärtslaufen, damit er mir nicht in die Quere käme. Jonesy gab mir das Netz und hängte mir den Schwammhaken übers Handgelenk.
Ich wartete, während wir über eine große Welle ritten und wieder abrutschten. Als wir im Trog unten saßen, stieg ich über Bord und ließ mich sinken. Ich sank schneit
Ich sank noch immer, als ich sie erblickte: drei Schatten, etwa zwölf Meter von mir entfernt. Sie sanken mit mir und kamen langsam näher. Ich schrie nach Leine, viel Leine, und schlug gegen das Entlüftungsventil und fiel zwischen große Felsen, die voller Kraut und Seefedem waren. Zwei von den Schatten hatten sich verzogen, aber der dritte war mir treu geblieben, und er war mehr als ein bloßer Schatten.
Ich kletterte in eine enge Spalte und beobachtete, wie er mir folgte. Immer noch langsam. Dann blieb er stehen — ungefähr zwei Meter von der Stelle entfernt, wo ich mich eingezwängt hatte — und glotzte mich an. Mein Netz hatte sich im Seegras verfangen, als ich in die Spalte kletterte, und ich hatte es losgelassen. Jetzt kam er plötzlich heran, schnappte zu und wich zurück. Er versuchte, das Netz wieder auszuwürgen, als er merkte, daß es weder gut schmeckte noch nahrhaft war. Doch das Netzwerk verhedderte sich an seinen Zähnen.
Da begriff ich, warum er sich nicht vor den Luftblasen gefürchtet hatte, die ich vorhin abließ, und warum er nicht zusammen mit den beiden andern ausgerissen war: er konnte einfach nicht sehen, wie grausig ich in meinem Anzug aussah. Nur sehr wenig Fische haben genug Mut, es mit einem Taucher aufzunehmen. Dieser hier war fast blind. Er konnte mich nicht sehen; er spürte nur die Bewegung. Meine Luftblasen interessierten ihn, anstatt ihn in die Flucht zu schlagen. Und das Netz im Seegras hatte hin und her geschwankt. Deshalb hatte er danach geschnappt.
Mike sprach durchs Telephon.
„He“, fragte er ruhig, „wie geht’s dir? Wir haben hier oben zwei Haie. Sie tauchten gerade eben auf. Einer scheint etwa zwei Meter lang zu sein, der andre ist ein bißchen größer. War’s das, was du auch bemerkt hast?“
„Nur ein kleiner Teil davon. Der andere Teil ist noch hier unten und lächelt mich an. Er hat Kiemenschlitze, die sind so breit wie die Schlitze in der Kühlerhaube eines Sechsunddreißiger Fordwagens, und eine Rückenflnne, so groß wie ein Kommandoturm. Etwa ein Dutzend Pilotenflsche kleben an ihm, und die Geschwülste über seinen Augen sind so dick wie Blumenkohl, und mein Netz benutzt er als Zahnstocher.“
Ich blickte durch mein Oberlicht und sah, daß die beiden kleineren von oben niederstießen, und noch einer, der ihnen folgte. Ich klemmte mich etwas tiefer in den Felsen.
„Hallo“, sagte ich, „jetzt kommen deine beiden — und noch ein dritter.“
Mike lachte. Ihm war’s ebensowenig wie mir zum Lachen zumute.
„Hast du Deckung?“
„Ja, ich stecke in einem Loch und spiele Einsiedlerkrebs. Wenn ich Karten hätte, könnte ich mit dem verfluchten Hundesohn Poker spielen, falls wir einen Tisch hätten — so nah ist er mir.“
„Warte nur so lange, bis sie es leid sind, dich anzuglotzen. Es hat keinen Sinn, jetzt an Arbeit zu denken. Haben sie denn keine Angst vor dir?“
„Zweie hatten Angst. Der große sieht zu schlecht, um sich' zu fürchten. Oder er ist zu hungrig. Was sich bewegt, will er gern kosten. Es sieht nicht so aus, als ob die beiden andern abzögen, so lange der große bleibt.“
Dann sagten wir eine Weile gar nichts. Endlich begann auch' der große, dem mein Netzsack immer noch aus dem Rachen baumelte, sich zu verziehen. Ich richtete mich ein bißchen auf und sah ihm nach.
„Mike?“
„Ja, ich bin hier!“
„Sieh mal auf die Uhr!“
Am Mast jedes Schwammtaucherschiffes befindet sich eine Uhr, die etwa mannshoch in einem Holzkasten festgemacht ist, damit die Leute im Boot immer wissen, wie lange ihre Taucher arbeiten.
„Ja?“
„Wie lange bin ich schon unten?“
„Etwa zweiundeinhalb Minuten, vielleicht drei Minuten.“
„Was? Nicht länger?“ Ich richtete mich noch mehr auf und spähte umher. „Hör mal, das verdammte alte Unterseeboot ist außer Sicht. Ich kann ihn nirgends entdecken.“
„Und die andern?“
„Ach, halt den Mund! Die sind auch weg! Sag’s mir, wenn zwei weitere Minuten vergangen sind. Dann haben sie Zeit, sich zu verdrücken — oder wiederzukommen. Ich kann die Zeit schlecht abschätzen. Bin nervös. Wenn sie nicht umkehren, steig ich nach oben. Aber schnell. Halt mir die Leiter bereit und erwarte mich. Ich weiß nicht, ob ich sie bei dieser See sofort erwischen kann. Sag’ Papa, daß alle bereit sein sollen, mich einzuholen, wenn ich die Leiter nicht gleich greifen kann. Verstanden?“
„Verstanden.“
„Sind sie oben? Siehst du sie?“ Ich blickte durchs Oberfenster.
„Nein, nichts zu sehen. Alle suchen. Papa hat Stofer den Mast hoch geschickt, damit er sucht. Er ist seekrank geworden, weil’s oben so schaukelt, und kotzt sie alle voll. Nein, hier oben ist nicht die Spur von ihnen zu sehen.“
Unter der Oberfläche würden sie auch kaum stehen. Da war die See zu grob.
„Okay, sag mir erst mal Bescheid, wenn eine Minute vorbei ist.“
Ich wartete. Ich war ein bißchen ängstlich. Zwischen mir und dem „General“ waren etwa fünfunddreißig Meter Wasser. Der große Hai war gut fünf Meter lang gewesen und so mager wie ein Barracuda. Wegen seiner schlechten Augen bekam er nie genug zu fressen. Er würde sehr wahrscheinlich nach allem schnappen. Und die andern würden’s ihm nachtun. „Halb!“
„Halb — was?“
„Eine halbe Minute ist vorbei!“
- „Meinst du die Hälfte von zwei Minuten? Oder anderthalb Minuten?“
„Bloß eine halbe Minute.“ .
„Du verdammter, verbohrter Schafskopf! Was gehen mich halbe Minuten an! Du sollst mir sagen, wann eine Minute vorüber ist. Was zum Kuckuck fällt dir denn ein? Willst mir wohl Angst machen?“
„Tut mir leid …“
„Ach, halt’s Maul! Und hör zu! Du holst mich nicht herauf. Ich komm’ allein. Ich möchte mich allein entscheiden. Wenn ich plötzlich umkehren und wieder in die Felsspalte kriechen will, dann zieht ihr Hundesöhne mich nicht etwa nach oben! Verstanden? Wiederhol’s!“
Ich mußte sicher sein, daß alle es begriffen hatten.
„Du kommst allein hoch. Wir holen bloß die überflüssige Leine ein.“
„Ja, und du gibst sie wieder aus, wenn ich’s sage, und zwar, schnell!“
„Wir geben sie schnell aus, sobald du es sagst.“
„Und sowie ich aus dem Wasser komme, holt ihr mich' schnell auf die Leiter. Wend wenn ich sie wegen des Seegangs nicht sofort zu fassen bekomme, dann rappelt ihr da oben euer bißchen Mut zusammen und bringt mich irgendwie an Bord — so oder so!“
„Leiter oder nicht, wir bringen dich an Bord.“
Er rief mir den Ablauf der ersten Minute zu. Ich stand auf. Vollkommene Ruhe auf dem Grund. Nicht nur Ruhe im Vergleich zu der stürmisch bewegten Oberfläche — sondern es rührte sich auch kein Fisch. Kein einziger. Auch der kleinste nicht.
Ich quetschte mich wieder in die Spalte.
„Mike?“
„Alek?“
„Na, wer denn sonst? Dachtest du, ich gebe hier unten eine Gesellschaft?“
„Ist recht.“
„Hör zu! Die großen Biester müssen irgendwo in der Nähe sein. Siehst du sie?“
„Nicht die Spur ist zu sehen.“
„Schön, dann hör mal zu: sag’s mir zehn Sekunden vorher, ehe die zwei Minuten um sind!“
„Du hast noch vierzig Sekunden.“
Ich kletterte ins Freie und sah mich um. Mit Mühe konnte ich den einen Hai ausmachen: einen kleinen, nur wie ein Schatten, etwa dreißig Meter entfernt Ungefähr sechs Meter über dem Grund schwamm er umher. Der würde mir nichts tun. Haie beißen nie gleich zu, wenn sie etwas Fremdes gewahren. Erst betrachten sie es. Wenn es etwas ist, das gut aussieht — und Taucher sehen nicht gut aus —, dann nehmen sie’s bei der zweiten oder dritten Runde. Normale Haie. Wie der blinde sich benehmen würde, das wußte ich nicht Ich konnte aus dem Wasser heraus sein, ehe die andern sich besonnen hatten. Ich fragte mich bloß, ob der große Teufelssohn mit dem Netz im Zahn sich irgendwo versteckt hatte und mir auflauerte.
„Noch zehn Sekunden! Und ruhig Blut!“
Ich sammelte Luft an, begann zu schweben und klammerte mich ans Seegras, um nicht gleich zu steigen. Alles schien in Ordnung.
Da ließ ich los.
Ich stieg schneller und schneller, je mehr die Wassersäule über mir an Gewicht abnahm. Aber mir war’s, als stünde ich still, und am liebsten hätte ich wie eine Schildkröte meine Beine in den Bauch gezogen.
Dann hielt ich nach dem „General“ Ausschau. Der Schiffsrumpf schoß mir wie ein Expreß-Zug entgegen.
Ich schrie und stieß mit dem Kinnbacken das Ventil ein und hob beide Arme, um die Wucht des Zusammenpralls abzuschwächen. Dann schlug ich dagegen.
Falls ich betäubt war, so weckte mich das Wasser, das durch das zerbrochene Fenster hereinspritzte. Und in der Sekunde, ehe ich gegen den „General“ stieß, schien’s mir, ich hätte einen Hai gesehen. Den großen. Direkt vor mir stieg er auf.
Ich kann mich erinnern, daß ich mich den Schiffsboden entlangwurstelte wie eine Fliege an der Stubendecke. Wenn das Schiff sich jetzt hob, würde es mich mitnehmen, und dann würde es wieder sinken und mich gegen die Planken pressen. Und dann konnte ich heraus.
Ich stieß auf der falschen Seite durch die Oberfläche — auf Backbord —, und nicht dort, wo die Schiffsleiter hing. Die Kuppel des Helms war eingedellt, das Mikrophon war aus seinem Gehäuse gerissen und schlug mir ständig ins Gesicht. Und durch das zerbrochene Frontfenster zischte und blubberte das Wasser. Jedesmal, wenn der „General“ sank, riß er mich unter sich, und ich schlug gegen ihn und wartete nur darauf, daß die Scheiben ganz kaputt gingen und meine Luft fortzischte und das Wasser richtig einbrach. Immer, wenn ich den Arm freimachen konnte, hieb ich mit dem Schwammhaken gegen die Schiffswand, um denen an Bord klarzumachen, daß ich da war. Aber sie erwarteten mich ja auf Steuerbord. Und es hatte nicht den Anschein, als ob auch nur einer gehört hätte, daß ich gegen den Rumpf stieß. Jede Sekunde kam mir wie hunderttausend Jahre vor. Das Telephon war still. Ehe ich gegen den Bootsboden schlug, hatte ich aufgeschrien. Das mußten sie dahin deuten, daß sie mir mehr Leine ausgeben sollten. Wenn nun mein Frontglas wegsplitterte, und ich sank, und sie mehr Leine ausgaben, dann würde ich durch den Wasserdruck zu Brei gequetscht werden, ehe ich ertrank.
Ich hämmerte mit dem Haken auf den „General“ und sah, wie die Stahlflnger ihm Splitter aus der Seite fraßen. Dann wurde ich wieder unter den Rumpf gesaugt.
Als ich hochkam, merkte ich, daß ein erster dünner Glassplitter fortflog. Dann packte mich etwas im Wasser. Etwas Schwarzes, Ich schrie und hob den Haken und schlug mit aller Kraft zu.
Dann wurde ich wieder gegen den „General“ geschleudert, und dann wurde ich eingeholt und flog auf Deck. Ich lag flachauf dem Rücken, und mein Helm war fort, und Papa fragte, wie’s mir ginge. Ich hob den Kopf ein bißchen an und sah mich um. Der Himmel war noch klar, und die Luft war frisch. Papa mußte mich festhalten, sonst wäre ich über Bord gerutscht. Seit ich ins Wasser stieg, schien der Wind aufgefrischt zu haben. Aber das schien mir bloß so. Ich war nicht länger als fünf Minuten im Wasser gewesen.
Dann merkte ich, daß wir trieben. Das Steuer schlug hierhin und dorthin. Dann sah ich die andern. Sie blickten über die Backbordseite. Earle hatte sich weit übergehängt und schaute nach unten. Stofer schrie, und der Speichel rann ihm aus dem Mund. Der alte Leonida stand einfach da, ballte die Fäuste und bekümmerte sich nicht drum, was mit dem Schiff geschah. Mike setzte sich plötzlich aufs Deck, hielt sich an der Reling und wischte sich ab, was er erbrochen hatte.
Ich versuchte aufzustehen. Papa hielt mich fest. Dauernd schrie er den andern etwas zu. Etwas über mich. Für Leonida bestimmt. Ich riß mich los und stand auf. Ich war über und über voll Blut. Und das Deck war voll Blut Und Papa war auch ganz blutig. Alles von meiner Hand. Eine breite Wunde lief über meine Handfläche — vom kleinen Finger bis zur Daumenspitze. Und das Blut schoß immer noch hervor. Das mußte passiert sein, als ich mich unter dem „General“ hervormühte. Vielleicht hatte ich mich an einer Entenmuschel geschnitten. Ich preßte den Daumen der Rechten auf die Handwurzel der Linken und stillte das Blut etwas und ging nach Backbord.
Ich erhaschte nur einen flüchtigen Blick: eine Menge Gischt und Getümmel etwa fünfzig Meter vom Schiff entfernt. Als uns die nächste Woge hob, war das Wasser ruhig.
Dann sah ich, wie mein Helm im Speigatt herumtrudelte. Ein Manilaseil war mit einer Schlaufe am Kragen befestigt, und an Deck lag auch ein Gewirr von Hanfseil. So hatten sie mich also an Bord geholt — ohne mich unter dem Kiel hindurchzuziehen! Jemand war ins Wasser gestiegen, um das Seil an mir festzumachen.
Ich sah die andern an und dann Papa und dann auf den Schwammhaken, der mir zwischen den Knien baumelte: er hing immer noch fest an meinem Handgelenk.
Jonesy war nirgends zu erblicken.
So erzählte ich die Geschichte in Key West. Wir kamen spät am Abend des gleichen Tages hin, an dem es geschehen war. Ein Arzt von der Küstenwache stieg an Bord. Er betrachtete sich meine Hand, sah mich an und sagte, ich müsse ins Hospital. Er würde den Sanitätswagen bestellen. Ich Wollte es nicht. Er bestellte ihn trotzdem. Papa und Mike begleiteten mich. Papa sah sorgenvoll aus. Der „General Joseph Finegan“ war das erste Schwammtaucherschiff, das seit fünfundzwanzig Jahren in Key West einlief. Papa hatte Angst um sein Schiff.
Während sie im Hospital an mir herumdokterten, machten Papa und Mike eine Aussage bei der Behörde, bei der man Bescheid sagen muß, wenn jemand zu Tode gekommen ist.
Den Abend mitgerechnet, wo wir ankamen, waren wir Im ganzen sechs Tage in Key West. Das Verhör fand am Morgen des sechsten Tages statt und dauerte vierzig Minuten. Es wurde teils an Land, teils an Bord abgehalten. Ich trug die Hand in einer Schlinge. Ich hatte eine Menge Blut verloren — ein paar kleine Arterien waren zerrissen —, aber im Hospital hatten sie’s wieder ersetzt.
(Fortsetzung in der nächsten Samstdgausga.be)
Deutsche Übersetzung von Elisabeth Schnack — Copyright , by Arche-Verlag, Peter Schifferli, Zürich