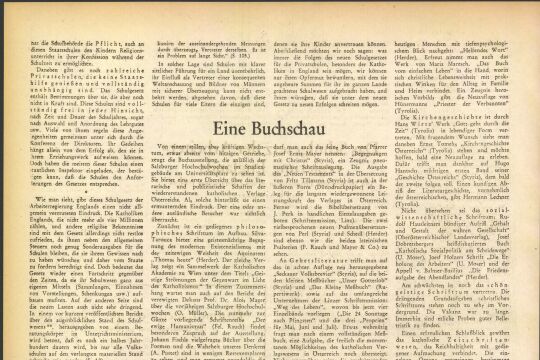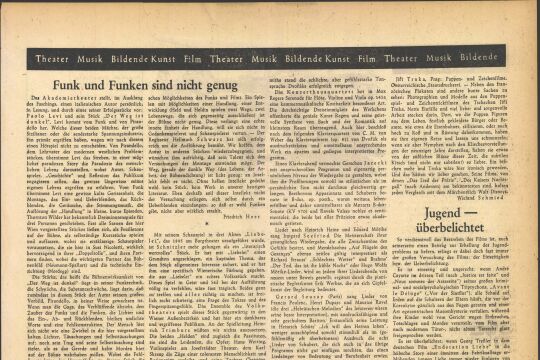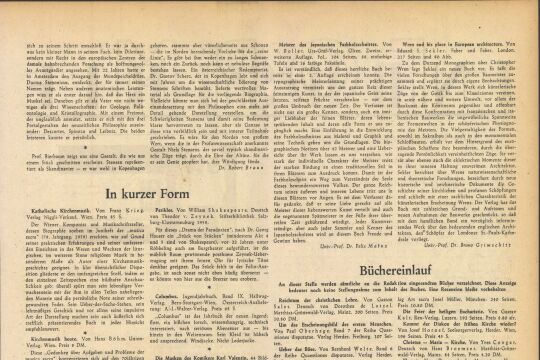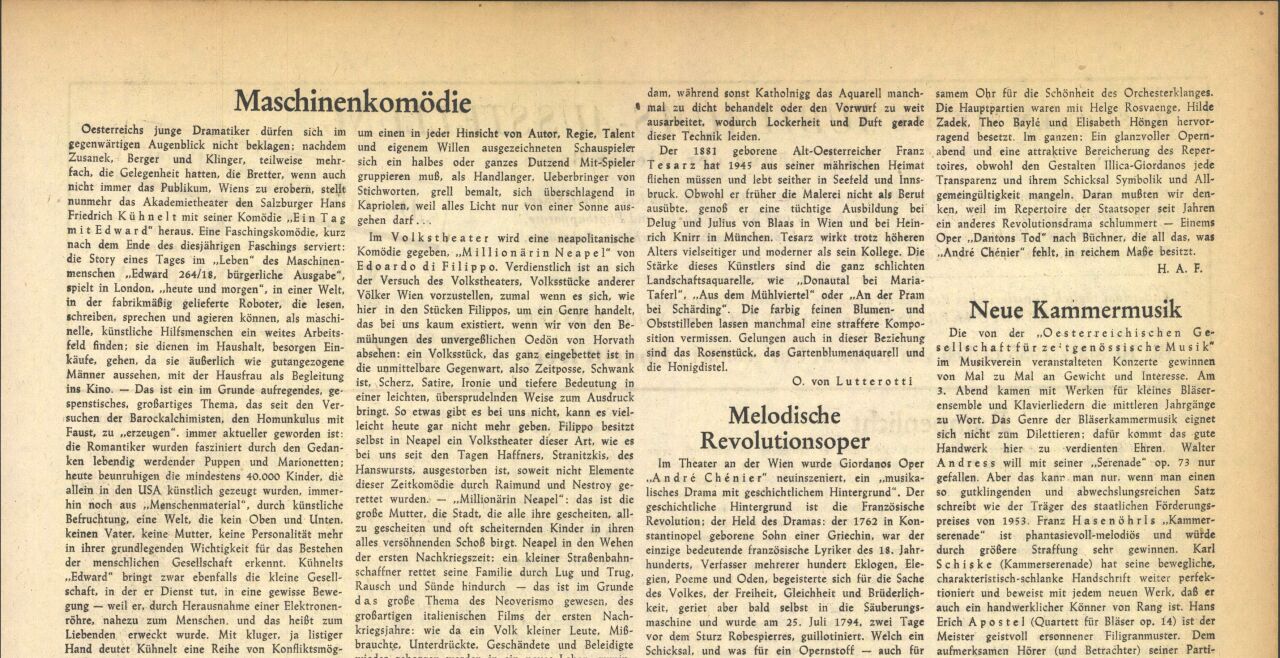
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Maschinenkomodie
Oesterreichs junge Dramatiker dürfen sich im gegenwärtigen Augenblick nicht beklagen; nachdem Zusanek, Berger und Klinger, teilweise mehrfach, die Gelegenheit hatten, die Bretter, wenn auch nicht immer das Publikum, Wiens zu erobern, stellt nunmehr das Akademietheater den Salzburger Hans Friedrich K ü h n e 11 mit seiner Komödie „Ein Tag mit Edward“ heraus. Eine Faschingskomödie, kurz nach dem Ende des diesjährigen Faschings serviert: die Story eines Tages im „Leben“ des Maschinenmenschen „Edward 264/18, bürgerliche Ausgabe“, piek in London, „heute und morgen“, in einer Welt, in der fabrikmäßig gelieferte Roboter, die lesen, schreiben, sprechen und agieren können, als maschinelle, künstliche Hilfsmenschen ein weites Arbeitsfeld finden; sie dienen im Haushalt, besorgen Einkäufe, gehen, da sie äußerlich wie gutangezogene Männer aussehen, mit der Hausfrau als Begleitung ins Kino. — Das ist ein im Grunde aufregendes, gespenstisches, großartiges Thema, das seit den Versuchen der Barockalchimisten, den Homunkulus mit Faust, zu „erzeugen“, immer aktueller geworden ist: die Romantiker wurden fasziniert durch den Gedanken lebendig werdender Puppen und Marionetten; heute beunruhigen die mindestens 40.000 Kinder, die allein in den USA künstlich gezeugt wurden, immerhin noch aus „Menschenmaterial“, durch künstliche Befruchtung, eine Welt, die kein Oben und Unten, keinen Vater, keine Mutter, keine Personalität mehr in ihrer grundlegenden Wichtigkeit für das Bestehen der menschlichen Gesellschaft erkennt. Kühnelrs „Edward“ bringt zwar ebenfalls die kleine Gesellschaft, in der er Dienst tut, in eine gewisse Bewegung — weil er, durch Herausnahme einer Elektronenröhre, nahezu zum Menschen, und das heißt zum Liebenden erweckt wurde. Mit kluger, ja listiger Hand deutet Kühnelt eine Reihe von Konfliktsmöglichkeiten an, die sich aus dem Kontakt dieses Homunkulus, der fast ein Mensch ist, mit „lebenden“ Menschen, die aber oft maschinenmäßig, „typisch“, schablonenhaft reagieren, in ihren Reaktionen und Aktionen ergeben. Da unser Autor aber konsequent am Willen zur Komödie festhält, entsteht statt der möglichen Tragödie oder Groteske, statt eines neuartigen Faust-Dramas, eine flotte Sache, die durch die „Bombenbesetzung“ Edwards mit Josef Meinrad dem Stück einen Publikumserfolg sichert, wie noch selten dem Werk eines jungen Autors unseres Landes. Di übrigen Rollen lassen, trotz manch eifriger Bemühungen, die Schablone und Uebertrtibung grell hervortreten — hoffen wir, daß sich hier nicht ein neuer Akademietheaterstil entwickelt, die letzte Aufführung von Shaws „Candida“ könnte in diese Richtung weisen, ältere Erfahrungen, etwa bei Spielen um Käthe Dorsch, lassen ebenfalls in diesem Sinne Vermutungen zu: dieser „Stil“ bestünde darin, daß um einen in jeder Hinsicht von Autor, Regie, Talent und eigenem Willen ausgezeichneten Schauspieler sich ein halbes oder ganzes Dutzend Mit-Spieler gruppieren muß, als Handlanger, Ueberbringer von Stichworten, grell bemalt, sich überschlagend in Kapriolen, weil alles Licht nur von einer Sonne ausgehen darf. . .
Im Volkstheater wird eine neapolitanische Komödie gegeben, „M i 11 i o n ä r i n Neapel“ von Edoardo di Filippo. Verdienstlich ist an sich der Versuch des Volkstheaters, Volksstücke anderer Völker Wien vorzustellen, zumal wenn es sich, wie hier in den Stücken Filippos, um ein Genre handelt, das bei uns kaum existiert, wenn wir von den Bemühungen des unvergeßlichen Oedön von Horvath absehen: ein Volksstück, das ganz eingebettet ist in die unmittelbare Gegenwart, also Zeitposse, Schwank ist, Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in einer leichten, übersprudelnden Weise zum Ausdruck bringt. So etwas gibt es bei uns nicht, kann es vielleicht heute gar nicht mehr geben. Filippo besitzt selbst in Neapel ein Volkstheater dieser Art, wie es bei uns seit den Tagen Haffners, Stranitzkis, des Hanswursts, ausgestorben ist, soweit nicht Elemente dieser Zeitkomödie durch Raimund und Nestroy gerettet wurden. — „Millionärin Neapel“: das ist die große Mutter, die Stadt, die alle ihre gescheiten, allzu gescheiten und oft scheiternden Kinder in ihren alles versöhnenden Schoß birgt. Neapel in den Wehen der ersten Nachkriegszeit: ein kleiner Straßenbahnschaffner rettet seine Familie durch Lug und Trug, Rausch und Sünde hindurch — das ist im Grunde das große Thema des Neoverismo gewesen, des großartigen italienischen Films der ersten Nachkriegsjahre: wie da ein Volk kleiner Leute, Mißbrauchte, Unterdrückte. Geschändete und Beleidigte wieder geborgen werden in ein neues Leben, zumindest in einen neuen Anfang. Die Wiener Bearbeitung der „Millionärin Neapel“ vermag den Schmelz, die heitere Trauer des Films nicht zu retten, und sie scheitert auch naturgemäß vorbei an der übermütig schimmernden Leichtigkeit des Filipposchen Volkstheaters; hier, im Wiener Volkstheater stehen alle zeitgenössischen Volksstücke im Schatten der unübertroffenen „Geschichten aus dem Wienerwald“ Honraths. Das ist in dieser Aufführung besonders deutlich spürbar in den Gestaltungen Karl Skraups, Viktor Gschmeidlers, Carl Bosses. — Nichts ist schwerer, als ein Volk auf die Bühne zu stellen, wenn dieses selbe Volk nicht im Publikumsraum mitspielt . .. Volksstücke dieser Art leben aus der untrennbaren Einheit von unten und oben, von Bühne und Publikum. Das ist eine Lehre, die vielleicht auch andere Professionisten angeht, die nicht vom Theater sind. Friedrich Heer
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!