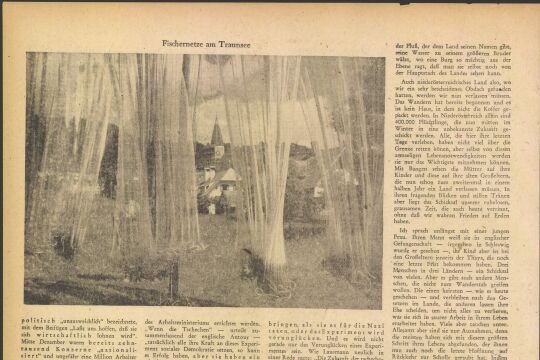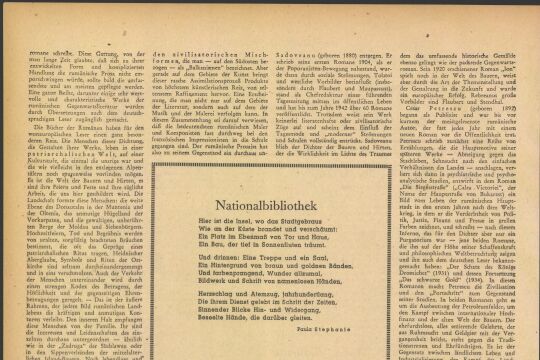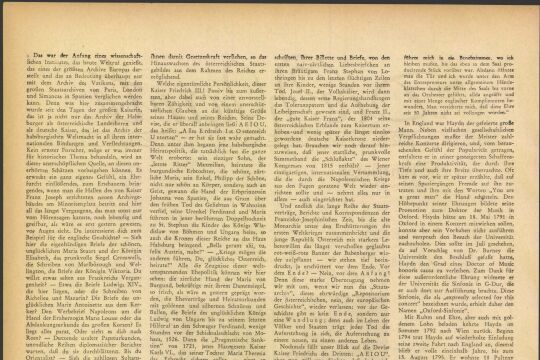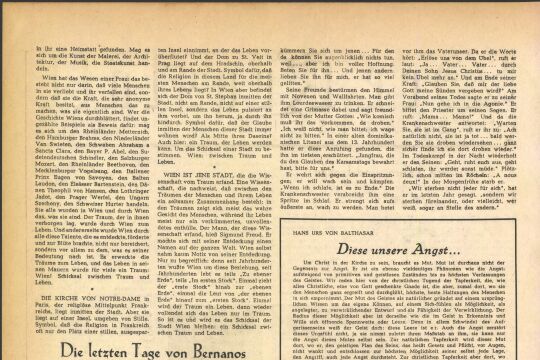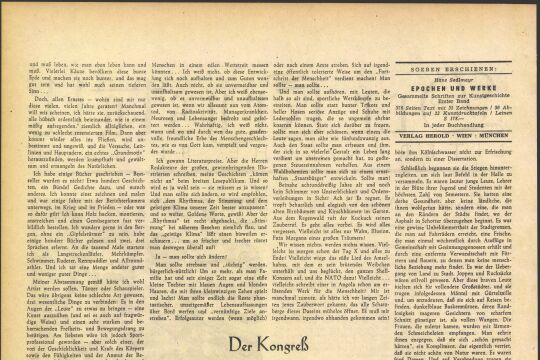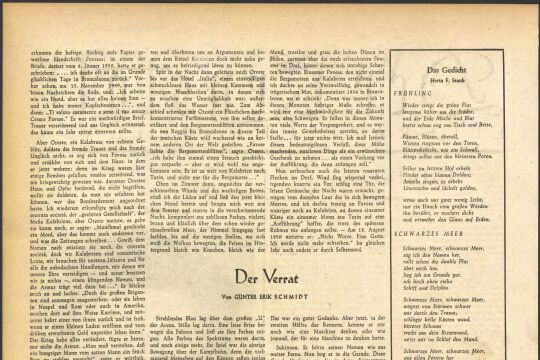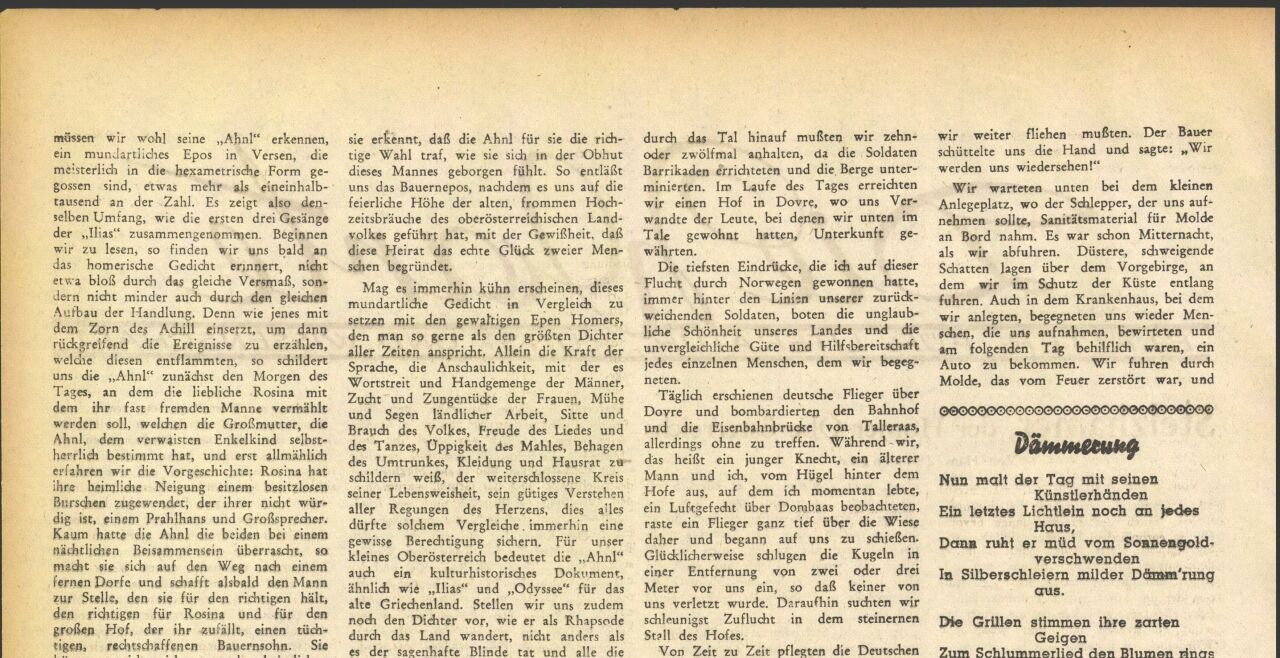
Sigrid U n d s e t, die große norwegische Dichterin, Trägerin des Nobelpreises für Literatur, erlebte im Jahre 1940 den Überfall der Deutschen auf ihr Vaterland. Als bekannte Gegnerin des Nationalsozialismus floh sie nach Schweden. In Stockholm erfuhr sie, daß ihr ältester Sohn Anders als norwegischer Offizier gefallen war, ein Verlust, dessen Schmerz noch an mancher Studie ihres folgenden literarischen Schaffens nachzittert; ihrem zweiten Sohn, Hans, gelang die Flucht aus Oslo zu seiner Mutter nach Stockholm. Hier in Schwedens Hauptstadt erreichte die Dichterin ein Angebot, in Amerika eine Vortragstournee zu halten und sie nahm den Antrag an. Ober Sibirien und Japan reiste sie nach Amerika. Ihre Erlebnisse während der Besetzung Norwegens, ihre Flucht und ihre Reise nach Amerika schildert sie in ihrem neuesten Buch „Return to the Future“, das 1944 in deutscher Sprache unter dem Titel „Wieder in die Zukunft“ im Europa-Verlag in Zürich erschien.
Dank dem Entgegenkommen des Verlage können wir dem Buch die Episode ihrer Flucht aus ihrer Heimat Lillehammer entnehmen.
„Samstag, den 20. April 1940 erfuhren wir, daß die Engländer ihre Stellungen in Bröttum, südlich von Lillehammer, aufgegeben hatten, so daß wir den Einmarsch der Deutschen im Laufe des Tages erwarten mußten. Es wurde mir geraten, die Stadt noch vorher zu verlassen, da ich beständig gegen den Nationalsozialismus geschrieben und gesprochen, mich auch aktiv am Hilfswerk für die Flüchtlinge Mitteleuropas beteiligt hatte.
Es blieb mir gerade soviel Zeit, die nötigsten Dinge in eine Tasche zu packen. Geld hatte ich keines im Hause, da soviele Flüchtlinge an meine Tür geklopft hatten, die Hilfe suchten. Und die Banken waren geschlossen. Meine Haushälterin bestand darauf, daß ich leihweise hundert Kronen von ihr annahm. Damit konnte ich ganz gut bis Stockholm kommen
Ein Milttärauto nahm mich durchs Tal hinauf Während der ganzen Fahrt stießen wir auf Soldaten, kleine Munitionstransporte und Militärautos Unterdessen mußten wir dauernd vor Fliegern auf der Hut sein, da Automobile immer Gefahr liefen, von Maschinengewehren beschossen zu werden. So war es bereits abends, als ich den großen Hof im Tal erreichte, wo ich haltmachen wollte.
Die norwegischen Radiostationen von Hamar und Vigra waren jetzt verstummt; man hatte jedoch versucht, im Norden des Tales eine neue Station zu errichten. Ich wurde aufgefordert, für den Radiodienst und für die norwegische Presse zu arbeiten. Am Sonntag fuhr ich nordwärts. Im Daclt-stock des Nebengebäudes eines der Bahnhöfe in jenem Tal sprach ich am Mikrophon, während mein Manuskript auf der Waschmaschine der Frau des Stationsvorstehers lag.
Auch in Dombaas hatte ich zu tun. Dort sah ich zum erstenmal die Folgen eines Bombardements. Von manchem der Fachwerkhäuschen waren nur noch Trümmer übrig geblieben. Kaum hatte ich das Hotel erreicht, das voll norwegischer Offiziere war, als auch schon Luftalarm ertönte. Da es in Dombaas keinen Luftschutzraum gab, mußten wir durch meterhohen weichen Schnee über ein Feld waten, um einen kleinen Tannenwald zu erreichen.
Es war ein herrlicher, winterlicher Frühlingstag, wie wir sie im April in Norwegen öfter haben. Wo immer ein steiniger Hügel aus dem Schnee herausragte, roch es wundervoll nach schmelzendem Schnee, nach Moos und nasser Erde und duftete nach Tannennadeln. Es war ein höchst seltsames Gefühl, wenn Bomber direkt über unsere Köpfe hinwegflogen und Maschinengewehre knatterten. Hin und wieder knacksten Zweige und Äste auf uns herab. Zwei Stunden lag ich zwischen drei Föhren flach auf dem Bauch in einer Schneemulde. Ein Soldat mit verbundenem Kopf half mir schließlich aus dem Schneeloch heraus, worauf wir uns wieder zum Hotel zurückarbeiteten.
Da im Hotel ein Feldlazarett errichtet wurde, mußten wir höher ins Tal hinauf. Man packte uns, eine befreundete Familie und mich, in ein Auto. Während der Fahrt durch das Tal hinauf mußten wir zehn-oder zwölfmal anhalten, da die Soldaten Barrikaden errichteten und die Berge unterminierten. Im Laufe des Tages erreichten wir einen Hof in Dovre, wo uns Verwandte der Leute, bei denen wir unten im Tale gewohnt hatten, Unterkunft gewährten.
Die tiefsten Eindrücke, die ich auf dieser Flucht durch Norwegen gewonnen hatte, immer hinter den Linien unserer zurückweichenden Soldaten, boten die unglaubliche Schönheit unseres Landes und die unvergleichliche Güte und Hilfsbereitschaft jedes einzelnen Menschen, dem wir begegneten.
Täglich erschienen deutsche Flieger über Dovre und bombardierten den Bahnhof und die Eisenbahnbrücke von Talleraas, allerdings ohne zu treffen. Während - wir, das heißt ein junger Knecht, ein älterer Mann und ich, vom Hügel hinter dem Hofe aus, auf dem ich momentan lebte, ein Luftgefecht über Dombaas beobachteten, raste ein Flieger ganz tief über die Wiese daher und begann auf uns zu schießen. Glücklicherweise schlugen die Kugeln in einer Entfernung von zwei oder drei Meter vor uns ein, so daß keiner von uns verletzt wurde. Daraufhin suchten wir schleunigst Zuflucht in dem steinernen St? 11 des Hofes.
Von Zeit zu Zeit pflegten die Deutschen eine Ladung von Brandbomben auf einen der Höfe hinabzuschleudern, aber soviel ich weiß, wurden die Häuser nirgends getroffen. Trotz allem schien es uns am sichersten tagsüber zu den kleinen Höfen hinaufzusteigen, die weiter oben an der Bergkuppe liegen. Immer wieder brachte uns die Bäuerin irgend etwas Gutes, Kaffee und fette Milch, Kuchen und frisch gebackene Waffeln. Ihre Milchkammer war leer. Falls es ganz schlimm werden sollte und die Deutschen nach Dovre kämen, hätte sie wenigstens die Genugtuung, daß ihre Landsleute im Hause alle guten Dinge bekommen hatten. Von einer Vergütung wollte sie nichts wissen.
Als wir eines Abends wieder bei Einbruch der Dunkelheit auf den Hof zurückkehrten, rückten Soldaten an. Diese jungen Burschen waren hinter die Front zurückgeschickt worden, als die Engländer die Verteidigung von Kvamsporten, dem engen Bergpaß, übernahmen. Sie sollten sich einige Tage ausruhen. Niemand hätte ahnen können, daß sie aus dem Krieg kämen, sie waren genau so wie alle jungen Norweger stille, gut erzogene, freundliche Jungen.
Einige der Soldaten erzählten widerstrebend, es sei erstaunlich, sie hätten Massen von jungen Deutschen im Maschinengewehrfeuer zusammenbrechen sehen, aber irgendwie schien es, dem Feind keinen Eindruck zu machen. Wahrscheinlich käme es davon, daß die Deutschen während des Vormarsches fürchterlich brüllten. Von anderer Seite hörte ich später dasselbe. Dieses Brüllen der Deutschen machte einen furchtbaren Eindruck auf unsere Soldaten. Diese waren schweigsam wie die Berge, wenn sie kämpften.
In Moide erschienen die norwegischen Zeitungen noch immer. Und so wurden wir aufgefordert, dorthin zu kommen. Von neuem mußten wir von Freunden Abschied nehmen, die uns Obdach und Nahrung gegeben hatten und nichts von uns annehmen wollten. Wieder saßen wir in einem überfüllten Wagen und fuhren nachts nach Dombaas, das in Trümmern lag, ins Roms-dal hinunter. Es dämmerte bereits, als der rote Feuerschein über dem nächtlichen Berspaß andeutete, daß wir uns Aandalsnes näherten. Während wir durch die kleine Stadt fuhren, standen zu beiden Seiten der Straße brennende Häuser. Und dann waren wir plötzlich mitten im Frühling — draußen beim Fjord, der wie glänzende, blaß-blaue Seide vor uns lag. Das letzte Abendrot und die ersten zartrosa Strahlen vor Sonnenaufgang spiegelten sich im Wasser. Wild schäumend stürzten die kleinen Bäche die Berghänge hinunter. Der Hof, der uns ffir einige Tage beherbergt, lag am äußersten Ende einer Landzunge draußen am Fjord. Der Bauer pflügte. Flugzeuge kreisten über der Gegend und oberhalb des Bergrückens deuteten kleine grauweiße Rauch wölkchen am lichtblauen Himmel darauf hin, daß die Abwehrgeschütze m Aandalsnes ihr Feuer noch nicht eingestellt hatten.
Eines Abends erfuhr man, daß die Engländer den Kampf im Süden von Norwegen aufgegeben und sich in Aandalsnes eingeschifft hatten. So war nun zu erwarten, daß die Deutschen durchs Romsdal heraufkommen würden. Das bedeutete, daß wir weiter fliehen mußten. Der Bauer schüttelte uns die Hand und sagte: „Wir werden uns wiedersehen!“
Wir warteten unten bei dem kleinen Anlegeplatz, wo der Schlepper, der uns aufnehmen sollte, Sanitätsmaterial für Moide an Bord nahm. Es war schon Mitternacht, als wir abfuhren. Düstere, sdiweigende Schatten lagen über dem Vorgebirge, an dem wir im Schutz der Küste entlang fuhren. Auch in dem Krankenhaus, bei dem wir anlegten, begegneten uns wieder Menschen, die uns aufnahmen, bewirteten und am folgenden Tag behilflich waren, ein Auto zu bekommen. Wir fuhren durch Moide, das vom Feuer zerstört war, und über Berge, wo noch immer tiefer Winter herrschte, dann an weiten Fjordarmen entlang und erreichten schließlich Bud, den entlegensten Punkt des Romsdales.
In einem der Außenhäfen von Hustad-viken gingen wir wieder an Bord des einen der beiden Schlepper, die nach Norden fuhren. Sie waren voll Soldaten und mit Munition und Kanonen beladen, die sie gerettet hatten, als sich unsere Truppen im Süden Norwegens hatten ergeben müssen. Jetzt wollten sie im Norden, wo unser Land noch frei war, den Kampf fortsetzen. Der Schlepper, mit dem wir fuhren, hatte Schlafstellen für sechs Personen und wir waren sechsunddreißig. Wir fuhren immer nachts. Tagsüber lagen wir in einem Außenhafen zwischen entlegenen Inseln versteckt. Ein freundlicher Soldat bot mir seinen Schlafsack an. Jeden Abend richtete er ihn frisch her und half mir hinein. Es war hart und kalt, aber gemütlich draußen am Deck zu schlafen. Wir segelten weiter zwischen Nordlands schneebedeckter Bergkette und den wie phantastischen Skulpturen geformten Inseln.
Als wir vier Stunden von Bodo entfernt waren, erfuhren wir, daß es höchst fraglich sei, ob Zivilpersonen die Erlaubnis bekommen würden, an Land zu gehen. Und wenn wir nach Tromsö wollten, müßten wir den Weg über die entferntesten Lofoteninseln nehmen, weil der Westfjord voller Minen war. Hingegen konnten wir, mit einem Schlepper in Mo nach Rana zurückkehren. Von dort sollte es möglich sein, auf dem Landweg nach Schweden zu gelangen. Ich wählte den letzteren Weg.
Der letzte Teil der Reise von Mo bis über die Grenze war der schlimmste. Im Laufe des Nachmittags fuhren wir awf einem Lastwagen los. Infolge der Schneeschmelze waren lange Strecken beinahe unbefahrbar. Krampfhaft an unsere Sitze geklammert, sausten wir auf und nieder, wurden von links nach rechts geschleudert. Wir konnten in jener Nacht nur zehn bis zwanzig Kilometer zurücklegen. In der Berghütte, wo wir übernachteten, wurden wir wieder herzlich aufgenommen. Es wohnten dort nur Straßenarbeiter, die uns jedoch ihre Schlafstellen abtraten. Am nächsten Morgen, gegen vier Uhr, setzten wir unsere Reise zu Fuß fort Unterwegs nahmen uns einige Autos mit, soweit ihr Benzin reichte. Zum Schluß hatten wir bis zum letzten Hof vor der Grenze noch einen vierzig Kilometer langen Skimarsch über den Berg zu bewältigen. Als die andern sahen, wie schwer es mir fiel, auf den Skiern mitzukommen — seit zwanzig Jahren hatte ich nicht mehr auf Skiern gestanden —, setzten sie mich auf einen Schlitten. Von sechs jungen Männern gezogen, erreichten wir endlich den Hof an der schwedischen Grenze.“