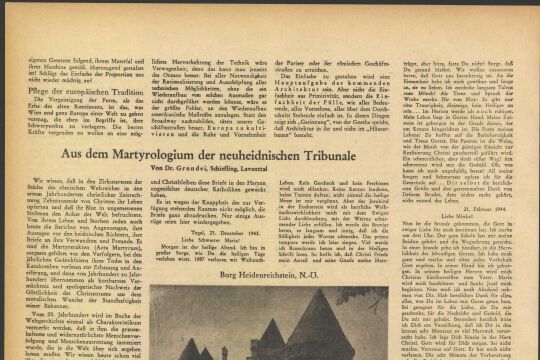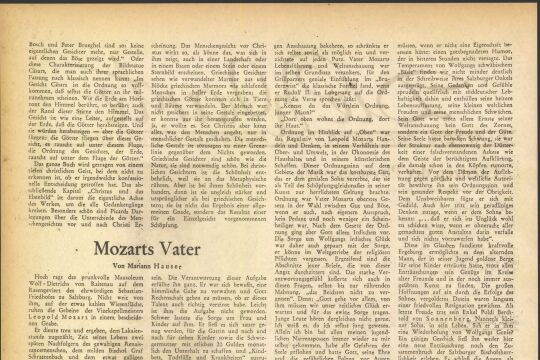Es gibt Menschen, die eine Zuflucht darstellen. — Sie sind eine Jener Seelen, denen ich mich anvertrauen kann, wie einem guten Priester ... (Bernanos an Jorge de Lima)
Die deutsche Sprache hat kein besonderes Wort für das lateinische oder italienische „palma“, womit das Innere der Hand, die Handfläche gemeint ist. Ein italienischer Jugendfreund, der um mein Heimweh nach dem Süden wußte, sandte mir einmal in einem Brief aus Sizilien ein getrocknetes Büschel Origone und schrieb dazu: „Du mußt dieses Kraut mit dem Finger im Handinneren — nella palma delia mano — zermalmen, um ihm seinen Duft entströmen zu lassen.“ Aus der palma, diesem Inneren, diesem Geheimen unserer Hand, fließen auch die Worte unserer Briefe; deshalb kann man Briefe trinken, schluckweise austrinken. Auf Grund solcher „gesonderten“ menschlichen Beziehungen besitzt nach Hofmannsthal „der eine in dem anderen Ländereien, Landschaften, Gärten“. Immer brauchen wir Außenlebenden dieses „Innen“, das wir in der Freundschaft, in der Liebe, in der Kunst und im Glauben finden.
Jener Apriltag, an dem ich das besagte Schreiben erhielt, trug meinem Tagebuch ein kleines Gedicht ein, das in der Stille des Botanischen Gartens entstanden ist: „Ich kam hie-her, um einen Brief zu lesen ...“ Das Blatt, das ich in Händen hielt, war einer jener Briefe, die man zunächst nicht öffnet, die man, einer guten Stunde entgegensehend, im Inneren des Kleides verwahrt, um sie dann — wie Kafka sagt — auszubreiten und das Gesicht hineinzulegen.
„Wir sind uns in Briefen näher“, schreibt F. Th. Csokor, der „Zeuge einer Zeit'1, aus dem Exil an seine Mutter, und — an eine Freundin gerichtet — heißt es im selben Briefband: „Meine liebe..., aus drei Briefen kennen wir beide uns heute, als hätten wir schon Jahre durch im Wiener Cafe Herrenhof am Literatentisch gesessen.“
Briefe als die unmittelbarste Spiegelung des menschlichen Wesens haben ihren ergiebigsten Nährboden in der Liebe und Freundschaft. Im literarischen Bereich kommt ihnen gegenüber anderen Werken die vorzügliche Eigenschaft zu, daß sie, von Mensch zu Mensch gerichtet, für die Kenntnis des Wesens der Autoren unentbehrlich sind, daß sie keiner Bändigung durch die Gesetze der Dichtkunst, keiner literarischen Technik unterliegen. Sie beschränken sich meist auf das einfach und schlicht Gesagte, verzichten auf Pathos ebenso wie auf die Vorsicht der Diskretion und sind als Kunstwerke nur mit dem Herzen, niemals mit Kritik erreichbar. In dieser Begrenzung und Harmonie mag das Glückhafte solcher Briefe liegen; aber — so sagt Stephan Zweig — „in keinem Alter schreibt man ungestraft feurige Briefe“. Die sinnvolle Wendung „Ich schlage eine — meist recht schlichte — Melodie an, Sie geben die höheren Oktaven dazu“, enthält ein Brief Siegmund Freuds an Lou Andreas-Salome.
„Geronnene Gespräche“ nennt Richard Alewyn manche Briefe Hugo von Hofmannsthals, der dabei nicht nur in der Sache, sogar im Tonfall auf sein Gegenüber eingehe, so daß aus seinen Briefen in wunderbarer Weise das Portrait des Empfängers heraufsteige. Auch ein kurzer Brief, wie ihn Hofmannsthal verstand, spricht zuweilen den ganzen Menschen aus, „gibt dem Empfänger das ganze Gefühl einer wesenhaften Gegenwart, unverlierbar, solange nicht der Tod dazwischentritt, nein unverlierbar auch über den Tod hinaus“, heißt es in Hofmannsthals Briefwechsel mit Helene von Nostitz.
Das tägliche Sendschreiben Goethes an Charlotte von Stein, das Sendschreiben eines Liebenden an die Freundin, beinhaltet neben Wesentlichstem oft nur wenige Worte, einen kurzen Gruß. Vor das titanisch-unbegrenzte Wallen des Prometheusdichters stellt sich angesichts dieser Frauengestalt die Erkenntnis der Maße und Grenzen des Menschlichen. „Die Pfirschen sollen Dich begrüßen und ihr guter Geschmack Dich erinnern, daß ich Dich liebe. Leb wohl, meine beste, und erhalte mir mein kostbaarstes.“ Diese einfachen Worte wirken — ich wage das Paradoxon — in ihrer Echtheit und Lebenswärme geradezu dilettantisch, nämlich dilettantisch im Sinne Egon Friedells, der in seiner „Kulturgeschichte der Neuzeit“ sagt, daß nur der Dilettant, der mit Recht auch Liebhaber, Amateur genannt wird, eine wirklich menschliche Beziehung zu seinen Gegenständen habe, und darum ströme bei ihm der ganze Mensch in seine Tätigkeit und sättige sie mit seinem ganzen Wesen.
Goethes Briefe an Frau von Stein finden ein schwaches Jahrhundert später in den schlichten, tiefen Herztönen eines Soldaten, in der Seelenhoheit eines Monarchen ein wundersames Pendant: in den Briefen des oft verkannten Menschen Franz Joseph an Katharina von Schratt. Mit einem Bewun-derungs- und Dankschreiben, „das ein Smaragdring begleitete, begann ein Briefwechsel, der dreißig Jahre währen sollte“, schreibt der Herausgeber Jean de Bourgoing. In diesen wie ein Bilderbuch abrollenden Zeugnissen höchster Verehrungswürdigkeit manifestiert sich das Wesen dieses im Grunde so gütigen, bescheidenen und vom Schicksal so heimgesuchten letzten wahren Souveräns. Franz Joseph schreibt am 11. Juni 1892 an seine „theuerste Freundin“: „...Meine Sehnsucht, Sie wieder zu sehen, und der Wunsch, keinen der wenigen Tage zu versäumen, welche Sie noch in der Gloriette Gasse zubringen, ist so lebhaft, daß ich Sie, mit Ihrer Erlaubnis, doch Morgen Früh um X8 Uhr besuchen möchte. In dieser Absicht bestärkt mich Ihre gütige Frage und Aufopferung von Heute Früh und das Zureden der Kaiserin, die auf meine Gesellschaft bei ihrem Frühstück verzichtet.“
Eine eigene Position innerhalb seines Oeuvres nehmen die Briefe Rilkes ein. Sie sind kostbar, weil sie nicht nur wie Handschriften alter, ehrwürdiger Mönche geschrieben und beinahe typographisch arrangiert sind, sondern weil sie, genaugenommen, öffentlich sind, weil Rilke wußte, daß sie mehr seien als „Briefe“. „In ihnen ist Privates und scheinbar Zufälliges in den Bezug zu Bedeutendem getreten... Sie zeigen mit ihrer Gebärde, daß ein Dichter sie geschrieben hat und bezeichnen zugleich den Standort des Dichters in der Welt.“ Ulrich Keyn hat 1947 eine bis dahin unveröffentlichte „Handvoll Briefe“ unter dem Titel „An eine Reisegefährtin“ herausgegeben, von denen er jene aus Soglio (Bergell), dem Stammhaus der Salis, als die schönsten bezeichnet, die Rilke geschrieben hat. Sie wurden vom Postpferd „Phöbus“ mit Kalesche und Postillion ans Tal befördert. „... Da bin ich recht in meinem Element, es gruselt rund ums Herz herum, und soviel Unsichtbares drängt (vermuthlich) danach, wahrgenommen zu werden, daß man die schöne Rundheit der eigenen Augäpfel fühlt, die wahrscheinlich auch mit ihrer anderen Hemisphäre zu sehen vermöchten, wenn man sie nur recht sorglos gewähren ließe ...“ Dieser Briefwechsel mit der „chere patronne“, der „Schönen, Gütigen“, der „liebenswürdigsten Freundin“ kreist um die Möglichkeit eines Wiedersehens nach der ersten Begegnung im D-Zug Lindau— München im Jahre 1919. Bei Rilke, dem „dichterisch Lebenden“, dem „innen Stehenden“ müsse die Begebenheit zurückbleiben hinter dem Geheimen, das er in den Worten aufbewahrte, mit denen er sie beschrieb, sagte U. Keyn in seinen „Schilderungen an Hand unveröffentlichter Briefe des Dichters“.
Einem gütigen Geschick verdankt die Nachwelt die Erhaltung der von virtuoser Heiterkeit und goldener Herzenswärme strahlenden Briefe Mozarts, jener Dokumente, in denen sich der Lebensrhythmus eines Menschen offenbart, dessen Werk im musikalischen Theater gipfelt. ,;Ma tres chere soeur!“, schreibt er seiner Schwester Nannerl zu ihrer Hochzeit am 18. August 1784, „Potz Sapperment! — Itzt ist es an der Zeit, daß ich schreibe, wenn ich will, daß Dich mein Brief noch als eine Vestalin antreffen soll! — Ein paar Tage später — und — weg ist's. Am Schluß der Gratulation folgt aus seinem „poetischen Hirnkasten ein kleiner Rat“ in Gedichtform, mit dem liebenswürdig-übermütigen Schluß:
.....Drum wenn Dein Mann Dir finstre Mienen, / die Du nicht glaubest zu verdienen, / in seiner üblen Laune macht: / So denke: das ist Männergrille, / und sag: Herr, es gescheh Dein Wille / bei Tag — und meiner in der Nacht. Dein aufrichtiger Bruder W. A. Mozart.“
Liebe und Freundschaft: immer sind es dieselben Motive, die uns die Feder in die Hand drücken, und doch, welch gewaltiger Gegensatz in Betrachtung und Auffassung der Dinge resultiert aus der Unterschiedlichkeit der menschlichen Temperamente.
„ ... Sie klagen über manche meiner Briefe, man dreht sie nach allen Seiten und es fällt nichts heraus, aber doch sind das, wenn ich nicht irre, gerade jene, in denen ich Ihnen so nahe war, so gebändigt im Blut, so bändigend Ihres, so tief im Wald, so ruhend in Ruhe...“ Wer anders als Franz Kafka könnte diese Zeilen geschrieben haben! Seltsam, dunkel und tief menschlich wie sein ganzes Werk, das in die Essenz unserer Zeit eingegangen ist, sind Kafkas „Briefe an Milena“ und als zentralstes seiner Werke der „Brief an den Vater“. Bei Kafka heißt Briefe schreiben „sich vor Gespenstern entblößen, worauf sie gierig warten. Geschriebene Küsse kommen nicht an ihren Ort, sondern werden von den Gespenstern auf dem Weg ausgetrunken“. Alle Dinge dieser Welt stellt er in Frage, versetzt alles Klare ins Rätselhafte, deutet das Unaussprechliche durch Parabeln, so auch seine und Mile-nas Liebe: „Manchmal habe ich den Eindruck, wir hätten ein Zimmer mit zwei gegenüberliegenden Türen und jeder hält die Klinke einer Tür und ein Wimperzucken des einen, schon ist der andere hinter seiner Tür...“ Franz Kafka hat vor Milena wahrlich die Geheimkammern seines Innersten geöffnet und sich in seinen Briefen entblößt, wie kaum ein anderer zuvor, es sei denn Rousseau in seinen Bekenntnissen, die mit einem Anklang an die entsiegelten Lefoensbücher des Jüngsten Gerichts beginnen. — „Schmutzig bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei mit der Reinheit! Niemand singt so rein als die, welche in der tiefsten Hölle sind; was wir für den Gesang der Engel halten, ist ihr Gesang.“
Die Bedeutung des Briefes als Nachernte des Lebens, Reliquie des Alters, Vorrat von Vergangenheit und Erinnerung veranschaulicht Marcel Proust in der Erzählung von dem alten Hauptmann, der am Abend seiner Tage alle Bücher zurückweist, weil sie ihm nichts sagen können, was ebenso interessant wäre wie seine Erlebnisse. Und so läßt sich der alte Mann den Schlüssel zur großen Truhe reichen, der er ein Meer von Briefen entnimmt, sehr lange, aber auch einzeilige, auf eine Karte geschriebene, manche mit verwelkten Blumen, mit Andenken und Anmerkungen von seiner eigenen Hand versehen. „Und es gab in all diesen Dingen winzige, aber scharf umrissene Zeichen von Sinnlichkeit und Zärtlichkeit, die sich auf ein Fast-Nichts in seinem Leben mit seinen Nebenumständen bezogen, es war wie ein weitläufiges Fresko, das sein Leben abschilderte, ohne es zu erzählen, bloß in seiner tiefglühenden Farbe, in seiner sehr unbestimmten und gleichzeitig sehr eigenen Art — und vor allem mit einer ergreifenden Gewalt.“
So kommt auch Schnitzlers Anatol mit einem Bündel von Briefen zu seinem Freund: „Hier bringe ich Dir meine Vergangenheit... Jedes Päckchen trägt irgendeine Aufschrift: einen Vers, ein Wort, eine Bemerkung, die mir das ganze Erlebnis in die Erinnerung zurückrufen ...“
Unentrinnbar verbinden uns Briefe, dieser stille Austausch von Hineinlegen und Herauslesen unserer Gedanken, mit dem, was einmal war.
Man spricht von Briefen des Schicksals und meint auch Zeugung von Schicksal. — Bücher haben ihre Geschicke — und Geschicke haben ihre Briefe.