
Über das Sterben eines Genies.
Am 18. Februar 1564 starb in Rom, in einem ärmlichen Haus am Macello de'corvi, der fast neunzigjährige Florentiner Bildhauer, Baumeister und Maler Michelangelo Buonarotti — der „göttliche Michelangelo“, wie ihn schon seine Zeitgenossen nannten. — Briefe, Notizen und Gedichte von Michelangelo aus früheren Jahren, Briefe von Augenzeugen seines Sterbens sowie das Inventar, das nach dem Tod in seinem Hause aufgenommen wurde, ermöglichen einen Versuch, die Szenerie ungefähr nachzuzeichnen, vor der Michelangelos irdisches Leben zu Ende ging, und uns zu vergegenwärtigen, was für die in seinen letzten Tagen und Stunden versammelten Freunde, vor genau 400 Jahren, leid-voll-unvergeßliche Gegenwart war.
Nichts an dieser Szenerie und keine der Szenen, die sich damals im Hause Michelangelos zutrugen, hätte erkennen lassen, daß der, der während der letzten 30 Jahre seines Lebens hier gewohnt und gearbeitet hatte, der am meisten gepriesene und verehrte Künstler seiner Zeit war. Allein in Rom selbst, ein paar kurze Wegstrecken vom Macello de'corvi entfernt, verkündeten Werke aus fast allen Jahrzehnten seines Schaffens den Ruhm des Meisters: Fürsten und Künstler, Fremde und das Volk von Rom bewunderten seine vatikanische Pietà und seinen Moses in S. Pietro in vincoli, seine Deckengemälde und sein Fresko des Jüngsten Gerichts in der Sixtinischen Kapelle und den riesigen Neubau von St. Peter, dessen herrliche, himmelanstrebende Kuppel der greise Michelangelo freilich nur mehr in Plänen und Modellen vorausbestimmen, jedoch nicht mehr selbst errichten konnte. Er aber, der dies alles und vieles andere vollbracht hatte, lebte und starb nicht in einem prächtigen Stadtpalast in einer römischen Nobelstraße wie Bramante oder Raffael.
*
In "Macel de'poveri“ wandelte Michelangelo einmal im Scherz den Namen „Macello de'corvi“, und wie es in diesem Arme-Leute-Viertel aussah, in dem er wohnte, zeigt uns ein. Kupferstich von 1575, in dem Etienne du Perâc die Trajanssäule und die sie umgebenden Häuser abgebildet hat. Auf diesem Blatt sieht man das Wohn- und Sterbehaus Michelangelos zwischen der damals noch nicht ganz vollendeten Kuppelkirche von Santa Maria di Loreto und der Trajanssäule, deren Sockelbau inmitten eines von Papst Paul III. angeordneten Ausgrabungsschachtes 1535 freigelegt worden war. Mit seiner Umgebung hatte dieses Haus die schmucklose Kargheit und den fast militanten Ernst der mittelalterlichen Profanbauten Roms gemeinsam — eine bescheidene Auszeichnung erfuhr es durch eine vorgelagerte, sehr einfache Loggia, durch einen niedrigen Turm mit Dachterrasse (offenbar war es ein alter Wehrbau) und durch einen kleinen Garten. Wenn diese Szenerie von Etienne du Perâcs historischem Interesse an der Trajanssäule einen Hauch von Monumentalität erhält, so wird dies von Michelangelo selbst sarkastisch korrigiert in einem Gedicht, in dem er voll bitteren Hohnes, den Platz vor seiner Tür als öffentliche Latrine und als Misthaufen voll Kot, Aas und Unrat aus der ganzen Umgebung schildert...
Zum Glück ist uns der kleine Garten seines Hauses durch einen Brief seines Freundes, Bartolommeo Angiolini, als ein winziges Paradies vorstellbar, darin Lorbeer und Granatäpfel, Wein und Feigen wachsen und nicht nur die diebischen Elstern, sondern auch ein prächtiger Hahn mit seinen Hennen und ein paar Katzen als Michelangelos erklärte Lieblinge es sich gut sein ließen. Und wenn uns auch nichts dergleichen überliefert ist, so dürfen wir doch glauben, daß der für antike Bildwerke immer begeisterte Bildhauer Michelangelo auch am Ende seiner Tage sich nicht sattsehen konnte an der Trajanssäule, wenn ihr schlanker, sonnenbeglänzter Schaft vor seinen Fenstern die marmorweißen Reliefbilder in den leuchtendblauen römischen Himmel hob ...
Die einzige auf uns gekommene Erwähnung, daß Michelangelo sich in seinen letzten Lebenstagen vor seinem Haus im Freien aufgehalten hätte, spricht freilich nicht von der Traianssäule: Am 14. Februar schreibt Tiberio Calcagni. ein Schüler Michelangelos, an dessen Neffen Lionardo Buonarotti in Florenz, er komme gerade von Michelangelo, den er vor seinem Hause, im Regen, elend aussehend, auf- und abgehend angetroffen hätte; auf Calcagnis Bitte, doch lieber ins Haus zu gehen, habe der Meister mit abgerissenen Worten geantwortet, was er den tun solle — es gehe ihm schlecht und er fände nirgends Ruhe.
Das Innere des Hauses, das der Kranke an jenem 14. Februar abends zum letztenmal aufsuchte, ist uns nicht nur als ergreifendes Ambiente eines in Dürftigkeit und Einsamkeit verbrachten Greisenalters, sondern auch als Stätte des alles andere verdrängenden Gedankens an Gott. Tod und Jenseits überliefert. Wenn wir aus einem früheren Dokument wissen, daß Michelangelo über den Treppenaufgang ein Skelett mit einem Sarg gemalt und ein paar Verse darunter geschrieben hatte, die einem mittelalterlichen Totentanz hätten entnommen sein können, so sprechen die Gedichte, die er in diesem Haus in den letzten Jahren geschrieben hatte, in Michelangelos ureigenster Sprache von seiner Weltmüdigkeit, von seiner Todessehnsucht und seiner allmählich alles andere verdrängenden, größten Sehnsucht nach' der Vereinigung mit Gott in Seiner erbarmenden Liebe. Wie im Selbstgespräch gestammelte Gedichte sind auch seine letzten bildkünstlerischen Schöpfungen, unvollendete Marmorbildwerke und Zeichnungen, die für keines andern Augen bestimmt zu sein scheinen und die erst ans Licht kommen, als man am 19. Februar ein Verzeichnis seiner Hinterlassenschaft anfertigt; aber folgen wir zunächst diesem Inventar, das uns mit dem Interieur und den Habseligkeiten Michelangelos bekanntmacht.
Der größte Raum zu ebener Erde war seine Bildhauerwerkstätte; ein Stall schloß sich daran — aber längst stand nicht mehr das edle arabische Pferd darin, das er von einem Gönner einmal zum Geschenk erhalten und so gerne gehabt hatte; denn der von mancherlei Übeln Geplagte konnte kein Reitpferd mehr besteigen. Nur ein kleines Pony, zottig und kastanienbraun, wird bei der Inventaraufnahme im Stall gefunden, es hatte bis vor wenigen Wochen Michelangelo den für seine Füße schon viel zu beschwerlichen Weg zum Bauplatz von St. Peter getragen. Wir erfahren ferner, daß ein paar große Steinkrüge im sonst leeren Keller keinen Wein, sondern nur Trinkwasser enthielten — und wir wissen doch aus Dankbriefen des Meisters an Spender von Wein und Leckerbissen, was für eine Freude ihm dergleichen bereiten konnte. Wir hören, daß von vermutlich einigen Zimmern in dem verwinkelten und nach der Verwüstung im Sacco di Roma nur notdürftig instandgesetzten Hause bloß zwei bewohnt waren: Michelangelos treuer Diener Antonio del Francese bewohnte das eine, das andere er selbst. Darin stand ein ärmliches Eisenbett mit schäbigen Matratzen, schlechten Decken und einem weißleinernen Betthimmel, ein schmaler Kasten, der alles enthielt, was Michelangelo an Kleidern und Wäsche, an Tisch- und Bettzeug besessen hatte, eine Truhe mit Zeichnungen, Schriften und ein paar tausend Dukaten und schließlich ein alter Lehnstuhl neben dem Kamin. Dieses Zimmer — es wird nicht sehr sauber gewesen sein, und die Spinnen, die darin ihre Netze zogen, hatte Michelangelo, der große Tierfreund, in einem Gedicht früherer Jahre fast liebevoll erwähnt. — Dieses Zimmer und die Bildhauerwerkstätte sind nun der Schauplatz dessen, was wir von den letzten Tagen des Meisters wissen.
Die erste Szene spielt am 12. Februar in der Werkstätte: Einer der Freunde und Schüler, Daniele da Volterra, findet Michelangelo mit der Arbeit an einer schon vor etwa zehn Jahren begonnenen und unvollendet gebliebenen Marmorgruppe beschäftigt, einer Darstellung Marias mit dem toten Christus, die nach ihrem späteren Besitzer den Namen „Rondanini-Pietà“ erhalten sollte. Den ganzen Tag hatte der fast Neunzigjährige stehend gearbeitet — und von diesem seinem letzten Arbeitstag trägt die Rondanini-Pietà die Spuren der Meißelhiebe und Hammerschläge, die dem Bildwerk in einer tiefgreifenden, manche vollendete Einzelheit wieder zerstörenden Umgestaltung die äußerste Entrückung aus allem Irdischen geben sollten; wohl nur ein selbst schon an der Schwelle zum Jenseits Stehender vermochte mit seiner vom Tod gezeichneten Hand Formen aus dem Stein zu holen, die nicht mehr von dieser Welt sind und uns nur als ergreifendes Gleichnis eines aus abgestreifter Erdenschwere aufsteigenden Gebets erscheinen können. — Wir wollen aber über diesem kostbarsten, aus Michelangelos letzten Lebenstagen uns überkommenen Relikt nicht ein unscheinbares, fast banales Requisit vergessen, einen unscheinbaren Zeugen eines zu Ende gehenden Künstlerlebens: Irgendwo unter den Marmorsplittern der Rondanini-Pietà lag an jenem Abend des 12. Februar wohl auch ein Papierhelm, in dem obenauf eine Kerze aus Ziegentalg steckte; Michelangelo, von Schlaflosigkeit und von der Angst gequält, seine Lebenszeit reiche nicht mehr aus für die Verwirklichung seiner letzten schöpferischen Gedanken, hatte sich diesen Kerzenhelm verfertigt, der ihm für seine Arbeit in ruhelosen Nächten die richtige Beleuchtung gab und ihm die Hände frei ließ für Meißel und Hammer.
Die Erschöpfung nach dieser letzten Arbeit an der Rondanini-Pietà läßt Michelangelo den nächsten Tag vergessen, daß Sonntag ist — sein Diener muß ihn, der sonst nie die Sonntagsmesse bei Santi Apostoli versäumte, erst daran erinnern. Am Montag, es ist der Montag des Karnevals, kommt es zu jener Szene vor dem Haus, im Regen, der wir schon gedacht haben. Was nun folgt, spielt sich nur mehr zwischen dem Lehnstuhl am Kamin, in dem Michelangelo sich noch am wohlsten fühlt, und dem Bett ab, das der Kranke meidet, so lange es nur angeht... Aber er ist von nun an nicht mehr allein: zwei Ärzte, Federigo Donati und Gherardo Fidelissimi, bemühen sich mit seinem treuen Diener Antonio Francese um ihn, Diomede Leoni ist da und Tommaso Cavalieri, seit langem der liebste seiner Freunde; und auch der Freund und Schüler Daniele da Volterra erfüllt getreulich die uns im Wortlaut überlieferte, rührende Bitte des Kranken: „Daniello, nimm dich meiner an, geh nicht mehr fort!“
Am Dienstag, den 15. Februar, beginnt Michelangelos fiebrige Unruhe, die ihn sogar noch an einen Ausritt in das schöne Wetter draußen hatte denken lassen, auszuklingen in jene Ruhe, in die er, der immer Ruhelose, bald heimkehren sollte. Vom nächsten Tag hören wir sein Testament — ein paar Worte nur, mit denen er seine Seele den Händen Gottes, seinen Leib der Erde von Florenz und sein Hab und Gut seinen nächsten Verwandten überantwortet — und schließlich seine letzte Bitte an seine Freunde, daß sie ihn im Sterben an das Leiden und Sterben Christi erinnern sollten; vom Donnerstag fehlen briefliche Nachrichten — vielleicht empfing der Kranke an diesem Tag die letzte Ölung. Am 18. Februar, Freitag vor dem Sonntag Invocabit, um die Zeit des Ave-Läutens, starb Michelangelo — er starb, wie es in einem Briefe des Daniele da Volterra heißt, „so heiter und fromm, wie keiner je aus diesem Leben schied“.
Es ist uns nicht überliefert, ob der Himmel über Rom in Michelangelos Sterbestunde von jenem unbeschreiblich schönen Licht erfüllt war, das der Sonnenuntergang so oft über die Stadt Rom und ihre Hügel breitet und alles zu unirdischen Wirkungen verwandelt; wenn es so war, so könnte es den Freunden des Toten als ein Abbild von „des verheiß'nen Leuchtens künftger Dauer“ erschienen sein, nach dem Michelangelo in einem von Sehnsucht nach dem Jenseits erfüllten Gedicht einst verlangt hatte:
Ich macht' ins Ungewollte, Herr, mich fügen; / ein eis'ger Schleier trennt mein Herz vom Licht / und löscht die Glut; und was ich schrieb, paßt nicht / zu meinem Tun und straft die Blätter Lügen.
Ich lieb' mit Worten Dich und muß mich rügen, / daß Lieb' ans Herz nicht rührt, daß ich nicht schlicht / mich auftu' Deiner Gnade, welche bricht / ins Herz, dem Hochmut nicht mehr kann genügen.
Zerreiß den Schleier, Herr, zerbrich die Mauer, / die uns mit hartem Stein vom Glänze trennt / des Lichts, das dieser Welt erlischt und schwindet!
Send' des verheiß'nen Leuchtens künft'ge Dauer / Du Deiner schönen Braut, daß mir entbrennt / das Herz und ohne Furcht nur Dich empfindet.
Deutsch von H. Hinderberger

















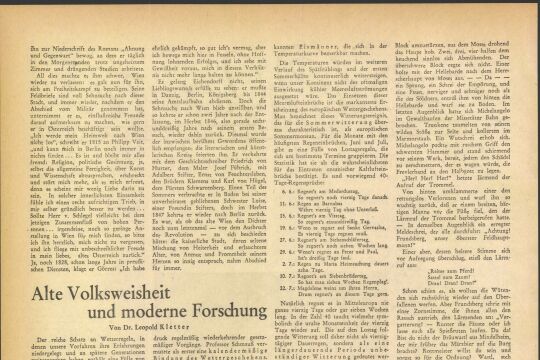
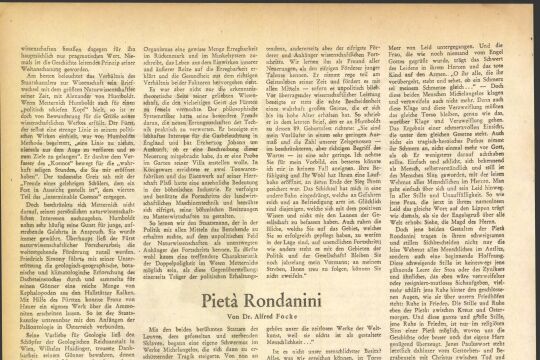




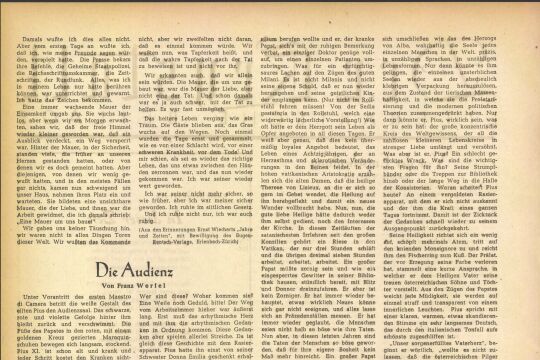






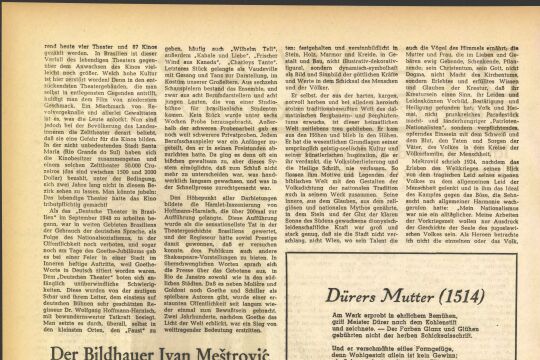




































































.png)
