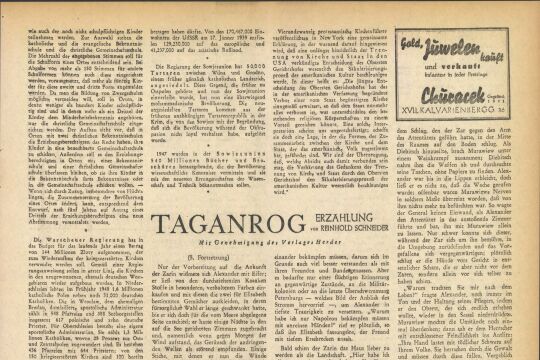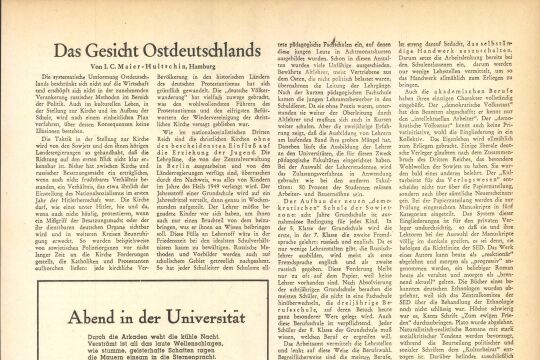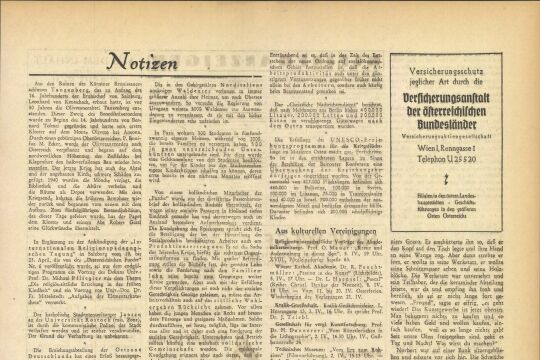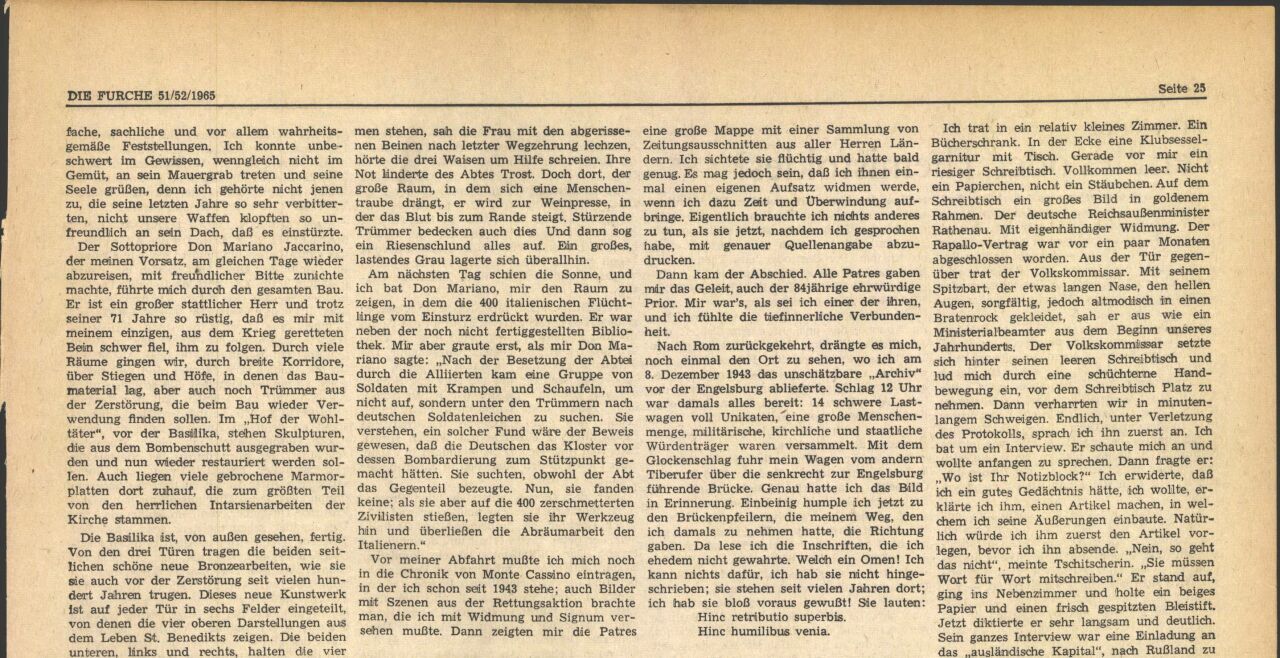
Dieser Artikel erschien am 10. August 1957. Unheimliche Szene: Begegnungen unseres inzwischen verstorbenen und unersetzlich gebliebenen Rußlandbearbeiters Nikolaus Basseches mit dem Bourgeois-Revolutionär Tschi-tscherin, einem der vielen, die Stalins Ungnade einen einsamen Tod hat sterben lassen.
Der verantwortliche Leiter der russischen Außenpolitik in der heroischen Zeit der bolschewistischen Revolution, Tschitscherin, war eine interessante Persönlichkeit. Er gehörte einem der ältesten und vornehmsten Adelsgeschlechter des Kaiserreiches an. So alt und so vornehm, daß sie die durch Peter den Großen eingeführte Verleihung westeuropäischer Adelstitel ablehnten. Nach der russischen Adelsordnung rangierten die alten Moskauer Bojarengeschlechter vor den ältesten Fürstengeschlechtern. Der Bolschewik und Revolutionär Georgij Wassiljewitsch Tschitscherin war mit dem höchsten Adel Rußlands und Europas verwandt und verschwägert. Der Onkel war Oberstkämmerer des letzten Zaren, die Tante Obersthofmeisterin der Zarin. Einer der österreichischen Gesandten in Moskau, sonst ein harmloser und netter Mensch, war sehr stolz auf einen relativ jungen Dienstadel. Tschitscherin fragte ihn einmal bei einem Essen: „Herr Minister, wie geht es eigentlich dem Fürsten Thun?“ So weit in die Hocharistokratie reichten die persönlichen Beziehungen des republikanischen Gesandten nicht. Auf seinen verständnislosen Blick fügte Tschitscherin hinzu: „Er ist nämlich ein ziemlich naher Verwandter von mir.“ Diese Eröffnung vernichtete bei dem Gesandten vollständig das Bild, das er sich vom kommunistischen Rußland gemacht hatte. v
Georgij Wassiljewitsch Tschitscherin, geboren am 20. November 1872 in Kaluga, hat trotz märchenhaftem Reichtum eine traurige Jugend gehabt. Sein Vater war kaiserlich-russischer Diplomat, ebenso die mütterlichen Vorfahren. Wassilij Tschitscherin, der Vater, war bereits in jungen Jahren wirklicher Staatsrat, Kammerherr des Zaren und erster Botschaftsrat in Paris. Seine Karriere wurde durch eine von ihm verweigerte Duellforderung jäh beendet. Er verkroch sich auf sein Stammgut und verließ es nicht mehr. Hier in dieser düsteren, schweigsamen, ewig von Leid und Ikonen erfüllten Atmosphäre des großen Herrenhauses wuchs der zukünftige Volkskommissar heran. Bis er auf eine jener glänzenden Schulen in St. Petersburg kam, die den Söhnen des höchsten Adels vorbehalten waren. Und von dort ins Ministerium des Äußeren. Man hat den Volkskommissar Tschitscherin nie lachen hören. Wenn er einmal lächelte, so war es verzerrt.
Schon als Student der kaiserlichen Rechtsakademie fand der junge Hocharistokrat zu illegalen revolutionären Gruppen, von denen er die marxistische wählte. Seine erste Stellung war im Archiv des Ministeriums des Äußeren. Hier vergrub sich der merkwürdige Mensch in Akten und Bücher. Wenn er seine krankhafte Schüchternheit überwand, und sich einem Menschen offenbarte, konnte man nur über sein Wissen und sein fabelhaftes Gedächtnis staunen. Er beherrschte mehr als ein halbes Dutzend Sprachen. Einmal hörte ich ihn zu meinem Erstaunen dem tschechischen diplomatischen Vertreter ein ganz altes
Volksepos aus dem Gedächtnis auf alttschechisch rezitieren.
Wiederholt hat er in späteren Gesprächen Artikel der „Times“, die vor 20 Jahren erschienen waren, aus dem Gedächtnis zitiert.
Später an die Botschaft in Berlin versetzt, kam heraus, daß der kaiserlich-russische Legationssekretär Tschitscherin Beziehungen zu sozialistischen Kreisen unterhielt. Darauf nahm er seinen Abschied. Er war ja sehr reich. Doch Tschitscherin gab sein ganzes Einkommen an die russische sozialdemokratische Partei ab. Er hauste in Berlin in einem bescheidenen Zimmer und lebte von journalistischer Arbeit und Übersetzungen. Er war nicht der einzige, welcher der Partei sein ganzes Vermögen opferte. Genauso handelte auch der durch eigene Hand gestorbene Adolf Joffe, der Sowjetdiplomat, der im Auftrage Lenins 1918 den Friedensvertrag von Bresit-Litowsk unterzeichnete und dann der erste Gesandte der Sowjets in Berlin war.
Trotz aller Opfer für die Partei, trotz seiner großen Erfolge als Außenminister war Tschitscherin von Mißtrauen umwittert. Wegen seiner Abstammung und weil er eine Zeitlang in der Emigration dem menschewi-stischen Flügel der russischen sozialistischen Partei zuneigte. Lenin hielt jedoch große Stücke auf ihn. Er setzte sogar seine Wahl ins Zentralkomitee durch. Doch als Stellvertreter gab man ihm Maxim Litwinow bei. Tschitscherin und Litwinow waren Antipoden. Wenn das Politbüro eine außenpolitische Entscheidung zu fällen hatte, dann wurde ein Referat von Tschitscherin bestellt, jedoch gleichzeitig ein Koreferat Litwinows. #
Tschitscherin schlief bei Tage und arbeitete bei Nacht. Das ganze ausländische diplomatische Korps mußte sich dem anpassen. Ich war also nicht erstaunt, als mir mitgeteilt wurde, meine Audienz beim Volkskommissar für Äußeres sei um 2.30 Uhr angesetzt.
Bis vor wenigen Jahren befand sich das Volkskommissariat für Äußeres in einem riesigen ehemaligen Wohnblock Ecke Kus-netzki Most und Lubjanka, die jetzt Dser-schinskistraße heißt. In den gegenüberliegenden Häusern dieser Straße befand sich di gefürchtete Geheimpolizei.
Als ich in tiefer dunkler Nacht am sogenannten Haupteingang eintraf, lag ei große Block vollkommen finster da. Nur ein halbes Stockwerk in der dritten Etage wai hell erleuchtet. Im Eingang schimmerte Licht Der uniformierte Posten stand von seinen-Schemel auf, prüfte meinen Ausweis. Vor oben her klangen gedämpfte Klänge eines Klaviers. Ich stieg langsam die halbdunkler Treppen hinauf. Die Musik wurde immei stärker hörbar. Jetzt erkannte ich auch, was gespielt wurde. Beethoven... Im dritter Stock stand die Tür weit offen... Helles Licht fiel in den dunklen Korridor. Die Musik Beethovens erklang jetzt machtvoll und stark. Meisterhaft gespielt. Im Sekretarial des Volkskommissars standen etwa vier Schreibtische. Doch nur zwei Sekretäre arbeiteten. Der eine erhob sich bei meinem Eintritt. „Der Korrespondent der .Neuen Freier Presse'?“ „Ja.“ „Sofort.“ Er verschwand durcl eine Tür. Das Klavierspiel brach jäh ab. Dei junge Sekretär erschien gleich wieder. „Dei Volkskommissar läßt bitten.“
Ich trat in ein relativ kleines Zimmer. Ein Bücherschrank. In der Ecke eine Klubsesselgarnitur mit Tisch. Gerade vor mir ein riesiger Schreibtisch. Vollkommen leer. Nicht ein Papierchen, nicht ein Stäubchen. Auf dem Schreibtisch ein großes Bild in goldenem Rahmen. Der deutsche Reichsaußenminister Rathenau. Mit eigenhändiger Widmung. Der Rapallo-Vertrag war vor ein paar Monaten abgeschlossen worden. Aus der Tür gegenüber trat der Volkskommissar. Mit seinem Spitzbart, der etwas langen Nase, den hellen Augen, sorgfältig, jedoch altmodisch in einen Bratenrock gekleidet, sah er aus wie ein Ministerialbeamter aus dem Beginn unseres Jahrhunderts. Der Volkskommissar setzte sich hinter seinen leeren Schreibtisch und lud mich durch eine schüchterne Handbewegung ein, vor dem Schreibtisch Platz zu nehmen. Dann verharrten wir in minutenlangem Schweigen. Endlich, unter Verletzung des Protokolls, sprach ich ihn zuerst an. Ich bat um ein Interview. Er schaute mich an und wollte anfangen zu sprechen. Dann fragte er: „Wo ist Ihr Notizblock?“ Ich erwiderte, daß ich ein gutes Gedächtnis hätte, ich wollte, erklärte ich ihm, einen Artikel machen, in welchem ich seine Äußerungen einbaute. Natürlich würde ich ihm zuerst den Artikel vorlegen, bevor ich ihn absende. „Nein, so geht das nicht“, meinte Tschitscherin. „Sie müssen Wort für Wort mitschreiben.“ Er stand auf, ging ins Nebenzimmer und holte ein beiges Papier und einen frisch gespitzten Bleistift. Jetzt diktierte er sehr langsam und deutlich. Sein ganzes Interview war eine Einladung an das „ausländische Kapital“, nach Rußland zu kommen, um die russischen Bodenreichtümer zu erschließen. Er wandte sich im besonderen an das „junge und wagemutige“ mitteleuropäische Kapital, damit meinte er die damals auf der Höhe ihres Erfolges stehenden Schieber Wiens und Berlins.
Am Ende taute der Volkskommissar etwas auf. Wir kamen in ein Gespräch über die politö/sdhe Weltlage. Als ich ging, begann einige Minuten später wieder das Klavierspiel. Tschitscherin spielte jetzt Mozart.
Das Interview erschien. Einige Zeit später war Alexander Moissi, der große Schauspieler, in Moskau. Ihm zu Ehren fand im Künstlerklub ein Bankett statt. Auch der Volkskommissar für Äußeres war anwesend. Er saß zwischen zwei schönen Frauen und fühlte sich höchst unbehaglich. Er schielte immer wieder zu mir, da ich so ziemlich am Ende der Tafel saß. Schließlich hielt er es nicht aus. Mitten im Essen stand er auf, ging die ganze Tafel herum und klopfte mich leicht auf die Schulter. Ich stand natürlich auf und folgte ihm in eine Ecke des Saales. Dort fragte er mich hastig: „Haben Sie schon etwas über die Wirkung meines Interviews gehört? Haben Castiglione oder Bösel sich dazu geäußert?“ Ich konnte nur verneinen.
Damals, also 1923, erwartete die Sowjetregierung viel von jenen „Pinanzgenies“. Sie traute sich selbst auf wirtschaftlichem Gebiet nicht allzuviel zu. Zehn Jahre später war es dann ganz anders. Und etwa zwölf Jahre später starb auch Tschitscherin. Allein und einsam. Nach 1928 begann seine Fronde. Er war mit der Stalinschen Außenpolitik nicht einverstanden. Die Fronde verstärkte sich noch, als Hitler in Deutschland zur Macht kam. Tschitscherin meinte, die sowjetische Außenpolitik solle trotzdem noch auf Deutschland setzen. Hitler werde schon Vernunft annehmen. Er war damals schwer zuckerkrank. Stalin pensionierte ihn. Sein Widersacher Litwinow wurde sein Nachfolger. Tschitscherin hauste in einer Wohnung auf dem Arbat. Das Auswärtige Amt sorgte für ihn. Täglich kam eine Frau und kochte. Von Zeit zu Zeit kam sein Arzt, wöchentlich einmal ein Tierarzt für seine Katze, das einzige Lebewesen, das er liebte. Er schlief wie immer bei Tage. Man erzählte, er schreibe an einem Buch über Mozart. Ich sah ihn noch zweimal. Einmal kam ich spät nachts von einem Empfang den Arbat herunter. Da sah ich in einen dunklen Schal bis zur Unkenntlichkeit verhüllt Tschitscherin stehen. Er unterhielt sich mit einem Nachtwächter. Das andere Mal kramte ich in einem Antiquariatsladen in der Nähe der Universität. Plötzlich tauchte Tschitscherin auf. Wieder in seinen dicken Schal gehüllt. Auch er wühlte in den alten Büchern. Ich begrüßte ihn. Er antwortete, doch ehe ich noch das Wort an ihn richten konnte, stahl er sich weg.
Dann, am 7. Juli 1936, starb Georgij Wassiljewitsch Tschitscherin. Uber den Tod des Außenministers, der mehr als 15 Jahre amtiert und die Sowjetunion nicht nur aus der weltpolitischen Isolierung herausgeführt hatte, sondern auch die Anerkennung der Sowjets durch die Großmächte erreichte, brachte die Sowjetpresse nur eine kurze Notiz.
In einem kleinen Saal des Auswärtigen Amtes wurde er aufgebahrt. So wie ein pensionierter Buchhalter eines Wirtschaftsunternehmens. Ein ischlechtes Blasorchester in bunten Hemden spielte Trauerweisen. Zwei seiner ehemaligen Mitarbeiter hielten kurze Reden. Litwinow kam für einige Minuten herein. Von der Regierung war sonst niemand anwesend. Auch niemand von der Parteiprominenz. Dann wurde der Sarg auf ein un-geschmücktes Lastauto gehoben. Unbegleitet, strebte das Auto eiligst dem Friedhof zu..