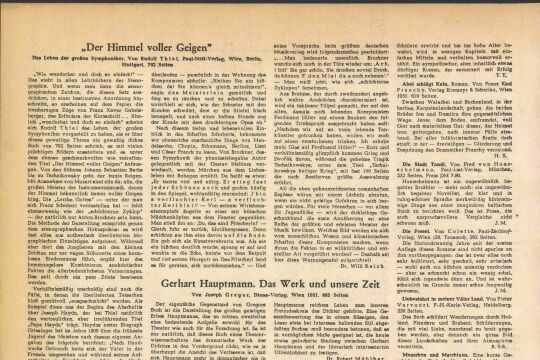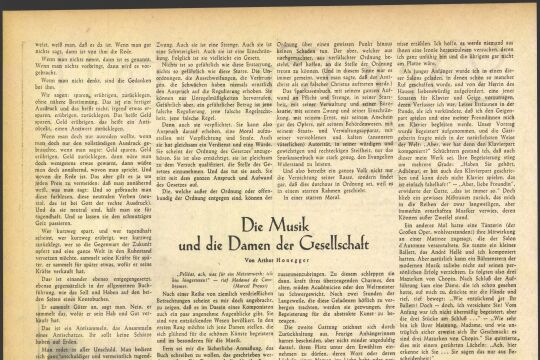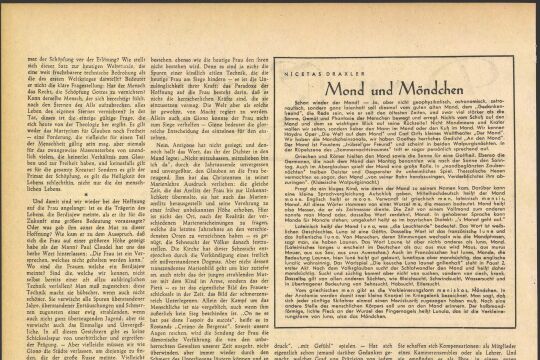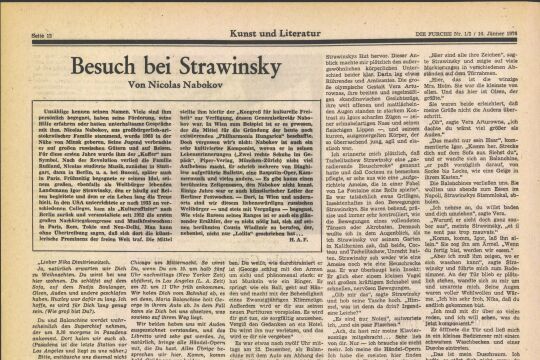Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Motor der Füße
DAS LOKAL IST VON AUSSEN her gesehen nicht gerade repräsentativ. Jetzt eben, eine Stunde vor Mitternacht, stehen vier, sagen wir, junge Herren in erregtem Disput auf dem Gehsteig. Der erste mit dem wirren Schwarzschopf den er eben mit Hilfe eines Kammes einigermaßen in Ordnung bringt, sagt zu seinem Nachbar, der sich eine Zigarette anzündet: „Das ist nichts Neues. Das hab' ich von ihr auch schon gehört. Die halt' dich nur zum Narren. Und tanzen kann's auch net.“ Der Zigarettenraucher spuckt kräftig aus, bevor er antwortet: „Der Boogie war net schlecht.“ Darauf der dritte, der eben in seiner Kleingeldbörse nach einer Münze sucht: „Weil du noch nix Besseres g'sehn hast! Ich werd jetzt telephonie-ren, ob beim Fe was los ist.“ Und der vierte der jungen Herren abschließend: „Ich fahr zweimal mit der Maschin 'nunter.“ *
WER DER FE IST. blieb zu erraten. Vermutlich ein anderes. Lokal, und „Fe“ war die Abkürzung seines Namens oder des seines Besitzers. Jedenfalls stoben die Herren binnen fünf Minuten davon. Unten aber, im Souterrain (um nicht Keller zu sagen, obwohl rechter Hand ein paar Stufen zu den Kohlenkellern führen), war die Luft zum Schneiden und ein gesprochenes Wort nicht zu verstehen. Auf dem Podium tobten abwechselnd, einige Männer auf ebenfalls abwechselnd ergriffenen Instrumenten. Das Licht wechselte von Blau auf Rot und auf ein giftiges Grün. Aus dem Hinter-■prund trat k?das heifttüspeang. iTeirt .Mann von wänrgstens 1,90 Meter Größe mit einem Satz an die Rampe des kleinen Podiums und vor ein Mikrophon, worauf ein jammernder Gesang stufenleiterweise auf und ab stieg. Die Tanzenden kümmerten sich recht wenig um diese Begleitung. Sie tanzen — jedes Paar anders — mit stummem Eifer und einer durchaus sachlichen Hingabe; nicht, wie man es aus der Erinnerung der zwanziger Jahre her schöpft, etwa mit kurzen Gesprächen untermischt oder, bei entsprechender Farbbeleuchtung, mit genußreich geschlossenen Augen. *
SCHRILLE PFIFFE DRINGEN INS FOYER. Der diensthabende Polizeibeamte legt grüßend die Hand an den Schirm seiner Mütze. „Nein, nichts Besonderes los, immer dasselbe.“ Immer dasselbe, das heißt in diesem Falle inmitten von wenigstens zweitausend Jugendlichen, von denen die aktivsten teils auf den Fingern, teils mit Hilfe von Signalpfeifen (manche an einer schönen, farbigen Schnur) Kaskaden von Pfiffen loslassen, nichts anderes als: die Begeisterung ist auf dem Höhepunkt angelangt. Die Pfiffe sind eben Ausdruck des Beifalls, der Anerkennung. Manchmal ist dieser Beifall derart — es kommen noch Sprechchöre eigener Fechsung dazu — daß von der Musik überhaupt nichts mehr zu hören ist. Und doch spielt sie. Man sieht es an den Bewegungen der Musiker. Die Kapelle soll gut sein. So versichert zumindest der Manager, der mich eingeladen hat. Aber sie war von dem Platz aus, auf dem ich mich befand, eben nur ein optisches Phänomen. In der Pause sprach ich mit einem Posaunisten. Er nannte die Stimmung „sehr gemäßigt“ und äußerte sich übrigens anerkennend über die Disziplin der Besucher. Wie bei diesem „sehr gemäßigt“ dann das Mittelmäßige oder gar das Unmäßige sein mag? Die Disziplin: nun, das darf man nicht so buchstabengetreu nehmen. Immerhin, es wird nichts zerschlagen. Ein ausgezogener Schuh, der einige Sitzreihen weit fliegt, ein umgekrempelter, verkehrt angezogener Rock, ein durch Hochziehen des Sakkos unsichtbar gewordener Kopf und halbleer schlenkernde Ärmel: das besagt bei den Herren wirklich wenig. Die Mädchen beschränken sich auf jubelnde Zurufe und taktmäßiges Händeklatschen, das zuweilen dem „Hoppauf“ auf dem Sportplatz des Fußballklubs „Rapid“ während der berühmten Rapid-Viertelstunde ganz und gar ähnelt.
EIN PSYCHOTHERAPEUTISCHES INSTITUT in Westdeutschland hat vor längerer Zeit die Reaktionen auf Musik untersucht, wo. -1 man die Ergebnisse nach drei Gesichtspunkten ordnete: nach der Wirkung auf die Atmung, auf das vegetative Nervensystem und auf die Muskeln. Bei klassischer Musik überwog die At mungskurve, mit der man die geistige Erfassung gleichsetzte; bei mäßig rhythmisierter Musik (Märschen) wrrde vorwiegend die Muskulatur angesprochen; bei normaler Unterhaltungsmusik das vegetative Nervensystem; bei Jazz — und
das ist zumindest merkwürdig — schlugen die Kurven für Atmung, für das vegetative Nervensystem und für die Muskelreaktion in ziemlich gleichem Maße weit aus. Als Folge dieses Versuchs — und das konnte natürlich nicht ausbleiben — hat sich die Propaganda aller Stellen, die Jazzveranstaltungen machen, der Ergebnisse bemächtigt und von der „Totalität des Jazz“ gesprochen, von einer Musik, die „in der Welt der totalen Bindungen den totalen Ausbruch ermöglicht“. Als ich diese Formulierung einem recht aufgeweckten jungen Mann gegenüber zitierte, hat er glatt darauf „Holler“ gesagt, was im Wienerischen soviel wie bei den Norddeutschen „Quatsch“ bedeutet Das Mädchen in seiner Gesellschaft, das übrigens in der gleichen Fabrik arbeitet wie er und einen Abendkurs in der Volkshochschule im Sachgebiet Geschichte besucht, meinte dazu: „Jazz wirkt auf uns ganz verschieden; ich habe Freundinnen, die den richtigen, konzertanten Jazz gerne anhören, aber am liebsten Walzer tanzen — eine hat sogar Polka gelernt. Was mir im Vergleich zur Tagesarbeit und der Musik unserer Freizeit besonders auffällt ist: die motorischen Geräusche, die ich von der Fabrik her kenne, das ist die Musik der Arbeit, diese Motorik ist — wie soll ich's denn sagen — die Kulisse der Pflicht. Dort, bei der Arbeit, ist der Takt das. Muß; hier beim Jazz kann man bei ähnlichen motorischen Geräuschen das Muß wegwischen, dem Einfall eines jeden von uns, der diese Musik gerne hat, ist viel Platz gegönnt. Und was man so gewöhnlich in Zeitungsberichten oder nach Photos als .Austoben' bezeichnet, ist nur ein Ausgleich.“ *
WIE ERNSTHAFT UND KURVENLOS die Jazzmusik auf jugendliche Zuhörer eines richtigen Konzert, wirkt, davon kann man sich gelegentlich bei Veranstaltungen der „Musikalischen Jugend“ überzeugen. Das Toben gewisser Jazzfans mit den Maßstäben des Gesellschaftstanzes oder mit jenen der zweckmäßig komponierten Musik zu verwechseln, ist ungerecht und zudem sachlich falsch. Der Jazz der Jahrhundertwende von New Orleans hat sich im steten Wechselspiel mit der europäischen Musik des vorigen Jahrhunderts und mit der Kunstform dieser Musik entwickelt. Die Tongebung („hot“ genannt) mehr emphatisch als die melodische Seite berücksichtigend, bevorzugt vor allem die grotesken Klangfarben. Gewisse Verzerrungen empfindet man durchaus organisch. Vom „New Orleans“ der Neger ging es zum „Dixieland“ der Weißen, aus dem sich in den zwanziger Jahren der „Chikagostil“ entwickelte, der parallelgeführte Melodien, die sich selten kreuzen, und hervortretende Solisten bevorzugte. In den dreißiger Jahren gewann Swing an Raum, zehn Jahre später der Be-bop, der zunächst wenigstens von „Combos“ (kleine Jazzband von drei bis acht Musikern) gespielt wurde (im Gegensatz zu den „Big Bands“ mit vier bis fünf Trompeten, vier Posaunen, fünfstimmigem Saxophonsatz und Schlagzeugabteilung). Der Jazz hat der Kunstmusik manche, zuweilen sogar beträchtliche Anregungen vermittelt — das zeigen die Kompositionen von Gershwin, dessen Name ein klassischer Begriff geworden ist. das bezeugen aber auch manche Kompositionen von Weill, Milhäud. Krenek, Strawinsky und Hinde-mith. Daß diese Jazz-Züge durchaus nicht neuesten oder neueren Datums sind, ist schon aus der Aneignung volkstümlicher Rhythmik und Melodik in Dvofäks Fünfter Symphonie („Aus der Neuen Welt“) zu ersehen.
DIE POLITIK HAT DEN JAZZ sowohl früher als auch jetzt am Haken. Die Lexika, die nach 1933 in Deutschland erschienen sind, bezeichnen brav den Jazz als „eine dem deutschen Wesen fremde Musik“, die „Fachschaften“ der Musik haben parallel mit Bestrebungen in der bildenden Kunst auch die'^KläSgf'als .]e&K&ti08t-zeichnet* Die meisten totalitären Staaten hatten den Jazz wenn schon nicht verboten, so doch geächtet als „Reaktion des Bourgeois gegen den Kasernenhof-marsch“ (und dabei übersprungen, daß sie selbst noch immer besagten Marsch spielen.) Die Musikerzieher von heute bemühen sich, das Interesse der Jugend für die „moderne“ Musik ebenso in vernünftige Bahnen zu lenken wie die Jeunesse Musicale mit ihren Konzerten. Heute bieten sich eigene Institute für lazztrompete und Saxophon an und finden auch Zuspruch. Es wäre verfehlt, den Zug der Jugend zur ausgeübten Musik hier abzuschneiden. Es ist besser, selbst ein Instrument zu spielen, als Münze um Münze in die Musikbox zu werfen.
„Ich habe selbst — fragen Sie nicht wie — Trompete geblasen“, sagte der Leiter einer Musikschule, „und auf dem Schlagwerk wie ein Irrsinniger gehämmert. Schauen Sie sich heute meinen Plattenschrank an, und Sie werden staunen! Alles ist Durchgang im Leben, und alles, was klingt und pfeift, ist Leben. Ich würde gerne noch einmal Trompete blasen, wenn mein Atem es erlaubte.“ Während des letzten Satzes war ein Musiklehrer mit einer schönen alten Geige eingetreten. Er sagte: „Dieser Atem war zu allen Zeiten der gleiche: Liebe zur Musik, Liebe zum Rhythmus, ein wenig Überschwang dazu. Ich bin kein diktatorischer Schulmeister. Ich unterrichte zwei begabte Jazzmusiker, die jede Woche bitten, auf dieser alten Geige spielen zu dürfen. Ich habe das Gesicht der beiden verstohlen beobachtet. Es ist dann ein anderes als jenes beim Jazz. Unsere Zeit hat viele Gesichter. Man muß nur verstehen, sie übereinanderzulegen, als gelte es einen Mehrfarbendruck. Und gibt nicht ein Orchester den Abglanz vielfältiger Erlebnisse und Gesichter?“ Er zupft auf der A-Saite. Und als Antwort kam aus dem Übungsraum der Ton eines Saxophons.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!