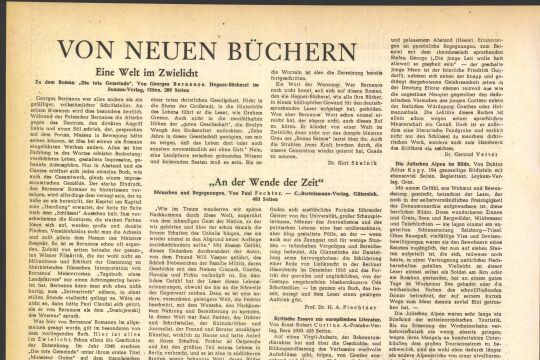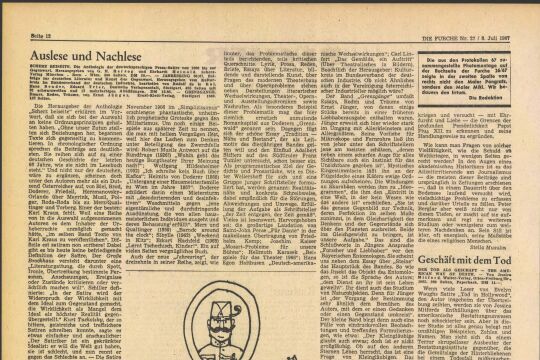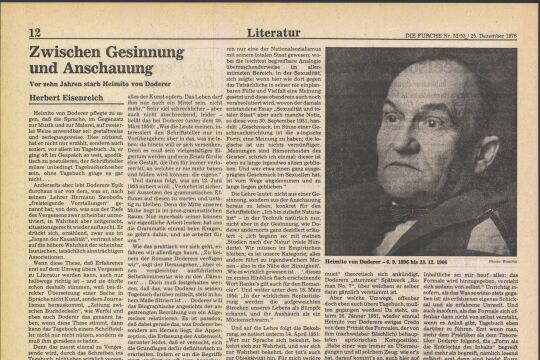Der neue Wiener Roman: Heimito von Doderer und Albert Paris Gütersloh
Seit dein Tode von Hans Henny Jahnn und Wolf von Niebel-schütz hat sich der Schwerpunkt des deutschen Romans eindeutig nach Wien verlagert. Nur hier, im Umkreis von Heimito von Doderer, wird der Roman in seinem eigentlichen Sinne noch bewußt gepflegt — und das heißt: geschrieben und theoretisch erforscht. Gewiß gibt es auch diesseits der Salzach noch Erzähler von Rang. Aber eben Erzähler, nicht Romanciers. Gerd Gaiser ist ein Meister der Verdichtung komplexer Situationen in geschlossene Bilder, etwa in „Das Schiff im Berg“. Das ist genau das Gegenteil des Romans im traditionellen Sinne, der das weitverzweigte Labyrinth liebt, welches sich erst nach Durchschreiten aller Gänge, der rechten wie der irreführenden, zu einer Einheit zusammenschließt. Auch das bei aller Extravaganz und Provokationslust interessanteste epische Experiment dieser Jahre — das „phonetisch“ geschriebene „Kaff auch Mare Crisium“, das seinem Verfasser, Arno Schmidt, den Spitznamen eines „niedersächsischen Diderot“ (Ernst Jünger dixitf) eingetragen hat — ist trotz aller Assoziationsfülle kein Roman in diesem Sinn: Sein Kunstgriff besteht ja gerade darin, daß er die Welt auf zwei Schnittflächen reduziert, auf denen jedes angeschnittene Äderchen zu sehen ist. Der „Weltroman“, wie er im Barock entstand — und wer wüßte das besser als Arno Schmidt, der besondere Kenner und Liebhaber jener Epoche —, will ja gerade Gefäß der ganzen Welt mit aller Ungefügigkeit ihrer einzelnen Brocken sein. Er sperrt sich gegen die Reduktion, die doch eines der künstlerischen Grundprinzipien ist; er läßt nur die Rhythmisierung der Fülle durch Leitmotive zu. Das ist, was Doderer den „totalen Roman“ nennt; sein Lehrer Gütersloh spricht von „Materiologie“.
Die „Wiener Schule des Romans“ war nie eine geschlossene Schule. Immer wurde sie durch starke Gegensätzlichkeiten ihrer führenden Meister belebt. Bis vor kurzem hat die Spannung zwischen Musil und Doderer sie charakterisiert. Das Dritte Reich hat ja die Aufnahme Musils innerhalb der deutschen Grenze um eine gute Generation verzögert; das Publikum begann sich fast zur gleichen Zeit mit ihm wie mit Doderer zu beschäftigen. Weil Musil etwas älter war und im Ausland schon anerkannt, machten Denkfaule Doderer zu seinem Schüler. Wirkliche Leser aber spürten bald, daß sich da zwei grundverschiedene epische Prinzipien gegenüberstanden. Musils „Mann ohne Eigenschaften“ ist das höchste Muster des essayistischen Romans; seine Figuren haben die Tendenz, sich zu Markierungszeichen auf Denklinien zu verinnerlichen. Die Welt wird in die Hirnhöhle des Autors aufgesogen; der Roman kann darum auch keinen Abschluß finden, weil diese Verinner-lichung ja alle Eigenheit auflöst.
Doderers große Romane hingegen, „Die Strudlhofstiege“ (1950) und „Die Dämonen“ (1956), scheinen auf den ersten Blick nur aus Eigenschaften zu bestehen. Was von ihnen zunächst sich einprägt, sind bestimmte Attitüden, in denen eine Person sich verrät; sind Gerüche, in denen sich eine Situation konzentriert. Das „Allgemeine“ ist in diesen dicken Bänden, in denen nach Urteil von Diagonallesern „nichts drin steht“, nur indirekt da; es wird ausgespart. Der Leser, der sich auf das Spiel einläßt, wird über eine Kette von scheinbaren Nichtigkeiten zu dem Punkt geführt, wo schon im Aufklang einer Teetasse das hereinbrechen kann, um das es geht. „Die Tiefe ist außen“, hat Doderer schon vor dem „nouveau roman“ der Robbe-Grillet und Butor gesagt, weniger verbissen als diese und darum auch nicht mit „Marienbader“-Längen. Musil war der letzte und großartige Versuch, sich des Allgemeinen unmittelbar zu versichern — der Versuch mußte ins Fragment auslaufen. Der nur sechs Jahre jüngere Doderer ging von unserer geistigen Lage aus, dem Zerredetsein des Allgemeinen, und hat über das Echo der Dinge doch wieder eine ganze Welt aufgebaut.
Heute nun steht es so aus, als ob sich, lange nach Musils Tod (1942), in der Wiener Schule der gleiche Gegensatz wiederholen würde. Albert Paris Gütersloh ist mit seinem seit vielen Jahren erwarteten Hauptwerk, „Sonne und Mond“, auf die Bühne getreten. Wie Doderer an seinen „Dämonen“, so hat auch er ein gutes Vierteljahrhundert an dieser „Materiologie“ gearbeitet und sie nun im Jahre seines 75. Geburtstages in München (der „reichsdeutsche“ Verlag scheint zum Wiener Roman zu gehören!) herausgebracht. Bis dahin war Gütersloh, zum mindesten als Schriftsteller, eher ein Gerücht gewesen. Man kannte ihn als eigenartigen Maler, der eine interessante Schule junger Surrealisten (Ernst Fuchs, Wolfgang Hutter) um sich gruppierte. Man wußte vielleicht noch, daß er zur Zeit des ersten Weltkrieges an den Bestrebungen eines katholischen Expressionismus um Franz Blei teilgenommen und mit diesem esoterische Zeitschriften von der Art der „Rettung“ herausgegeben hatte. Sein erster Roman, „Die tanzende Törin“ von 1910 — für Kenner das Gründungswerk des literarischen Expressionismus —, war längst eine bibliophile Rarität; sein späteres schriftliches Werk blieb verstreut, wurde nur dosiert bekannt.
Als Dichter hatte dieser Professor an der Akademie der bildenden Künste zu Wien für ein größeres Publikum nur durch Doderer Existenz. Dieser wurde nämlich gut 30 Jahre lang nicht müde, Gütersloh seinen Lehrer zu nennen und die Welt zu schelten, daß sie von der Existenz dieses Meisters in skandalöser Weise keine Notiz nehme. Er hat diesem Skandal 1930 ein ganzes Buch („Der Fall Gütersloh“) gewidmet, von dem sein Münchner Verleger nun noch eine Restauflage übernommen hat. Mancher Doderer-Liebhaber hielt das für eine Schrulle. Nun aber ist Gütersloh da, und er ist sichtbar als ein Meister da. Seltsamerweise wirkt aber gerade von dieser neuen Lage aus der jahrzehntelange Feldzug Doderers als einer jener Spleens, mit denen diese literarische „Kapelle“ (der Geist Franz Bleis, ihres Begründers, möge uns verzeihen!) von jeher ihre Leserschaft gerne verwirrt hat.
Doderer hat nämlich „Sonne und Mond“ in einer längeren Besprechung begrüßt. Man spürte dieser Besprechung die Erleichterung darüber an, daß dem Freunde endlich der Durchbruch gelungen; zugleich aber gab Doderer deutlich zu verstehen, daß der 800 Seiten starke Band keineswegs den Vorstellungen entspreche, die er sich von Epik mache. Und wirklich: Wer das Buch zu lesen beginnt, merkt bald, daß dieser Dichter, den DodeTer stets als seinen Lehrer bezeichnet hatte, einer grundverschiedenen Ästhetik folgt. Gewiß, auch dieses Buch beginnt beim konkreten Detail. Bald aber merkt der Leser, daß er es da mit einem Autor besonderer Laune zu tun hat — einem Autor, der sich geradezu einen Spaß daraus macht, den einmal aufgegriffenen Faden der Erzählung, da, wo es-„spannend“ wird, wieder liegen zu lassen, brüsk zu einer grundsätzlichen Überlegung überzugehen und von da scheinbar vom Hundertsten ins Tausendste zu geraten, und das alles, nicht ohne sich weidlich lustig zu machen über den Leser, der gern wissen möchte, wie die „Geschichte“ nun eigentlich weitergeht. Kommt noch hinzu, daß der Verlag in einem kleinen Bändchen über Gütersloh, „Autor und Werk“, mit Auszügen Appetit auf das andere, wohl in einem Jahr erscheinende Hauptwerk des Dichters macht; jene „Wörterbücher“, in denen Begriffe, wie „Adel“, „Bildung“, „Grammatische Führung“, „Narretei“, erläutert werden. Schon in „Sonne und Mond“ (dessen Manuskriptteile notabene hilfreiche Geister dem großen Kunktator entrissen und nach seinem Plan aneinandergefügt haben), stößt man auf Passagen dieser Art.
Spaltet sich also die Wiener Schule des Romans von neuem in zwei Hälften — in eine mondbeschienene, deren kühler Glanz den mehr intellektuellen Leser anzieht, und eine vom Glanz der Dinge bestrahlte, in der sich der künstlerische Mensch zu Hause fühlt? Der Vergleich täte Doderer und Gütersloh zugleich unrecht. Schon Musil gegenüber war Doderer keineswegs der Nurkünstler. So wenig man scheinbar allein dem Gesetz des Zufalls unterworfenen Ablauf seiner Romane anspürt, daß ihnen ausführliche „Partituren“ auf langen Papierrollen zugrundeliegen, so wenig spürt der Leser bei Doderers indirekter Methode auf den ersten Anhieb, wie viel disziplinierte Denkarbeit hinter seiner scheinbaren Lässigkeit steckt. Ein bejahrter Ordinarius, also ein Mann mit Vorkriegsbildungsansprüchen, hat nach längerem Studium von Doderer und Gütersloh festgestellt, daß er beide ohne Zögern für einen philosophischen, einen patristischen oder einen historischen Lehrstuhl vorschlagen würde. Nur eben unterscheiden sich die beiden scharf darin, wie das Geistige sich in ihrem Romanwerk niederschlägt.
Gütersloh ist kein Essayist, der aus Versehen Romane schreibt, und „Sonne und Mond“ ist nicht, wie ungeduldige Rezensenten gemeint haben, eine Aneinanderreihung von Aphorismen, also in sich abgeschlossenen Gedanken. Diese „Materiologie“ versucht vielmehr, das Geistige unmittelbar sinnlich werden in einem elementaren Erzählstrom: „Wir aber sind Materiologen! Das heißt, wir erforschen die Welt unter der Fiktion, nicht, in ihr zu leben, und zwar deswegen, um den jedem Denken integralen Fehler, welcher der Denkende selbst ist, bei möglichster Geringfügigkeit zu halten. Daher wir auf unsere eigene Vorhandenheit viel weniger Wert legen als auf die aller anderen Wesen, die unsichtbaren nicht nur miteingeschlossen, sondern vielmehr an der Spitze!“ Das ist im Kern Güterslohs Programm. Auch hier „ist die Tiefe außen“, nur auf einer anderen Ebene.
Und es bleibt nicht bloß Programm. Das eigentliche Wunder an Güterslohs Erzählkunst ist, wie das Geistige anschaulich wird: .....Das Vortragen klang wie liturgisches Beten, doch nicht wie eines, das mit dem heiligen Zeremoniell bereits Ernst gemacht hat, sondern wie eines, das es erst einübt. Es war eine etwas langweilige Etüde für zwei auseinandergefaltete Hände auf dem theologischen Klavier.“ Von einem Diener heißt es: „ ... er wurde ein Hauspsychologe von hoch oben oder weit hinten her; jedenfalls mit größter Gespanntheit seines kleinen Bogens.“ Und das sind nicht etwa herausgepickte Perlen, sondern so geht es im Grunde über alle 800 Seiten hin. Man muß sich an so viel pralle Anschaulichkeit des Geistigen gewöhnen, das wir sonst nur grau in grau kennen, während dem Ding allein Farbe zugemessen schien. (Die ihm bei Gütersloh notabene nicht abgeht: Da wird von einem Menschen nicht einfach gesagt, er winde sich wie eine Schlange, sondern: „Der windet sich wie eine Schlange, bauchauswärts, baucheinwärts...“) Wir haben keinen illegitimen Roman vor uns, sondern einen, der sich wieder hereinholt, was die Spezialisten als Beute in ihre Kojen weggeschleppt hatten.
Den Leser mag allerdings zunächst das Hin und Her zwischen zwei Ebenen schmerzen. Bei „unserer seltsamen Art, das Leben zweimal zu erleben, das eine Mal in der Gegenwart, das andere Mal in der Erinnerung“, wird die Welt der Essenz, die beim „normalen“ Erzähler nur als Glanzlicht den Fakten aufsitzt, zur eigentlichen Ebene des Geschehens; wenn dieses zwischendurch zu den Fakten taucht, so um der stereoskopischen Deutlichkeit willen. Das setzt das „Einverständnis mit dem idealen Leser“ voraus, der „bestrebt ist, mit Hilfe dauernder Unruhe, das der erahnten Komplettheit von Leben gemäße Fiebern, Schillern, Ineinanderfließen der Heterogenitäten hervorzubrin-. gen und, je nachdem, zu erleiden oder zu genießen...“.
Es wäre Sabotage dieses Einverständnisses, den Roman in die schlechte Allgemeinheit zurückzuzerren und aus ihm eine Allegorie zu destillieren. Gewiß, der Titel „Sonne und Mond“ scheint auf die beiden männlichen Hauptfiguren gemünzt zu sein: auf den flatterhaften Grafen Lunarin und den soliden Bauern Till Adelseher, der des Grafen Erbe so ehrlich mehrt. Darum aber aus diesem in einer idealösterreichischen Landschaft zwischen 1887 und der Gegenwart (mit den bei der Wiener Schulen obligaten Abstechern ins Mittelalter) spielenden Roman zu einer Allegorie Österreichs zu machen, wäre zu eng. Er ist ein Welttheater wie jeder echte Roman, und es passiert auch auf der unteren Ebene, der des Faktischen, nicht wenig: Ein Opernbrand und ein Marien-Wunder gehören zur durchaus vorhandenen „Story“, ein Haremsturm und ein verwandter Turm, der außerdem als Photographenatelier dient, weiter werden antike Tempel ausgegraben, ein Streichholzmädchen steigt zur Millionärsgattin auf, und von ferne blitzt sogar ein portori-kanisches Pronunziamento herein. Aber diese Vorgänge samt ihrem Personal sind plastisch und flüchtig zugleich; die Evoka-tionskraft des Autors ist so groß, daß der Faden fast an beliebigem Punkte gekappt werden kann — auf ihn kommt's ja nicht an. Das zeigt sich schon daran, daß die Figuren nie Menschen wie diejenigen Doderers, also unsere Begleiter, werden; bei Gütersloh sind es Figurinen einer großen Oper.
Beides aber ist legitim. Während Musil und Doderer sich ausschlössen, sind Doderer und Gütersloh zwar ungleiche Brüder sehr verschiedenen Berufes — aber doch Brüder.