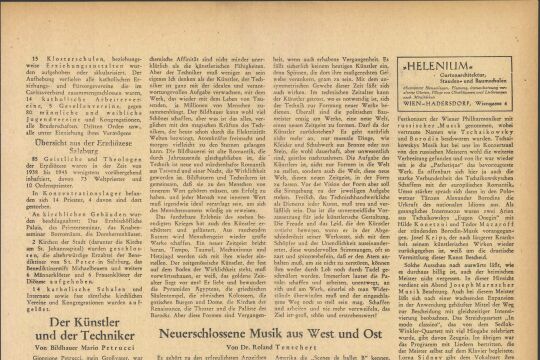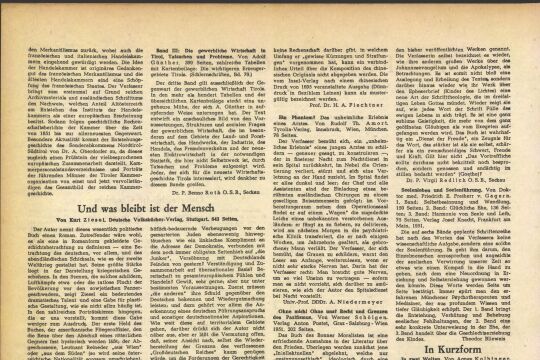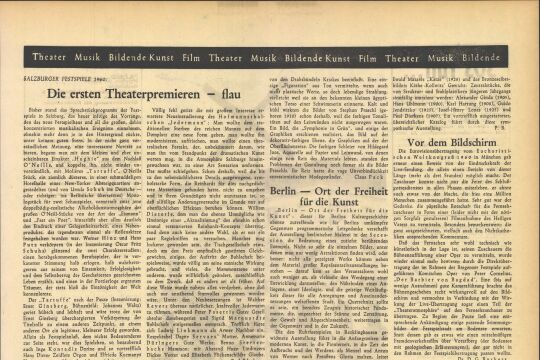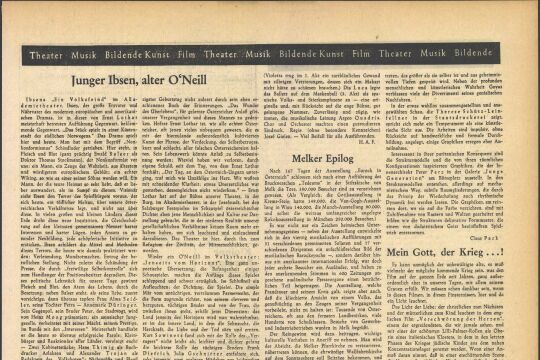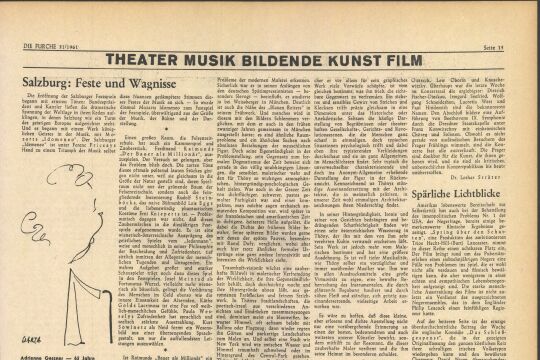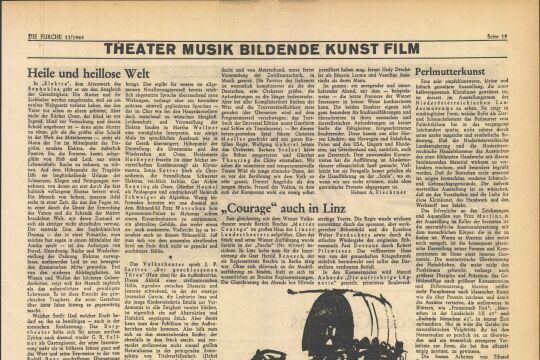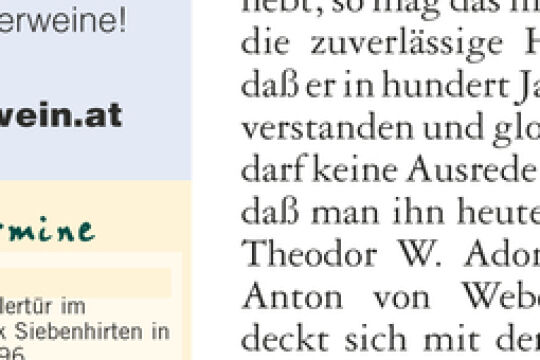Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nach Kierkegaard
Ob I b 6 e n die philosophische Theologie Kierkegaards kannte, als er vor knapp hundert Jahren seinen „Peer Gynt“ schrieb, ist schwer zu ergründen. Wir wissen daher auch nicht philologisch genau, ob die bemerkenswerte Inszenierung, mit der sich das Volkstheater zum Ende dieser Spielzeit erneut als die geistig lebendigste Bühne Wiens legitimierte, den von allen überlagernden Schichten befreiten „Ur-Peer-Gynt“ zu Tage förderte. Eines aber steht fest: dem aus Hamburg kommenden Regisseur Ulrich E r f u r t h gelang eine nordlichthelle, bis ins Letzte klar durchdachte Interpretation dessen, was an diesem so viel mißdeuteten Werk als philosophischer Kern, wenn schon nicht klassisch-zeitlos, so doch zumindest noch für unsere Generation unmittelbar fordernd geblieben ist. Peer Gynt ist hier weder die romantische Märchenfigur, noch das verbummelte GenH^deiin eben alles erlaubt 'ist. weil das trett4'BloSderigeleln am heimischen Herde l^m'utlg' wartet; bis der Schwerenöter' Wach Hause findet. Ebensowenig ist er der „nordische Mensch“, der Blut und Boden der Heimat verläßt, sich mit allerhand minderrassigem Gesindel herumtreibt und dann schließlich wieder in die germanischen Berge zurückkehrt. Er ist die Personifikation dessen, was Kierkegaard den „ästhetischen Menschen“ nennt, dem zwar nicht der Weg in die Gesetzesethik, wohl aber die große Umkehr zum eigentlich Religiösen als einziger Heilsweg bleibt. Der ästhetische Mensch mit der geheimen Wolke der Schwermut über der glatten Stirn, der 6ich selbst absolut setzt und daher die übrige Welt zynisch relativiert, der die Ursünde begeht, nach der Lehre des „Großen Krummen“ in seiner eigenen Brust dem einzig gebotenen „Entweder-Oder“ auszuweichen. (Schade, daß der unerläßlichen Abendkürzung die hiefür notwendige Begegnung mit dem Teufel zum Opfer fallen mußte. Um so transparenter das gar nicht mystifizierte Gespräch mit dem Knopfgießer des eindringlich schlichten Egon Jordan.)
Die Musik Winfried Z i 11 i g s ist an die Stelle Griegs getreten, die in dieser Interpretation wirklich nichts mehr zu suchen hat. Sie ist eigenwillig, kühn in der modernen Trollszene, und doch rein dienend funktionell. Gustav M a n k e r s Bühnenbild ist einfach großartig. Die kalte, harte Photographie ist der echte Gegenpol zur egozentrischen Wunschwelt des Peer. Erwähnen wir von den Darstellern die ganz unsentimentalen Aase der Dorothea N e f f, die anfangs etwas zu expressive Solveig der Julia Gschnitzer. den ausgezeichneten Irrenarzt des Hans W e i c k e r stellvertretend für ein prächtig geführtes Ensemble. Und nennen wir Max Eckhard in der Titelrolle mit Bedacht zuletzt. Seine Riesenleistung nötigt Respekt ab. Aber diese Inszenierung hätte nicht nur das Gute, sondern das Außerordentliche an intellektueller Bewältigung verlangt. Schade, daß er sich manche im Ansatz durchaus vorhandene Nuance selbst durch ein Zuviel an Bewegung, ein Übermaß an nicht gerechtfertigter Lautstärke (etwa in der Bekanntgabe seines schurkischen Waffenlieferungsplanes, die eiskalt und leise viel besser gewirkt hätte) überdeckte. Nach fast vier Stunden ein begeisterter Applaus.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!