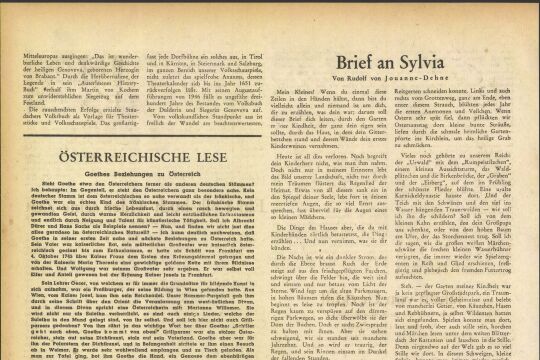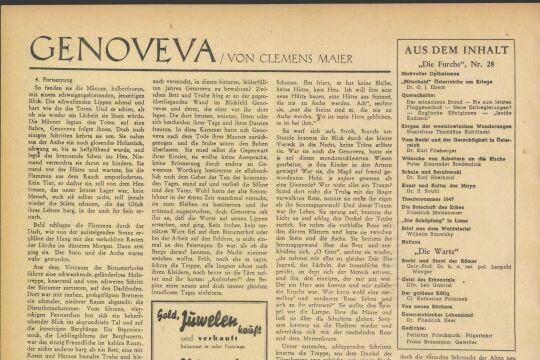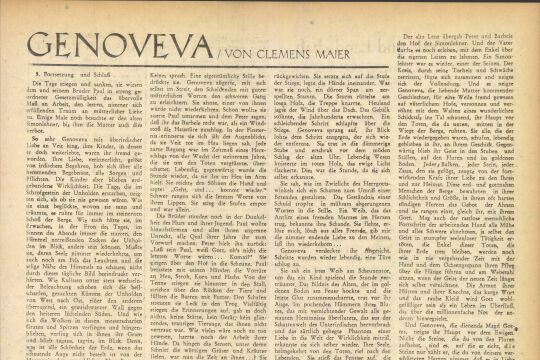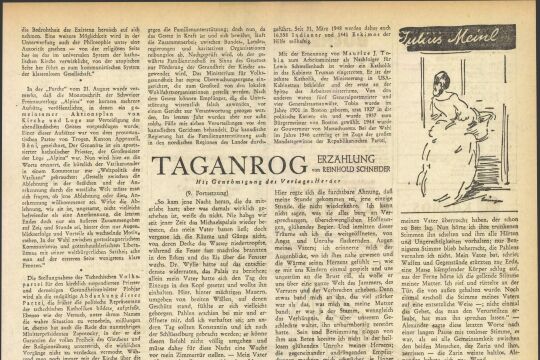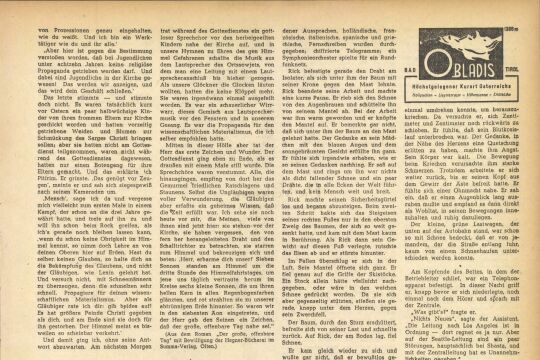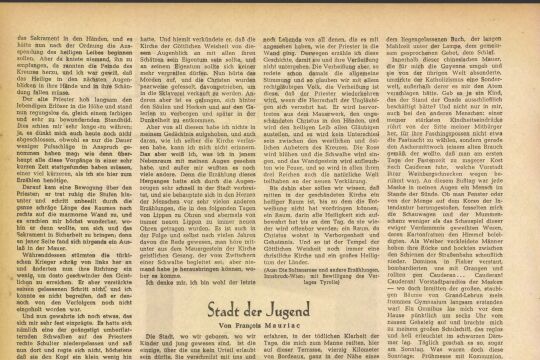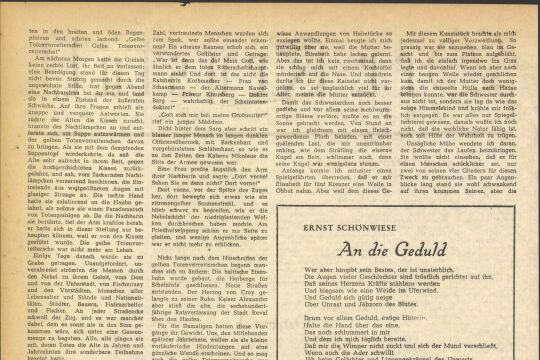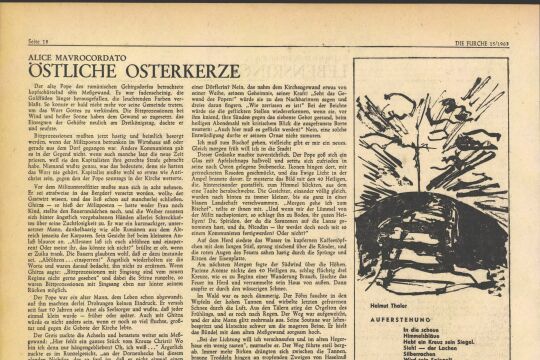Die wenigen Spaziergänger auf der Straße, die sich längs der Bahnlinie Bordeaux—Cette hinzieht, blieben stehen, um durch die Bäume nach dem großen, stummen Haus zu schauen, von dem man sagte, daß niemals jemand seine Schwelle mehr überschritt. Sie sahen während einiger Wochen sich die Jalousien noch öffnen, hinter denen ausgestreckt auf Mathildes Bett Fernand Cazenave seine schlaflosen Nächte verbrachte. Aber eines Morgens, um die Mitte des Sommers, blieben sie geschlossen: Was Felicite die „feindliche Burg“ genannt hatte, darin war alles Leben erloschen. Von einem Sonntag zum anderen erwachten für kurze Zeit die Fenster Felicite Cazenaves, darauf die des Zimmers, wo Fernand in dem Bett seiner Kindetage wieder Schlaf zu finden hoffte. Aber auf all diesen Lagern blieb er die Beute der elenden Schlaflosigkeit. Und als es Herbst wurde, zur Zeit um St. Michael, wenn die Zigeunerinnen, in ihren scharlachroten Lumpen gekleidet, sich am Gartenzaun lagern und ihre stinkenden Feuer anzünden, war das Zimmer Felicites und dann das Fernands für immer verschlossen. Wie in einem großen Körper, nahe seinem Ende, zog sich das äußere Leben des Hauses zurück und konzentrierte sich in der Küche. Das Bett der Gelähmten, das noch im Erdgeschoß aufgeschlagen stand, diente fortan Fernand. Am Morgen, kaum gewaschen, ging er an der Küche vorbei und fand dort wieder in der Ecke am Herd den Sessel, in dem seine Mutter den Tod erwartet hatte, ihn mit den Augen verschlingend.
Oben häufte sich der Staub in dem Zimmer, in dem Mathilde gestorben war. Er trübte das Glas des Muschelrahmens, hinter dem sich ein junges Antlitz ohne Lächeln verwischte. Lilien, schon seit.. Monaten vertrocknet, waren noch in den Vasen, die Fernand unlängst mit einer so brennenden Inbrunst geschmückt hatte. Marie de Lados murrte, sie könne nicht alles machen.
Um länger die kniende und zitternde Magd zu bleiben, dazu sah Marie de Lados jetzt den entthronten Götzen, der von seinem Sockel heruntergestiegen war und der ihr jetzt ganz ausgeliefert war, zu nahe. Fernand verlangte, wie zu der Zeit, da sie bei ihrer Herrin wachte, •sie solle in der dunklen Kammer, die an das Arbeitszimmer anstieß, schlafen, damit er sie nächstens mit weinerlicher Stimme rufen könne. Sie war seine letzte Zuflucht, sie, die die Alten noch gekannt hatte, und deren Soßen, nach verlorenen Rezepten zubereitet, auch den entferntesten Räumen den Duft aufprägten, den die Großeltern geliebt hatten. Drei Generationen der Peloueyre hatten sich der Hände dieser Wäscherin bedient. Aber das Schicksal mußte Fernand Cazenave bis in diese letzte Zuflucht verfolgen und ihn daraus vertreiben.
Mit den Wildenten, mit den scheuen Ringeltauben, mit der Zeit der Weinlese kehrte auch Raymond, der Enkel Maries, in die Küche zurück, dessen Eltern in Yquem beim Marquis den Wein ernteten. Er war ein kleiner, munterer Schlingel geworden, mit großen, abstehenden Ohren und einer Brust, ausgesotten wie Töpferware. Seine nackten und reinen Füße klappten auf den abgelaufenen Fliesen, schlecht unterdrücktes Lachen brütete in seinen Augen, die Kernen von roten Weinbeeren glichen. Zuerst hatte Marie de Lados Angst gehabt, er könne den Herrn ermüden; denn das Kind lief dauernd hinaus und herein, ließ die Tür offen stehen oder zuschlagen. Aber Fernand wollte gar nicht, daß man es schelte.
Mit demselben schweren Blick, den seine schweigsame Mutter. auf ihn gerichtet hatte, folgte er nun dem kleinen Schmutzfinken. Er hätte mit ihm sprechen wollen; aber was soll man einem Kinde sagen? Manchmal zog er aus seiner Tasche eine runde Schachtel mit Hustenbonbons, und wenn Raymond in seine Reichweite kam, hielt er den Köder hin und flüsterte: „Eine Pistazie?“ Der Kleine hielt atemlos und rotglühend inne, und während er sich bediente, erwischte ihn Fernand am Arm und hielt ihn zurück. Aber er, die blauschwarzen Haare gesträubt wie ein Gefieder, den Kopf abgewandt, stampfend, suchte sich zu entwinden ...
Als sich Marie de Lados gewiß war, daß die Anwesenheit ihres Enkels dem Herrn nicht mißfiel, traf sie Maßnahmen, ihn den ganzen Winter zu behalten. Fernand witterte die Gefahr nicht. Felicite hätte sich nicht einmal die Zeit genommen, ein solches Ansinnen zu prüfen: sie wußte, daß „man sich mit solchen Leuten keine Verbindlichkeiten schaffen soll“. Nachdem sie Marie de Lados zu ihren Öfen zurückgeschickt und sie wie eine dumme Gans behandelt hatte, hätte sie nicht umhin gekonnt, zu ihrem lieben Sohn zu wiederholen: „Wenn du midi nicht hättest! Ein Glück, daß ich da bin! Ohne mich würdest du dich schön anführen lassen. Du siehst darin nicht weiter, als deine Nase lang ist. Du kannst dich nicht mehr verteidigen als ein Baby. Wenn ich nicht auf das Korn achtete, der erste beste würde dich übertölpeln.“ Aber sie schritt ihm nicht mehr voran, um ihm die Äste aus dem Weg zu räumen. Er ahnte sogar noch keine Gefahr, als Raymonds Eltern sich bitten ließen, ihn bei Monsieur Cazenave zu lassen, und vorspiegelten, nur aus Liebenswürdigkeit nachzugeben. Dieser heißhungrige Schlingel mit seinen von Frostbeulen zersprungenen und von Tinte beschmierten Händen, der sich nicht mehr um den schweigsamen Herrn, den Speiseschrank oder die Uhr kümmerte, hatte es bald fertiggebracht, Fernand zu mißfallen, sodann ihm Entsetzen einzuflößen, da er bemerkte, daß Marie de Lados in ihrem Dienst nachließ. Sie vernachlässigte den alten Götzen um de lachenden Kindes willen, das von ihrem Blut war. Es kam nicht in Frage, die Suppe zu essen, bevor er zurückgekehrt war. Und es war das Klappen seiner Holzschuhe auf der Vortreppe, das die Stunde zum Essen anzeigte. Eine gutartige Halsentzündung, von der Raymond im Dezember befallen wurde, genügte, daß Marie de Lados die Kammer verließ, wo sie nahe ihrem Herrn geschlafen hatte. Das Schlimmste war, daß die Mutter des Kleinen sich hier unter dem Vorwand einrichtete, ihn zu pflegen. Marie de Lados fürchtete dieses Mädchen sehr: Tochter des Landes, zahnlos und schwarz, verriet sie durch Auge und Schnabel die
Wildheit eines Huhnes. Der Vater, der im Warenlager arbeitete-, kehrte am Abend zurück — mächtiger Schlag von der Garonne, kräftig gewachsen, aber mit einem Leib, ballonartig gebläht, über einer blauen Hose, die ein Gürtel nicht mehr zu halten vermochte — ein gebrochener Herkules, im Innern angefressen von der tödlichen Süße des Sauterne. Obwohl der Kleine Rekonvaleszent war, setzte sich das Paar jeden Abend in der Küche zu Tisch, und Fernand Cazenave mußte im Speisezimmer serviert werden, das trotz eines großen Feuers immer kalt war. Während dieser kurzen Mahlzeit hörte er leises Lachen, Kläffen; aber wenn Marie de Lados die Tür öffnete, um ihn zu bedienen, war es nicht mehr als geflüsterter Dialekt, Klappern der Löffel und Teller, bis hinter der wieder geschlossenen Tür sie von neuem begannen zu plärren.
Sie wußte nicht, daß Fernand Cazenave in dem kalten Zimmer, dessen falsche gelbliche Täfelung er immer verabscheut hatte, nicht mehr allein war. Als er die Augen von seinem Teller hob, erschien ihm, an dem Platze, wo sie während eines halben Jahrhunderts gethront hatte, seine Mutter, majestätisch, herrschsüchtig, imposanter noch im Tode, deren erzürntes göttliches Antlitz dem schwachen Sohn Scham einjagte. He, warum! warf er dieses Gesindel nicht aus dem Hause? In solchen Gedanken erstand Fernand die fürchterliche Göttin neu, deren Runzeln mit der Augenbraue die Bedienten, Makler, Pächter und Knechte gezähmt hatte. Der alte Äneas, nahe am Verlöschen, breitete seine bittende Hände zu der allmächtigen, „Zeugerin“. Besiegt betete er die an, die stark gewesen war. Seine bewundernswürdige Mutterl Warum hatte eine kleine hohnlächelnde Lehrerin die Stirn gehabt, sich auf seinen Weg zu drängen? Mathilde, deren Traumgestalt auch an diesem Tisch saß, weitab vom Feuer, im Luftzug, so als wenn sie lebte — der Tod konnte sie nicht mehr vergöttern. Aber Fernand erinnerte sich an den runden Rücken, die geschlagene Miene, diese gelben Augen einer gejagten Katze.
Das Haus erzitterte unter dem Vorüberfahren eines Schnellzugs, den das Geplärr in der Küche nicht über die Garonne hinweg vernehmen ließ. Der Schrecken vor der Mutter, dieser Wahn, bemächtigte sich Fernands von neuem: und schon erhob er sich, schritt nach der Tür, als Marie de Lados mit einem Teller voll Milchspeise erschien. Sie sah ihren Herrn scharf an, bereit, auf diesem Gesicht die Zeichen des Sturmes zu erspähen. Sie sagte mit erstickter Stimme:
„Ich will ,dem Mädchen' sagen, daß es den Herrn stört.“
Zitternd kam sie in die Küche zurück. „Das Mädchen“ ließ sie das Grauen empfinden, daß allen Greisen des Landes ihre Kinder einflößen. (Nachdem sie ihr Pfennig für Pfennig, ihre armseligen Ersparnisse, abgenommen hatten, warfen die Tochter und der Schwiegersohn ihr noch vor, Geld versteckt zu haben.) Fernand hörte einige Sekunden die Alte allein sprechen. Aber mit einer schrecklichen Kehlstimme heulte die Tochter plötzlich im Dialekt los. Nichts bezeugte mehr die eigenartige Verlassenheit, in der Fernand Cazenave gelebt hatte, als seine Unkenntnis des Dialekts. Das Ohr an die Tür gepreßt, verstand er, daß Marie de Lados ihren Kindern die Stirne bot. Aber was forderten sie von der Alten? „Moussu“ kehrte zu oft in ihrer Rede wieder, als daß er zweifeln konnte, Gegenstand dieser Auseinandersetzung zu sein. Da er schlecht hörte, verließ er das Speisezimmer und ging über die Diele. Sein Schritt erweckte das Echo in dem gewaltigen Raum, dessen Türen ohne Laden am äußersten Ende zwei klare Rechtecke aus der eisigen Nacht schnitten dann führte, ihn ein Gang zur Küchentür, die sich gegenüber der großen Treppe öffnete. Schaudernd im Dunkeln, hörte er „Möussu“ und, was auch oft wiederkehrte. ,das Balg“. Marie de Lados schrie jetzt in verständlichem Französisch: „Aber da ich dir sage, daß er nicht einmal nach dem Jungen gefragt hat!“ Sie kannte den Herren vielleicht! Als ob er der Mensch wäre, sich wegen eines Schlingels Zwang anzutun! Das Kind hätte ihn während einiger Tage unterhalten. Und jetzt hat er genug davon. Man konnte es schließlich nicht zwingen. Das keifende Mädchen unterbrach sie: „Ja! Du könntest ihn zwingen, wozu du willst: Er kann dich nicht mehr missen, dieser alte Waschlappen, aber du Hebst deine Familie nicht...“ Sie begann von neuem, im Dialekt zu brüllen.
Fernand hatte sich zu seinem hohen Wuchs wieder aufgerichtet. Seine Mutter stieß ihn vorwärts, sie war in ihm, sie hatte Besitz von ihm ergriffen. Was wartete er noch, einzutreten, ohne Achtung zu rufen, um diesen Tisch mit einem Fußtritt zu zertrümmern, aber seine Beine versagten, sein Herz wurde verwirrt. „Zunächst einmal schlafen ...“ Er ließ sich auf die halbgeschlossene Holzkiste fallen. Der Deckel klappte, und dieses trockene Geräusch unterbrach hinter der Tür das Gezeter. Er erhob sich, ging nach dem Arbeitszimmer, wo das Feuer nicht unterhalten worden war. Nachdem er sich hingelegt hatte und sein Wachslicht erloschen war, bemerkte er, daß Marie de Lados auch versäumt hatte, die Fensterläden zu schließen. Er sah von seinem Bett aus die Klarheit der Nacht. Da es den ganzen Tag geregnet hatte, tropfte es von den Bäumen in eine übernatürliche Stille. Und es gab nichts mehr auf der Welt als das leise Geräusch der Tropfen. Eine Beruhigung kam über ihn. eine Gelöstheit, als hätte er über sein eigenes fürchterliches Leben, über seine eigene Härte hinaus ein Reich der Liebe und des Schweigens geahnt, wo seine Mutter eine andere war als die, vor der er wie von einer Mänade besessen war, wo Mathilde ihr gelöstes, für immer befriedetes Antlitz mit dem Lächeln einer Seligen ihm zuwandte.
Es war schon Tag, als das Rieseln des Regens ihn aufweckte Diese winterfinsteren Morgen, wie er sie haßte! Er erinnerte sich sogar nicht mehr, ein unbekanntes Glücksgefühl empfunden zu haben. Die ganze schmutzige Flut seines Grolles wogte an diesem Morgen in ihn zurück. Unter den Decken schrumpfte sein alter Körper zusammen, der ihm Schmerzen bereitete. Er sah seinen Tageslauf vor sich, eine sandige und leere Straße zwischen verbranntem Heideland. Um Zeit zu gewinnen, schloß er die Augen, damit er ohne Bewußtsein die Oase des Frühstücks erreichte. Während Marie de Lados das Feuer anzündete und den heißen Milchkaffee an seinem Kopfende niedersetzte, tat er, als ob er schliefe, den Kopf fest an die Wand gepreßt.
Aus lern Roman „Genitrix“, deutsch von Helmut Kuntze