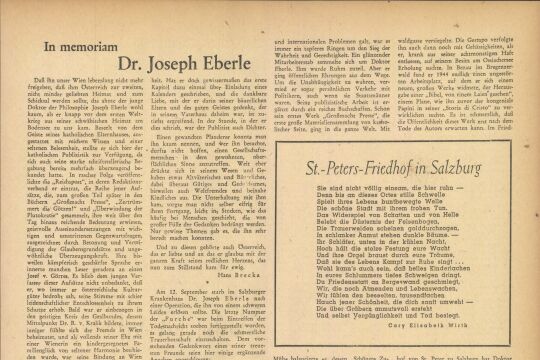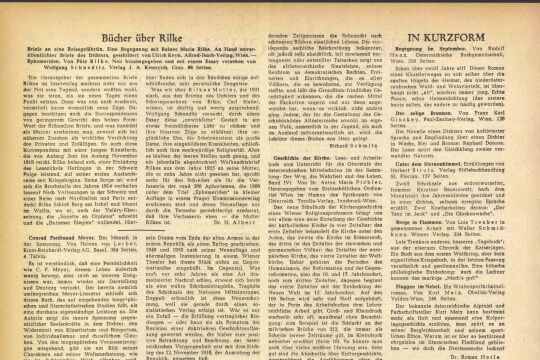Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Nie genug katholisch, so weit links wie möglich
Aus einer gewaltigen Materialfülle über Friedrich Heer hat Evelyn Adunka, 1965 in Kärnten geboren, zunächst eine Dissertation zum Abschluß ihres Studiums der Philosophie, Geschichtswissenschaft und Judaistik verfaßt, aus der nun eine „intellektuelle Biographie” Friedrich Heers entstanden ist. Mit Staunen erfährt man die Bandbreite von Heers Denken, die Tiefe seiner Religiosität und seines Humanismus, die Schärfe seiner Kritik, seine politische Hellsichtigkeit und die Wucht seiner pathetischen Sprache.
Schon das Inhaltsverzeichnis liest sich wie ein „Who is Who” seit 1945: Mit Ivan Ulich, Roger Garaudy, Robert Jungk, Erich Fromm, Theodor Adorno, Simon Wiesenthal und Carl Amery fühlte sich Heer ebenso verbunden wie mit Fritz Wotruba, Ingeborg Bachmann, Peter Turrini, Heinrich Boll und Günther Anders oder Hubertus Maynarek. Die Zahl seiner persönlichen Freunde war allerdings begrenzt.
„Wenn man in Nimwegen oder in Mailand, in Nürnberg oder Paris, in Frankfurt oder Zürich unter Intellektuellen auf Fragen der christlichen Erneuerung, des katholischen Nonkonformismus, eines neuen Geschichtsbildes überhaupt zu reden kommt, dann kann man sehr wohl hören: ,Ach ja, da ist in Wien doch ein interessanter und bedeutender Kopf. Kennen Sie nicht den Friedrich Heer?' - Wenn man dann in Wien aber nach ihm fragt, so fällt einem der verwandelte Tonfall auf: ,Unser Fritz Heer? Ach ja, der ist immer noch bei der furche ... Er schreibt dort vor allem Theaterkritiken. Liest aber auch an der Universität.' Dann folgen meist einige Anekdoten und die beliebten Wortspiele, daß man ihm zu Ehren Häresie jetzt mit zwei ,e' schreibe, wie ver-,heer'-end dieses und jenes von ihm gewesen sei. Gleich darauf aber versichert man, daß er ja doch ein guter, ein vorzüglicher, ein hochbegabter Mann sei, daß man nichts gegen ihn habe, seine Bedeutung nicht schmälern wolle und dergleichen mehr ... Es ist seit je Art dieser geistig hochkonservativen Stadt, ihrer störrischen und genialischen Kinder mit der leichten Hand Herr zu werden, indem man ihnen eine Art intellektueller Narrenfreiheit zuerkennt, innerhalb derer sie sich bewegen, die sie aber nur schlecht durchdringen können.”
So die deutsche Zeitschrift „Christ und Welt” im Jahr 1957. Kein Wunder also, daß Friedrich Heer bei der Verleihung des Osterreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst 1980 - eine weitere österreichische Facette, die offizielle Ablehnung Unliebsamer zu kaschieren - fragte: „Wie kann es sich ein Staat leisten, einen Menschen auszuzeichnen, dessen Lebenswerk kein Mensch in Osterreich kennt?”
Doch ebenso wenig verwunderlich ist, daß Österreich den doch auch so typischen Wiener Intellektuellen mehr attackierte als viele andere. Seine Auseinandersetzungen mit dem Christentum, der katholischen Kirche, dem Nationalsozialismus, dem Judentum und mit dem österreichischen Antisemitismus hat man ihm nie verziehen.
Schon 1952 hatte er das Scheitern der Entnazifizierung festgestellt, aber vor allem die Bücher „Gottes erste Liebe - 2000 Jahre Judentum und Christentum. Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler” (1967) und „Der Glaube des Adolf Hitler - Anatomie einer politischen Religiosität” (1968) lösten heftige Polemiken aus und führten zu Anfeindungen, die seine materielle Existenz bedrohten.
Daß Heer schon 1949 in seinem Buch „Gespräch der Feinde” für den
Dialog mit dem Ostblock eintrat, stempelte ihn bis zum Tod 1983 (und darüber hinaus) zum Feindbild der rechtsbürgerlichen und rechtskatholischen Öffentlichkeit; pikanterweise gehörten zu den heftigsten Angreifern auch die jüdischen Schriftsteller Friedrich Torberg und Hans Weigel.
Daß seine glasklaren, scharfen Stellungnahmen eine manchmal überraschende, oft aber auch bestürzende Aktualität hatten (und noch haben) und er sie hartnäckig in pathetisch-provokativer Weise aussprach, mußte ihn in Österreich, wo die Verdrängung zum Alltag gehört wie Essen und Trinken, zum Feindbild schlechthin werden lassen. Der Historiker und Publizist, Philosoph, Humanist, Denker und Moralist fühlte sich trotz der
Kränkungen, unter denen er vor allem in Wien litt, Österreich so verbunden, daß er es auch dann nicht verlassen wollte, als er bereits Einladungen und Berufungen ins Ausland bekam, obwohl ihm die Wiener Universität mit fadenscheinigen Begründungen eine Professur hartnäckig verweigerte.
Daß er die „Dunkle Mutter Wien, mein Wien” (1978) dennoch innig liebte und Österreich historisch idealisierte („Land im Strom der Zeit”, 1958; „Das Glück der Maria Theresia”, 1966; „Kampf um die österreichische
- Identität”, 1981), ist nur eine weitere Seite des ewigen Grenzgängers, der sich Zeit seines Lebens zwischen allen Fronten und Stühlen befand. Am stärksten geprägt hatte den 1916 in Wien geborenen Heer die Zwischenkriegszeit: „Mir sind die Jahre 1927 bis 1938 so tief in die Seele eingebrannt, daß ich einzelne ,besondere Vorkommnisse' und einzelne Schicksalsfiguren dieser Jahre deutlicher vor mir sehe als Gestalten im ,Heute”', schrieb er in den siebziger Jahren. Wegen seiner Gegnerschaft zu Hitler war er Mitglied einer CV-Verbindung, verehrte Dollfuß, fühlte sich aber auch den Sozialisten verbunden. Nach dem Einmarsch der NS-Truppen 1938 wurde Heer sechsmal verhaftet.
Auch nach 1945 vertrat er den Standpunkt, man könne nicht katholisch genug, müsse aber gleichzeitig so links wie nur möglich sein. Dazu paßte seine lebenslange Freundschaft mit Viktor Matejka ebenso wie sein Engagement für Rolf Hochhuths „Stellvertreter”, seine Vorliebe für Teilhard de Chardin und sein Eintreten für Adolf Holl und Karlheinz Deschner. Von 1949 bis 1961 gehörte er - nicht ganz zu Rechtals „Linkskatholik” bezeichnet - der furche an und prägte auch noch die turbulenten Jahre ihrer Geschichte, in denen auch Anton Pelin-ka und Trautl Brandstaller Redaktionsmitglieder waren, nachhaltig und provokationsreich.
Daß Ernst Haeusserman seine Bestellung zum Chefdramaturgen durchsetzte und 1971 seine Bestellung zum Konsulenten für kulturelle Angelegenheiten und internationale Kontakte am Burgtheater möglich wurde, sicherte die materielle Existenz Friedrich Heers.
Über den Auseinandersetzungen um seine kirchlichen und politischen Tabu-Brüche blieb die Rezeption von Friedrich Heers Arbeiten zur europäischen Geistesgeschichte („Aufgang Europas” 1949; „Europäische Geistesgeschichte” (1953), „Europa, Mutter der Revolutionen” 1964), zur Philosophie („Wagnis der schöpferischen Vernunft” 1977) bis heute weitgehend auf der Strecke. Daß er eine interdisziplinäre Geschichtsschau vertrat, verstärkte die Ablehnung. Sein Gesamtwerk umfaßt mehr als 50.000 Buchseiten, unzählige Artikel, Sendemanuskripte und Briefe.
Persönliches ist in Evelyn Adunkas Biographie weitgehend ausgespart, es ist tatsächlich eine intellektuelle Biographie. Auch die Chronologie von Heers Leben orientiert sich ausschließlich am Werk. Nur in den Interviews mit Personen, die ihn kannten, wird vieles angedeutet, das neugierig macht. Manchmal fühlt man sich durch die Überfülle und Länge der wörtlichen Zitate, die im Text abgedruckt sind, erdrückt, vielleicht aber entspricht sogar dies Friedrich Heer, der auch von denen, die ihn liebten, als Besessener empfunden wurde, der andere mit seinem Wissen, seinen Gedanken und unbequemen Äußerungen überschwemmte. Trotzdem repräsentiert dieses Werk nicht nur Heers Leben, sondern auch österreichische Zeit-, Gesellschafts- und Wissenschaftsgeschichte nach 1945, auch hinter den Kulissen.
Leicht auszudenken, was Friedrich Heer, der 1983 an Leukämie starb, zu Kurt Waldheim, zum „Bedenkjahr” 1988, zu Jörg Haider, den Briefbomben, Hans Hermann Groer, Kurt Krenn, Ausländergesetzen und dem derzeitigen politischen Klima in Österreich eingefallen wäre. All das blieb ihm erspart - ihm, der als Grundmotiv seiner Arbeit schrieb: „Die Schändung des Menschen, ich kann es ruhig sagen, war einer der stärksten Eindrücke meines Lebens, des ganzen Lebens.”
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!