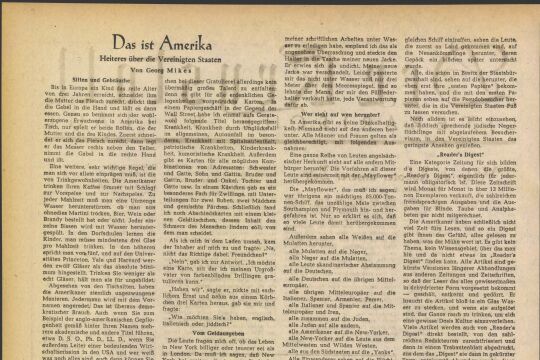Ich stamme aus der gleichen Gegend wie Agnon. Er wurde in Buczacz und ich in Stanislau geboren; die Entfernung, die die kleinen Städte trennt, beträgt kaum mehr als 50 Kilometer. Nur, als ich zur Welt kam, war Agnon, der damals noch Czaczkes hieß, schon unterwegs nach Palästina. Ich erinnere mich noch aus meiner Kindheit, daß, wenn auf der Leber des Huhnes, das meine Großmutter für den Sabbat vorbereitete, Flecken sichtbar waren, sie das Huhn mit der fleckigen Leber in die Nebengasse zum Rabbiner schickte, um eine „Scheejla“ zu fragen (hebräisch: eine Frage zu stellen), ob das Huhn koscher ist, ob man es benützen darf; Hätten wir in Buczacz gewohnt, hätte sie das Huhn zu Agnons Vater, zu Schalom Mordechai Czaczkes mit der „Scheejla“ geschickt. Doch nein — Reb’ Schalom Mordechai Czaczkes hatte zwar „Samchut Tora“, das ist ungefähr ein Pendant zum westlichen und weltlichen Doktortitel, dies ist die Befugnis, Rabbiner zu werden; in Buczacz war aber ein anderer Rabbiner, und der Talmudist und Schriftgelehrte Schalom Mordechai mußte Kuhhandel betreiben, um seinen Unterhalt zu verdienen. Der junge Schmuel Josef Czaczkes druckte sein erstes Gedicht — in jiddischer Sprache — in einem kleinen Wochenblatt, das damals in meinem Geburtsort Stanislau erschien; das Gedicht hieß „Ballade vom Rabbi Dila-Rina“.
Ich erzähle das alles, um Agnon näherzubringen, um die Atmosphäre seiner Erzählungen — wenigstens jener, deren Handlung in der Golah, in Europa, spielt — zu vermitteln. Das Pseudonym Agnon benützte er zum erstenmal im Jahre 1909 (er war damals 21); 15 Jahre später nahm er es auch formell als Namen an.
Agnon schrieb — bis vor kurzem — stehend, das Schreibpapier auf einem Stehpult. Auf einem ähnlichen Pult hält man in der Synagoge das Gebetbuch. Das istt nur ein äußeres Zeichen der Verbundenheit des Schreibens Agnons mit den religiösen Bräuchen. Agnon ist fromm, geht nicht unbedeckten Hauptes, betet dreimal täglich. Die Nachricht von der Verleihung des Nobelpreises an Agnon traf in Israel, drei Tage bevor der Beschluß der schwedischen Akademie offiziell bekannt wurde, ein. Als man das Gerücht Agnon mitteilte, erwiderte er, daß er nicht glaube, daß es wahr ist, denn immer wenn etwas Außergewöhnliches passiert, empfinde er es irgendwie während des Schachrith-Gebetes. Dieser Hang zur Mystik ist in seinem Schaffen unverkennbar.
Alles, was Agnon schreibt, ist aus der Perspektive des Ghettos gesehen; nicht so sehr des Ghettos, in welches die anderen uns Juden verdrängt haben, sondern vielmehr des Ghettos, in das wir uns selber eingeschlossen, in dem wir uns von den anderen abgesondert haben. Wenn ich Agnon lese, habe ich oft den Eindruck, daß es um eine jener Geschichten, die sich Juden beim Ausgang von der Synagoge oder vor dem Beginn des Gebetes oder bei einem Kiddusch, bei einer feierlichen Zusammenkunft, bei der auch Schnaps gereicht wird, erzählen, handelt. Bestimmt stehen die Erzählungen Agnons auf einer viel, viel höheren Stufe; hier geht es jedoch nicht um die Wertung, sondern um den Ursprung. Nicht nur das, was Agnon — sagen wir — in den letzten zwei Jahrzehnten, auch das, was er viel früher, als junger Mann, geschrieben hat, wirkt wie die Erzählung eines Alten. Vielleicht, weil die Alten die Redensart, die Ausdrucksweise des Ghettos geprägt haben und vielleicht, weil in den Erzählungen Agnons die tausendjährige Chochma, die Weisheit des auserwählten Volkes, mitinbegriffen ist. Aus all diesen Gründen ist Agnon eher ein Autor der älteren Generation; die Jugend in Israel liest ihn wenig. Und die Juden in der Diaspora fast überhaupt nicht; erstens aus sprachlichen Gründen, auch für die, die etwas Hebräisch können, für die zum Beispiel die Lektüre einer hebräischen Zeitung keine Schwierigkeit darstellt, ist die komplizierte Sprache Agnons kaum zugänglich; und zweitens, weil es nicht leicht ist, Agnon zu übersetzen, die erste sehr gute Übersetzung, die ich gelesen habe, ist die von Tobias Rübner. Agnon sagte, als man ihm die Verleihung des Preises offiziell bestätigte, daß er sich freue, weil er hoffe, daß ihn jetzt auch die
Jugend und die Juden in aller Welt lesen werden. Ich weiß nicht ob seine Hoffnungen in Erfüllung gehen werden, was auch hier ohne Bedeutung ist; wichtig aber ist, daß ihn Nichtjuden lesen werden; vielleicht wird er für sie den Anreiz der Exotik haben.
Ich möchte das, was ich gesagt habe, mit einigen Beispielen illustrieren. Ich entnehme sie der Erzählung „Der Treu- schwur“, der einzigen übrigens, die ich auch in deutscher Übersetzung (von Rübner) gelesen habe. Der Held der Erzählung heißt Rechnitz, „Als er in die Universität eintrat“, lesen wir auf Seite 9, „wählte er kein bestimmtes Fach, sondern gab sich allen Wissenschaften hin...“ So sah einst eine Universität aus der Perspektive eines Bethauses aus; heute weiß man auch im Bethaus, daß man an einer Universität nur eine bestimmte Fakultät, ein bestimmtes Fach inskribieren kann. Oder nehmen wir die Begegnungen Rechnitz’ mit Schoschanas Vater, dem Konsul. „Im Winter ging er mit ihm ins Kaffeehaus, dort war das Tischbesteck aus Silber“ (Seite 13). Ist das nicht ein Märchen? Oder weiter; ein Sommerausflug mit dem Konsul in einen Hof und hier die Beschreibung des Gartens: eine Statue des Kaisers steht dort, und Kühe gibt es da und Ställe, man sieht sie nicht und spürt nicht ihren Geruch...“ Es ist ein Märchen, in dem man nicht hinter die Gitter der Wirklichkeit blickt, sondern ein Märchen, in dem man durch die Gitter des Ghettos in die Außenwelt schaut.
„Schoschana bejahte mit einer Bewegung des Kopfes. Man konnte sehen, daß ihr Herz nicht wußte, womit ihr Kopf einverstanden war“ (Seite 14). Ist das nicht die Sprache des längst Vergilbten? In keiner anderen zeitgenössischen Prosa findet man so oft die Ausdrücke „die Seele“ und „das Herz“ wie bei Agnon. „Ihr Haar ist graublond, ihr Körper voll, sie trägt ihren Körper so, daß wer sie sieht, ihr Ehre erweist“ (Seite 27). Was bedeutet das? Der Satz ist richtig übersetzt, es ist aber eine Sprache, die heute nicht mehr gesprochen wird. Ich zitiere einen anderen Passus: „Rachel sagte: Interessant, interessant. Lea sagte: Was ist da interessant? Rachel sagte: Nicht wahr, Doktor? Lea sagte; Besser wir gehen spazieren...“ Haben Sie einen so oder ähnlich geschriebenen Dialog schon gelesen? Nein, meinen Sie. Da irren Sie; Sie haben ihn gelesen, nämlich in der Bibel. Agnons Schreibweise kommt von der Bibel. Es kann auch nicht anders sein, bei einem Schriftsteller, der so viel Zeit dem Studium der Heiligen Schrift widmet. Auch sein Humor ist oft eine Anspielung auf die Bibel. Ebenso die Wiederholungen; sie haben eine sehr hohe Herkunft: den Pentateuch. Erst unlängst bei einem Gespräch unterstrich Agnon, daß er außer Hebräisch (und Jiddisch) keine andere Sprache kann. Ich glaube auch, daß Agnon fast ausschließlich Hebräisch liest. Und wenn man nur Hebräisch liest, muß man immer auf den Tnach, auf die Bibel zurückkommen. Insbesondere ein so frommer Mann wie Agnon, der regelmäßig die Synagoge besucht, und in der Synagoge wird jeden Sabbat ein Kapitel von der Thora gelesen. Der Umstand aber, daß Agnon nicht allzuviel fremdsprachige Literatur liest, hilft ihm, gewissermaßen, eigenartig zu sein.
An wen erinnert also die Schreibweise Agnons? Sie werden sich wundern, wenn ich den Namen nenne: an Chagall. „Aber ich werde nicht streiten, sondern meine Augen senken, bis er einsieht, wie teuer mir Schoschana ist. Und wenn sie meine Angetraute ist, wie sie es mir geschworen, will ich sitzen und harren, bis gute Engel uns mit ihren Flügeln beschirmen und über uns den Baldachin der Trauung wölben“ (Seite 60). Sind das nicht Worte zu Chagalls Bild? Oder kann man nicht Chagalls Bilder als Illustrationen zu diesen Texten betrachten? Agnon und Chagall haben eines gemeinsam: beide kommen aus der Tiefe, aus dem Inneren der Legende des jüdischen Volkes.
Diese Eigenartigkeit klingt auch im Rhythmus der Sprache Agnons. „Schoschanas Art ist zu schweigen, es ist nicht Schoschanas Art zu reden“ (Seite 58). Ich sagte es bereits: heute schreibt man nicht so. Es ist auch keine Literatur von heute. Aber auch keine von gestern. Es ist eine Literatur, in der sich Jahrhunderte widerspiegeln. Deswegen hat auch die Schreibart Agnons etwas Volkstümliches. Sie ist fast Folklore: „Schoschana sagte zu Jaakow: Komm, setzen wir uns nieder. Sie setzen sich nieder“ (Seite 70). Es ist eine Legende. Ein Traum eines Jünglings, eines Schülers einer verschlossenen religiösen Schule aus Buczacz, ein Traum von der Außenwelt. Das ganze Schaffen Agnons gilt der Schilderung dieses Traumes, der bis jetzt andauert er er innert sich an den Tag, da Schoschana eine ihrer Locken trennte und eine Strähne aus seinem Haupthaar, sie vermengte sie beide und verbrannte sie, sie aßen die Asche und schwuren sich Treue...“ Ist es nicht eine Ballade? Doktor Rechnitz, der Universitätsprofessor, ist der Bräutigam der Ballade und die Tochter des Konsuls Ehrlich — die Braut. Statt dem Huhn, das auf Chagalls Bildern schwebt, dem Huhn von der „Scheejla“ auch meiner Großmutter, schweben in dieser palästinensischen Erzählung Agnons die neun Palmen von Moses’ Schwiegersohn und die sieben Mädchen von Rechnitz’ Spaziergängen, die sieben Wandelsterne ...
Die Erzählung endet auch wie eine Ballade, wie ein Traum. Es wirkt etwas überraschend, als nach dem realistischen Beginn und der realistischen Schilderung dieses metaphysische Ende folgt. Die letzten Seiten der Erzählung erinnern an das berühmte Theaterstück des jiddischen Bühnenautors Anski „Der Dybuk“; es ist eine Art Abschlußchoreographie, ein unverhoffter Tanz der sieben Mädchen, ein Gehen, ein Rennen, ein etwas mystischer Ausklang, an dem sich auch die plötzlich genesene Schoschana beteiligt. Der Leser weiß nicht genau, wo die Wirklichkeit endet und wo das Symbol beginnt.
Die schwächste Seite Agnons ist die Komposition. Agnon sieht im Schreiben kein Handwerk; es kann auch kaum anders sein bei einem Schriftsteller, der einem Volk angehört, das sich gerne das „Volk des Buches“ nennt. Die meisten Bücher dieses Volkes jedoch wurden von genialen Dilettanten verfaßt, die entweder abends, nach der beruflichen Arbeit, oder zwischendurch, wenn die Frau sich um die Geschäfte kümmerte, schreiben konnten. Diesen Leuten blieb nicht viel Zeit (und nicht allzuviel Verständnis) für das Handwerkliche im Schreiben. Agnon hatte die Möglichkeit — dank der Hilfe des Verlegers Salman Schoken —, sich mehr als 40 Jahre ausschließlich mit dem Schreiben zu befassen; er blieb jedoch mit dem hebräischen Schrifttum der vergangenen Zeiten verbunden. Dieses Schrifttum lag immer seitlich der Hauptstraßen der westlichen Literatur.
Ob es nun Agnon gelingen wird, einen Brückenkopf zwischen dieser am Rande liegenden traditionalistischen (wenigstens in der Form) hebräischen und der westlichen Literatur zu schlagen — ist eine Frage. Ich glaube, daß, wenn er jetzt den Weg auch zum nichtjüdischen Leser findet, dies auch eine positive Antwort auf diese Frage bedeutet.
In der nächsten Folge der ,,Literarischen Blätter“ bringen wir einen Artikel über Nelly Sachs unter dem Titel ,,Nobelpreis für die Diaspora“