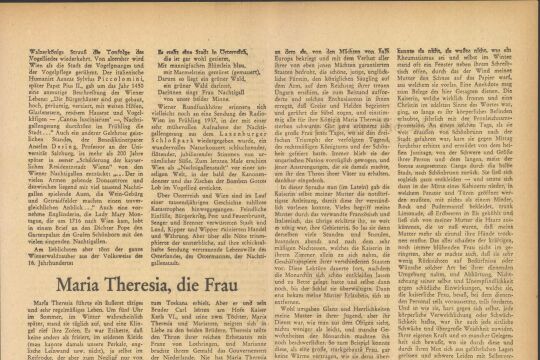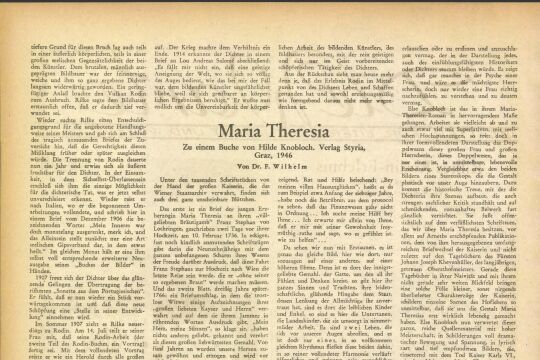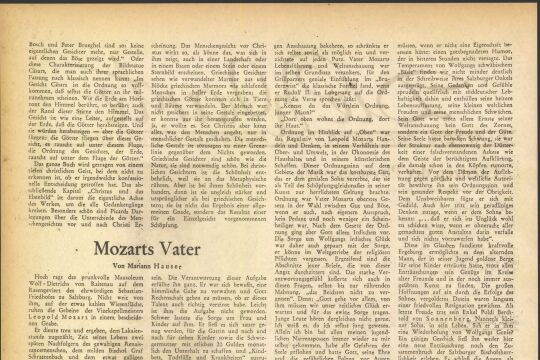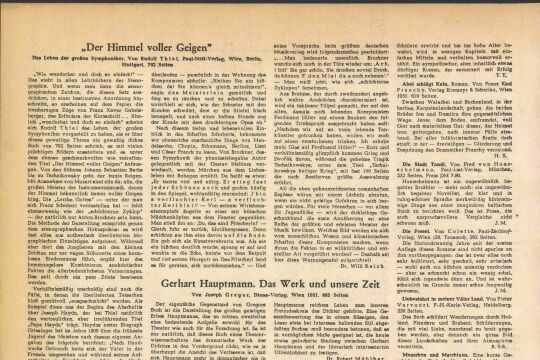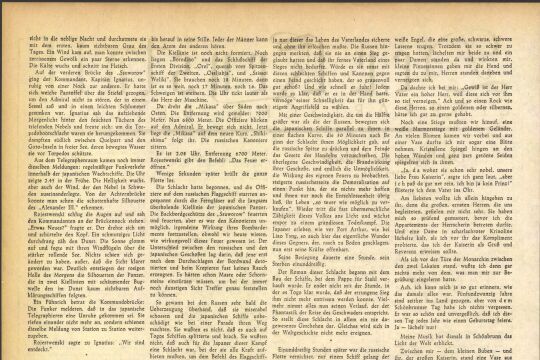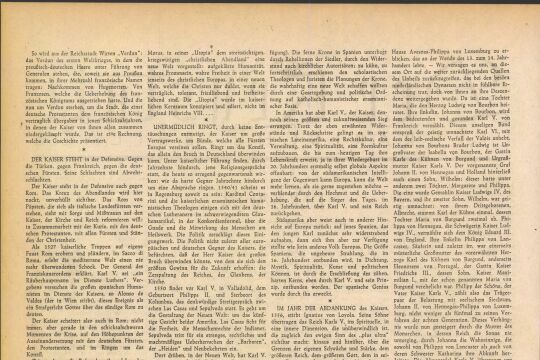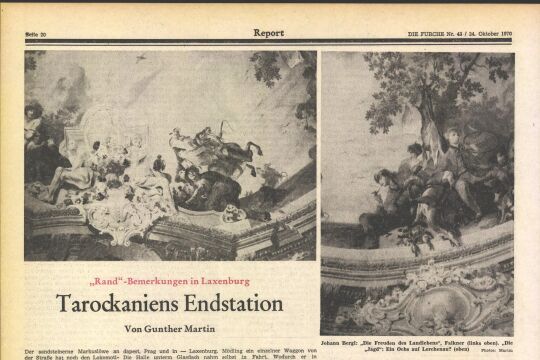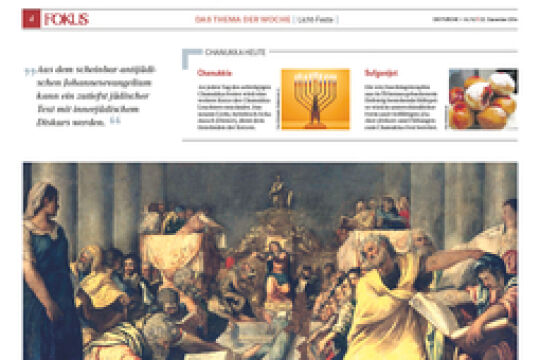Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
ÖSTERREICHISCHE MELODIE
Maria Theresia sitzt in Schönbrunn und blickt, nach dem Schreiben, in den weiten Garten hinaus, hinauf zur Gloriette.
Ihr Schönbrunn! Das Lustschloß war während des Türkeneinfalls 1863 vollkommen zerstört worden, dann lange in Trümmern geblieben. Ihr Vater, Kaiser Karl VI., liebte es nicht, sein Liebling war die Favorita, das spätere und heutige Theresianum auf der Wieden. Maria Theresia läßt ihr ganzes Leben lang Schönlbrunn ausbauen, das Schloß, dann den Garten, die Gloriette und die Römische Ruine. Im April zieht sie mit dem ganzen Hof hinaus und bleibt, so das Wetter milde ist, bis in den hohen Oktober, ja Nobember hinein. Sähönbrunn ist die Residenz der Maria Theresia: eine heiter-offene, großräumige Feierwelt, in der Schloß und Park und offenes Land ineinander übergleiten.
Das ist die Antwort der Maria Theresia, 1st die Antwort Österreichs auf die ungeheure Bedrohung aus dem Norden und Nordosten, auf die Verrückung der Gewichte in Europa: dieses Österreich haust sich nun nach innen ein, in einer Feierwelt, in einer Festeswelt, in der jenes Singen und Klingen, jene Heiterkeit, jenes herzhafte Vertrauen eine ewige Heimstatt finden sollen, die draußen in der großen
Welt der anderen Mächte nicht mehr igelten.
Wie seltsam hält dieses Österreich diese Melodie durch: 1866, nach der Niederlage von Königgrätz, die Friedrichs des Großen Siege besiegelt, komponiert Johann Strauß, zur Tröstung der Wiener, als Revanche, wie es Hanslick, der Feind Richard Wagners, nennt, den Walzer „An der schönen blauen Donau“.
Strauß ist ein Aibgesang. Ein Abgesang jener Welle von Musik, durch die sich das theresianische Österreich abschirmt, naiv-unbewußt, um sein Leben, seine Farben, seine Töne zu erhalten. Die großartige Naivität Vater Haydns und Mozarts, ihre Vermählung des Männlichen und Weiblichen, des Kindhaften und Vollreifen, des Volkstümlichen und Höfischen ist nichts anderes als maria-theresianisches Weltwollen, gesetzt in Töne.
Haydn und Mozart! Das Glück von Joseph Haydn und des Wolfgang Amadeus Mozarts ist dem Glück der Maria Theresia ganz schlicht verwandt: ganz unsentimental nehmen die beiden Musikanten Gottes alles, was ihnen zukommt, als Gabe von oben an; dem Mozart sterben die Kinder, wird das Leben zerschlagen, sterben die Blüten am Ast. Dem Haydn, Sohn eines armen Kleinbauern, wird es als Diener und Notenabschreiber, als Tanzmusiker und Privatlehrer auch nicht leicht.
Die persönlichen Berührungen mit Maria Theresia sind, in dieser Welt des großen Glücks, ganz plötzlich, sie gehen vorbei, ein Funke, der aufleuchtet und verglimmt. So trifft das Glück des Joseph Haydn und des Wolfgang Amadeus Mozants mit dem Glück der Maria Theresia zusammen:
Pfingsten 1745 weilit sie mit dem Hofe in Schönbrunn. Noch wird am Schloß fleißig gearbeitet. Auf den Gerüsten klettern Sängerknaben umher. Maria Theresia schaut hinauf, wie die Buben da oben in schwindelnder Höhe herumkraxeln, erschrickt: sie sollen sofort herunterkommen, sonst bekommen sie „einen recenten Schilling“, das hieß in der Schulsprache, ein paar auf den Allerwertesten. — Am nächsten Tag wird richtig wieder so ein Bub dabei erwischt. Und erhält seinen Schilling. Im September 1773 bedankt sich der Bub bei der Kaiserin für die Streiche: er dirigiert zu ihrem Empfang im Schloß der Esterhäzy in Eisenstadt seine Symphonie Nr. 4, die er Maria Theresia gewidmet hat. Maria Theresia dankt sehr freundlich: „Ich freu mich, mein lieber Haydn, daß ich Ihn kennenleme. Ich hab mich schon oft an seiner Musik gefreut.“ Haydn: „Ich habe schon die Ehre gehabt, von Euer Majestät gekannt zu sein.“ „Wieso?“ — Und da erzählt Haydn die Geschichte von Pfingsten 1745, die Prügel in Schönbrunn. Die Kaiserin lacht: „Sieht Er, mein lieber Haydn, da hat den doch der Schilling seine gute Wirkung gehabt.“
Maria Theresia hat übrigens auch das Ende seiner Laufbahn als Sängerknabe auf dem Gewissen. Der bereits mutierende Haydn war ihr aufgefallen, sie zeigt ihn dem Domkapellmeister: „Der Bub singt ja gar nicht mehr, der kräht ja!“ Das war ein harter Schlag, ungewollt, für den kleinen Haydn. Nun lag er auf der Straße, hinausgeworfen: Hart trifft Haydn sein Glück, hart ist die große Gnade der reich Begnadeten.
Hart trifft sein Glück den anderen Knaben, den Amadė Mozart. Zuerst scheint alles ganz wunderbar gut zu gehen. Glücklich, stolz berichtet Vater Leopold Mozart an Lorenz Hagenauer über den Empfang des sechsjährigen Wolfgangs bei der Kaiserin. Wien, am 23. Januar 1768: „Übethaupt muß ich nur sagen, daß Sie sich unmöglich vorstellen können, mit was für einer Vertraulichkeit Ihre Majestät mit meiner Frau sprach und teils wegen der Blattern meiner Kinder, teils wegen der Umstände j unserer großen Reise unterhielt, sie über die Wangen strich und bei den Händen drückte, da inzwischen der Kaiser mit mir und mit Wolfgang von der Musik und vielen anderen Sachen sprach und der Nannerl sehr oft die Röte ins Gesicht trieb.“
Der kleine Wolfgang springt der Kaiserin auf den Schoß, herzt und küßt sie. Drei Jahre später wird der unnütze Mozart abgewiesen. Ungewollt, aber hart. Erzherzog Ferdinand fragt aus Mailand bei seiner kaiserlichen Mutter in Wien an, ob sie gestatte, daß er „einen jungen Salzburger, der außerordentlich gut Klavier spielt und zierliche Musik komponiert“, bei sich anstellen dürfe. Maria Theresia antwortet: nein. „Ich glaube nicht, daß Sie eines Komponisten oder unnützer Leute bedürfen.“
Unnütze Leute: hart faßt das Glück den Wolfgang Amadeus an. Und die Maria Theresia? — Bei dem berühmten Empfang in der Burg in Wien 1762 ist der kleine Wolfgang ausgerutscht, wird von einer kleinen Erzherzogin aufgefangen und verspricht ihr zum Dank, er werde sie später heiraten.
Aus dieser Heirat ist nichts geworden. Aus der kleinen Erzherzogin wurde Marie Antoinette, die 31 Jahre später das Schafott besteigt. 13 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter, die ihren Untergang lang zuvor fürchtet, kommen sieht.
Hart faßt das Glück Maria Theresia an, in ihren Kindern. Hart faßt sie selbst ihre Kinder an. Ihre Maxime ist da: lieber unglückliche Ehen als Krieg.
Da alle Bande des Vertrauens, des Glaubens und der Liebe zwischen den Völkern erkalten, zerreißen, in Gefahr sind, gibt es nur ein Mittel, um diese zu erneuern: durch ganz persönliche Beziehungen, durch die Ehe.
Vielbelacht und mißverstanden, glaubt Maria Theresia an dieses eine Heilmittel für ihre Kinder, ihre Völker, für Europa: die Ehe. Verträge werden gebrochen, kein Wort gilt mehr — in einer Welt, in der der König Friedrich von Preußen und die ihn verehrenden Russen an die Macht gekommen sind. Diesem Kriegsbund ist vielleicht — die Kaiserin fürchtet dies tief in ihrem Herzen — kein Kraut gewachsen
— wenn aber doch noch ein Medikament hilft, dann dies eine: der einzige Friedensbund, der einzige Vertrag, der unauflösbar ist: die Ehe.
Den Ernst, den politischen Emst der Ehepolitik Maria Theresias nehmen wir wahr, wenn wir ihr Bekenntnis als ihrer Länder „allgemeine — und erste Mutter" in ihrem politischen Testament vernehmen:
„Allermaßen in allen meinen Thun und Lassen zur Haupt- Maxime erwählet, allein auf Gott zu trauen, dessen Allmacht ohne mein Zuthun noch Verlangen mich zu diesem Stande auserwählet, welcher also auch mich würdig zu machen hätte, durch meine Aufführung, Prinoipia und Intentiones, diesem mir aufgetragenen Beruf nach Erfordernüß vorzustehen“; daher „mit der eigenen Tranquilitaet und Vergnügen, wann es die göttliche Providenz dergestalten disponiret hätte, die gantze Regierung gern alsogleich abgelegt und meinen solche in Anspruch genommene Feinden selbsten überlassen hätte, wenn dardurch geglaubt, meiner Schuldigkeit nachzukommen, Fleiß, Kummer, Sorgen noch Arbeit vor selbe spahre, so oder der Ländern bestes zu befördern, welche zwey Puncta allezeit .meine Haupt-Maximen waren: Und so lieb ich auch meine Familie und Kinder habe, dergestalten, daß keinen hätte jedoch deren Länder allgemeines Beste denenselben allezeit vorgezogen, wann in meinen Gewissen überzeigt gewesen wäre, daß solches thun könne oder derselben Wohlstand dieses erheischet, indeme sofchaner Länder allgemeine
— und erste Mutter bin.“
Aus dem soeben im Herold-Verlag erschienenen Buch „Das Glück der Maria Theresia“ ton P. Heer (Besprechung auf der Buchßelte).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!