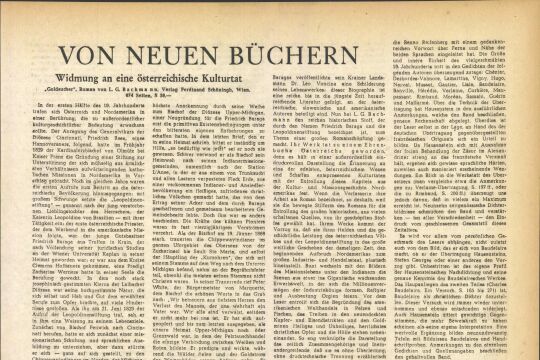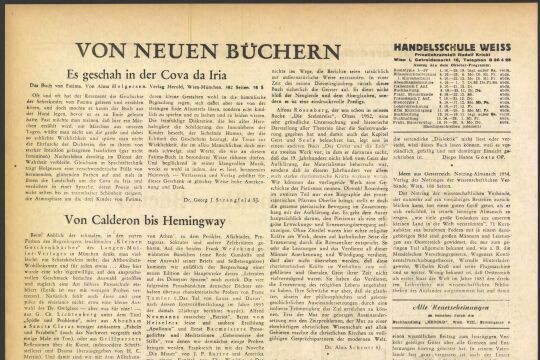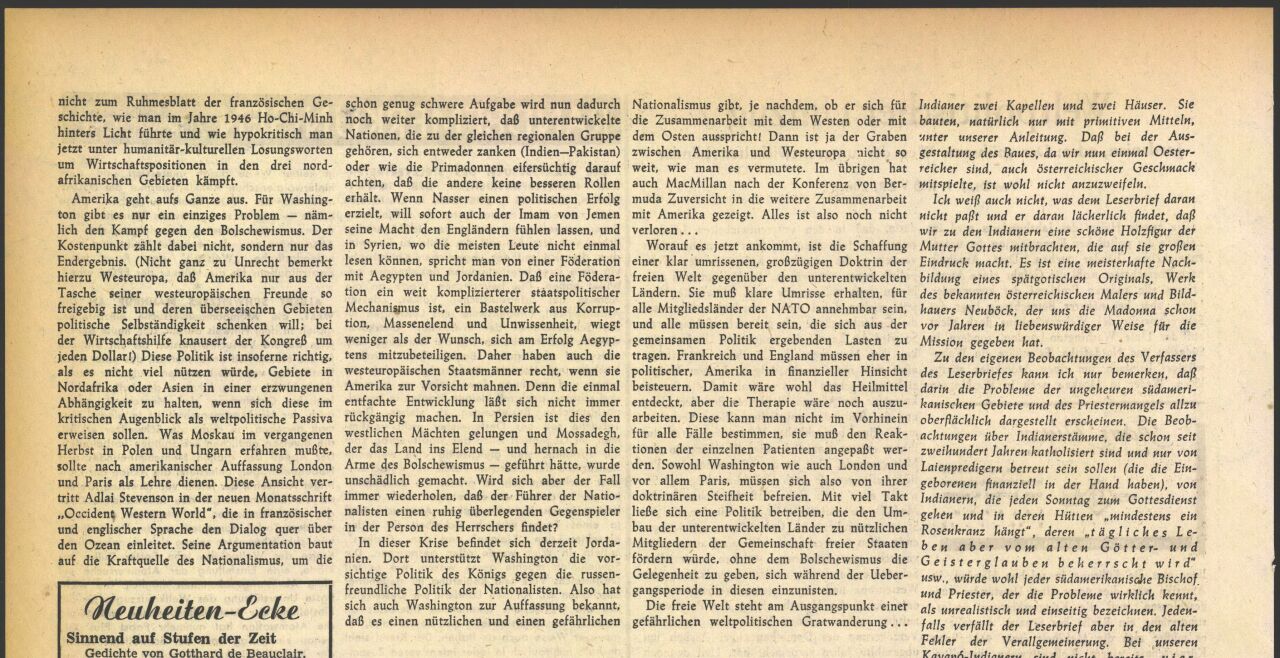
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Österreichische Missionäre am Amazonas
Zu dem seinerzeitigen interessanten Bericht des Verfassers über seine und seines Bruders Missionstätigkeit bei den Indianern am Amazonas veröffentlichten wir drei Wochen später einen Leserbrief, dessen Gedanken mißverstanden werden könnten. Der Autor fühlt sich nunmehr zur untenstehenden Erwiderung gedrängt, der wir gerne Raum geben.
Die Furche”
Der Leserbrief Herrn Rolf Breiers vom 9. März 1957 zu meinem Missionsbericht, veröffentlicht von der „Furche” am 16. Februar 1957 unter dem Titel „Ein Brief vom Aequator”, hat mich als Priester und Missionär wie auch als ethnographischen Forscher befremdet und betrübt. Es erscheint mir unbegreiflich, wie der Artikel über eine Missionsgründung österreichischer Missionär’i bei eitiem hdidniicheh Stamm Amaiönieflf, ” über den mir soviele Nachrichten voll begeister- terter Zustimmung zukamen, in einem einzelnen Fall so mißdeutet werden konnte.
Wie aus dem Leserbrief hervorgeht, lebte sein Schreiber offenbar nie mit einem heidnischen Naturvolk, das noch ganz sein Stammesleben führt, zusammen und kennt auch das bis auf wenige Punkte noch völlig unerforschte Gebiet am Xingü, an der Grenze von Pard und Mato Grosso, in dem wir arbeiten, nicht.
Die beiden Priester, von denen berichtet wurde, sind auch nicht, wie er anzunehmen scheint, junge Romantiker, sondern reife Männer von 40 und 45 Jahren. Alles, was mein Artikel enthält, beruht auf persönlichen Beobachtungen und Tatsachen, die jederzeit beweisbar sind.
Ich verglich in meiner Schilderung das erste Kommen eines Priesters zu einem wilden Stamm im geistigen Sinn mit einer Erstbesteigung im Himalajagebirge und zeigte auch gewisse äußere Aehnlichkeiten auf. Ich wollte aber gar nicht die tausend Kilometer lange monotone Flußfahrt, die wir von dem letzten Städtchen bis zum Indianerdorf zurücklegen müssen und die wir nun schon zu wiederholten Malen unternahmen, genau beschreiben; ich wollte auch nicht streng historisch über die ersten Begegnungen unserer Indianer mit der Welt der Zivilisierten sprechen (in dieser Form habe ich bereits vorher in entsprechenden wissenschaftlichen Fachschriften berichtet), sondern es ging mir lediglich darum, die geistliche und kulturelle Pionierarbeit des Missionärs bei einem Naturvolk und die Bedeutung seines eigenen Kulturgutes, das er hierfür mitbringt, aufzuzeigen. Gerade dieser Anfang ist für die Zukunft der Mission und des Volkes, dem sie gilt, entscheidend, da sich damit Richtlinien und Verhaltungsweisen anbahnen, die sich später nicht so leicht ändern. Da der Missionär sich und seine Herkunft nicht verleugnen kann, ist es besser, wenn er bewußt Kulturgüter bringt, die einerseits für das betreffende Volk passen und anderseits dem Missionär selbst ein Lebenselement bedeuten. Ich zeigte, wie der österreichische Missionär Künder des Evangeliums und Künder der reichen Kultur seiner Heimat ist. Es ist bitter zu empfinden, daß man mir das gerade in Oesterreich mißdeuten will.
Der Leserbrief will aus meiner Arbeit auch offenbar eine abwertende Einschätzung des Forschungsreisenden im Vergleich zum Missionär herauslesen. Das ist schon deshalb unzutreffend, da wir selbst intensive ethnographische Studien betreiben, also selbst Forscher sind, Sicher ist aber die Reise des Forschers, der nicht zugleich Seelsorger ist und der nur Studien bei den Indianern betreiben will, solange die Fahrt in den Randgebieten der Zivilisation vorwärtsgeht, also bevor sein eigentliches Unternehmen beginnt, physisch und psychisch weniger anstrengend als diejenige des Missionärs. Der Missionär muß in den letzten Hütten der Siedler b’ft noch BlS zwei Uhr früh die Beichte hören, predigen, Andachten halten, Krankkhbesuche machen, während der Reisende, der keine seelsorglichen Pflichten hat, von all dem nicht beansprucht ist.
Tatsächlich kamen wir nach einjähriger Vorbereitung vor drei Jahren als die ersten Priester in das eine der beiden Dörfer des Wildstammes der nördlichen Kayapö-Indianer des mittleren Xingü-Beckens, bei denen wir heute noch unsere Arbeit, den Verhältnissen entsprechend, systematisch fortsetzen. Nach der Ansicht der Fachwissenschaft ist es für einen Linguisten möglich, sich eine Eingeborenensprache bei intensivem Studium in Halbjahresfrist anzueignen. Da der Leserbrief hier Zweifel zu hegen scheint, bin ich gezwungen zu sagen, daß mir, der ich sieben Sprachen spreche und mich nun schon jahrelang mit dem Studium dieser Indianersprache beschäftige, die Fähigkeit, mir sie bereits angeeignet zu haben, wohl nicht abgesprochen werden kann. Meine linguistischen Veröffentlichungen hierüber beweisen dies ja. Ich weiß auch nicht, was dabei so „wunderbar schnell” sein soll. Daß wir im Tonfall und in den Redewendungen unsere Predigt ähnlich gestalten, wie der Häuptling seine Ansprache hält, die wir fast täglich mitanhören können, ist aus pastoralen Gründen klar.
Ich schrieb aber nicht, daß der Häuptling seinen Untertanen „M oralpauken” hält. Ich sagte, daß er in seinen Reden oft deren Fehler anklagt, so etwa, wenn er bei einem Streit zum Frieden mahnt, gegen Diebstähle in ihren Pflanzungen auftritt, gegen Frauenraub usw. Diese Tatsachen haben wir dokumentarisch in unseren ethnographischen Notizen festgehalten.
Ich schrieb auch nicht, daß den Missionären „bei Todesfällen die Schuld zu geschrieben werden könnte, weil ihr Werk den Zorn der Geister hervor- r u f e”. In Wirklichkeit legte ich bloß die Tatsache dar, die — wie jeder weiß, der mit der Materie vertraut ist — von den meisten Naturvölkern berichtet wird, wonach diesen ursprünglich eine tiefverwurzelte Feindseligkeit gegen den Fremden und alles Fremdartige eigen ist. Leicht wird der Fremde des bösen Zaubers beschuldigt. Wenn er auch schon gute Freundschaft mit den Indianern geschlossen hat, so bleibt diese doch noch lange Zeit labil. Bei auffallenden Unglücksfällen, die die Indianer treffen, erwacht das ursprüngliche Mißtrauen gegen den Fremden wieder und kann für ihn nur allzu gefährlich werden, ln den beiden Indianerdörfern bauten uns die Indianer zwei Kapellen und zwei Häuser. Sie bauten, natürlich nur mit primitiven Mitteln, unter unserer Anleitung. Daß bei der Ausgestaltung des Baues, da wir nun einmal Oesterreicher sind, auch österreichischer Geschmack mitspielte, ist wohl nicht anzuzweifeln.
Ich weiß auch nicht, was dem Leserbrief daran nicht paßt und er daran lächerlich findet, daß wir zu den Indianern eine schöne Holzfigur der Mutter Gottes mitbrachten, die auf sie großen Eindruck macht. Es ist eine meisterhafte Nachbildung eines spätgotischen Originals, Werk des bekannten österreichischen Malers und Bildhauers Neuböck, der uns die Madonna schon vor Jahren in liebenswürdiger Weise für die Mission gegeben hat.
Zu den eigenen Beobachtungen des Verfassers des Leserbriefes kann ich nur bemerken, daß darin die Probleme der ungeheuren südamerikanischen Gebiete und des Priestermangels allzu oberflächlich dargestellt erscheinen. Die Beobachtungen über Indianerstämme, die schon seit zweihundert Jahren katholisiert sind und nur von Laienpredigern betreut sein sollen (die die Eingeborenen finanziell in der Hand haben), von Indianern, die jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen und in deren Hütten „mindestens ein Rosenkranz hängt”, deren „tägliches Leben aber vom alten Götter- und Geisterglauben beherrscht wird” usw., würde wohl jeder südamerikanisdie Bischof. und Priester, der die Probleme wirklich kennt, als unrealistisch und einseitig bezeichnen. Jedenfalls verfällt der Leserbrief aber in den alten Fehler der Verallgemeinerung. Bei unseren Kayapö-lndianern sind nicht bereits „v i e r- jährige Kinder dem Alkohol und die Erwachsenen der Polygamie verfallen”, wie er von den Indianern, die er kennt, behauptet. Die Kayapös trinken überhaupt keine alkoholischen Getränke und sind nach Ansicht der bisherigen Literatur monogam, was wir durch unsere wissenschaftlichen Forschungen grundsätzlich bestätigt fanden. Jedenfalls wird sie die Mission weder den Alkoholismus noch die Polygamie, die der Schreiber offenbar mit der Prostitution verwechselt, lehren.
Man weiß auch wirklich nicht, warum der Leserbrief sagt, „daß das große Werk der Bekehrung mit der Missionstätigkeit beginnen soll, nicht mit Pulver und Blei, Glasperlen und Sklaverei”. Es klingen dabei die schon etwas antiquierten Lehren davon an, die Indianer lebten jenseits unserer Moral und unserer Gesetze, fern von unserer Religion und Zivilisation besser und glücklicher als wir. Würde man solche Hdeen auf unseren Schutzpatron (Franz Xaver anwenden, so müßte man wohl auch ihn als unrealistischen Romantiker ansehen, weil es heute nach 400 Jahren in Indien immer noch Millionen Heiden gibt; das Leben Unseres Herrn würde noch schlimmer abschneiden.
ln einem aber teile auch ich die Auffassung jenes Leserbriefes, nämlich darin, daß die Mission eine planvolle, langsame und ich möchte noch hinzufügen organische Aufbauarbeit braucht. Aber mit diesem Werk muß einmal begonnen werden, und nur diesen Anfang wollte mein Artikel damals schildern.
Wir wollen Weiterarbeiten, so wie wir begonnen, mit dem Realismus, aber auch mit dem Optimismus des Christentums.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!