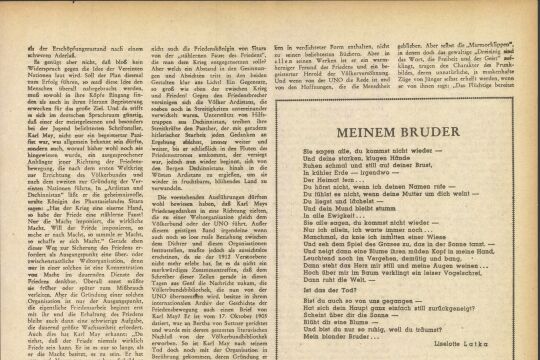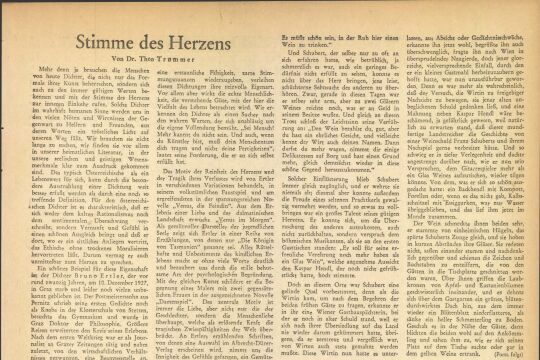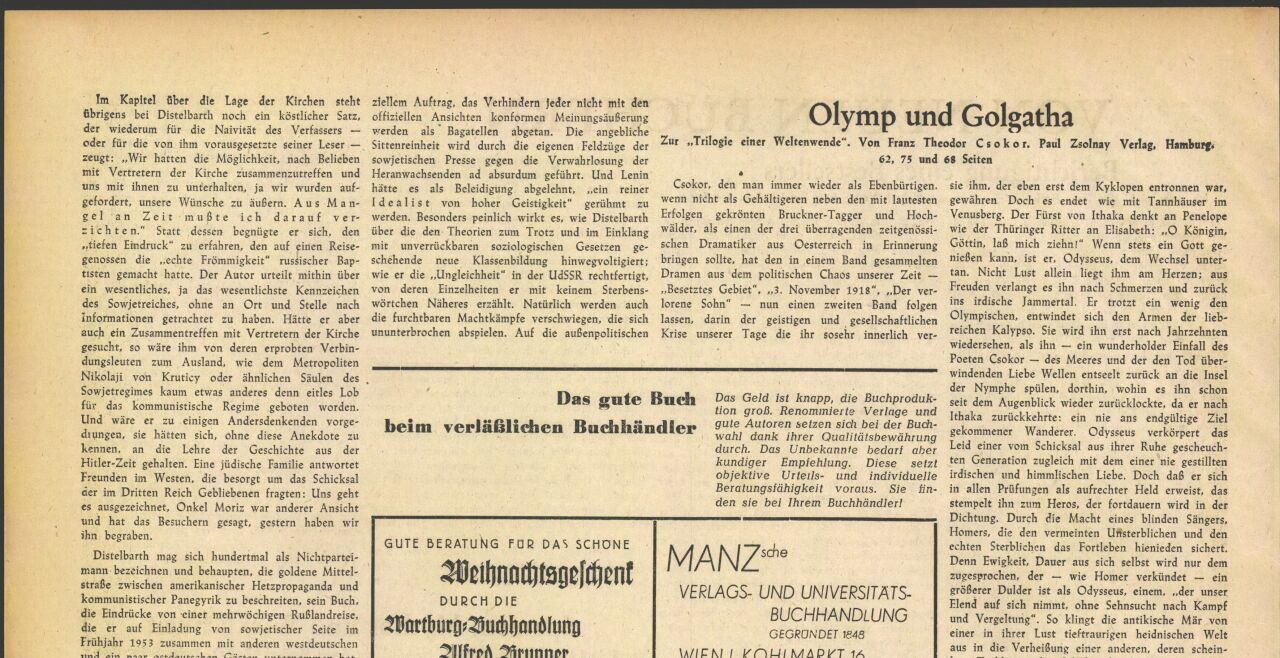
Zur „Trilogie einer Weltenwende“, Von Franz Theodor Csokor. Paul Zsolnay Verlag, Hamburg,
62, 75 und 68 Seiten
Csokor, den man immer wieder als Ebenbürtigen, wenn nicht als Gehältigeren neben den mit lautesten Erfolgen gekrönten Bruckner-Tagger und Hochwälder, als einen der drei überragenden zeitgenössischen Dramatiker aus Oesterreich in Erinnerung bringen sollte, hat den in einem Band gesammelten Dramen aus dem politischen Chaos unserer Zeit — „Besetztes Gebiet“, „3. November 1918“, „Der verlorene Sohn“ — nun einen zweiten Band folgen lassen, darin der geistigen und gesellschaftlichen Krise unserer Tage die ihr sosehr innerlich ver wandte der Zeitwende gegenübergestellt wird. Man denkt an Gonzague de Reynold und seine die Spenglersche Lehre christlich vertiefende Theorie von den Untergängen und Uebergängen mit oder ohne Würde, die sich periodisch zwischen die Epochen fest gewähnter Ordnung und Ruhe ein- schieben. Man entsinnt sich aber auch des Gemäldes von Max Klinger, das einst vielen Staub aufgewirbelt hatte, des „Christus im Olymp“ und des, seltsamwundersam Hellenisches und Christliches miteinander vermengenden, großen polnischen ‘Symbolisten Stanislaw Wyspianski. Csokor, der das eben genannte Bild gut kennen dürfte und dem die neuere polnische Dichtung wohlvertraut ist, mag bewußt oder unbewußt von beiden den Anstoß empfangen haben, die Begegnung zwischen der Welt Homers und der des Evangeliums s o zu schildern, wie er es in seiner gleichermaßen von Beherrschung der dramatischen Technik wie von hinreißender Sprachgewalt und einfühlsamer Kunst des Durchdringens seelischer Untiefen zeugenden Trilogie getan hat.
An ihr ist nicht nur die Vollkommenheit des Aufbaus, der spannenden Handlung, des geistreichen, stellenweise geradezu shakespearischen Dialogs bemerkenswert. Das Bewunderungswürdigste an Csokors Theaterstücken, die zugleich gar sehr und gar nicht Theater sind, dünkt uns, daß sie sowohl aufs getreueste dem zeitlichen und örtlichen Rahmen entsprechen, in dem sich das Geschehen abspielt, als auch in geheimnisvoller, unnachahmbarer Weise im Leser, im Zuschauer das Empfinden wecken, diese längst begrabenen Männer und Frauen, diese längst verklungenen Umwelten gehen uns nahe an. Dem liegt die tiefe, philosophisch, religiös und historisch begründete Ueberzeugung von der Einheit des Menschengeschlechts (nicht nur aller Rassen, sondern auch aller Jahrtausende) zugrunde. Regierungssysteme, Gesellschaftsordnungen, Weltanschauungen, Kleidung und Sitte mögen sich wandeln, das Herz und der Sinn der Erdgeborenen bleiben dieselben. Und so dürfen wir nicht darob erstaunen, daß Situationen aus unserer Gegenwart schon im klassischen Altertum dagewesen sind; daß dessen Kinder auf mannigfache Erlebnisse und Gegebenheiten nicht anders reagieren als wir Fleutigen. Soweit es sich nämlich ums allgemein Menschliche dreht; denn die Unterschiede der Epochen, der Länder, der Völker, der Gesellschaftsklassen, sie machen sich geltend und das Einmalige des Individuums, seiner vom freien Willen gelenkten Entscheide wird von einem Poeten des weltweiten Wissens und der jenseitigen Einsichten wie Csokor nicht unterschätzt.
Seine Trilogie der sinnlichen und übersinnlichen Sehnsucht ist in den harten Jahren des Krieges und des unmittelbaren Nachkriegs entstanden. „Kalypso“ auf der jugoslawischen’Insel Korcula 1941, als der Dichter eine Irrfahrt aus der mit Hilfe allerlei trojanischer Pferde überwältigten Heimat nach Dalmatien geflüchtet war, von wo es ihn dann noch weiter, nach Italien, trieb. Hier, da er sich, getränkt vom Geiste der Antike, wie zu Hause fühlte, kam ihm die Inspiration zu dem erst später in Paris 1952 vollendeten Stück „Cäsars Witwe“. Dazwischen schiebt sich, nach der Handlungszeit das letzte, in Rom 1947 abgeschlossen, die Bilderfolge des „Pilatus". .
Kalypso: der hernach göttlich genannte, sehr menschliche, allzu menschliche und, wenn es um die Rache oder Rettung ging, unmenschliche Dulder Odysseus, ist auf seiner vielbewegten Heimreise zur fraulichen Nymphe gelangt, die ihn liebend fest- halten möchte. Rast und wolkenlose Seligkeit will sie ihm, der eben erst dem Kyklopen entronnen war, gewähren Doch es endet wie mit Tannhäuser im Venusberg. Der Fürst von Ithaka denkt an Penelope wie der Thüringer Ritter an Elisabeth: „O Königin, Göttin, laß mich ziehn!“ Wenn stets ein Gott genießen kann, ist er, Odysseus, dem Wechsel untertan. Nicht Lust allein liegt ihm am Herzen; aus Freuden verlangt es ihn nach Schmerzen und zurück ins irdische Jammertal. Er trotzt ein wenig den Olympischen, entwindet sich den Armen der liebreichen Kalypso. Sie wird ihn erst nach Jahrzehnten Wiedersehen, als ihn — ein wunderholder Einfall des Poeten Csokor — des Meeres und der den Tod überwindenden Liebe Wellen entseelt zurück an die Insel der Nymphe spülen, dorthin, wohin es ihn schon seit dem Augenblick wieder zurücklockte, da er nach Ithaka zurückkehrte: ein nie ans endgültige Ziel gekommener Wanderer. Odysseus verkörpert das Leid einer vom Schicksal aus ihrer Ruhe gescheuchten Generation zugleich mit dem einer nie gestillten irdischen und himmlischen Liebe. Doch daß er sich in allen Prüfungen als aufrechter Held erweist, das stempelt ihn zum Heros, der fortdauern wird in der Dichtung. Durch die Macht eines blinden Sängers, Homers, die den vermeinten Unsterblichen und den echten Sterblichen das Fortleben hienieden sichert. Denn Ewigkeit, Dauer aus sich selbst wird nur dem zugesprochen, der — wie Homer verkündet — ein größerer Dulder ist als Odysseus, einem, „der unser Elend auf sich nimmt, ohne Sehnsucht nach Kampf und Vergeltung“. So klingt die antikische Mär von einer in ihrer Lust tieftraurigen heidnischen Welt aus in die Verheißung einer anderen, deren scheinbare Trübheit wahre Seligkeit beschert. Das in seiner Problemstellung so ernste, tragische Stück mildert die ihm sonst verhängte Düsternis durch die Anmut der Sprache und der den Schauspielern zugedachten Gebärden, nicht zuletzt auch durch die eingefügten Figuren des bei aller Feierlichkeit des Psychopompos ein wenig offenbachschen Hermes und der ganz offenbachschen koketten, schönen Galathea. Ist „Kalypso“ ein gutes Ideendrama, so betrachten wir „Caesars Witwe“ und den „Pilatus“ als untadelige Meisterwerke von shakespearischer Größe. Diesem wohlabgewogenen Urteil wird jeder Unbefangene beipflichten, der sie, erstaunt und beglückt, derlei in unserer Epoche aufzuspüren, nachdenklich liest. Nicht daß man dabei die kleinlichen Maße des die Exaktheit aller Realien untersuchenden Kritikasters anlegen dürfte. Es finden sich, zumal in „Cäsars Witwe“, genug bewußte und manche unfreiwillige Anachronismen oder Anatopismen. Die geschichtliche Calpurnia hat mit der reinen Gestalt, um die Csokor sein Drama rankt, wenig gemeinsam. Man mag darüber lächeln, daß der Dichter eine jüdische Zofe der Calpurnia als Kandidatin für den Eintritt in den Kreis der hocharistokratischen Vestalinnen vorstellt. Unerfindlich bleibt, warum Csokor den Barabbas mit einer, den Sinn des Namens — „Sohn des Vaters“ — zerstörenden, falschen Orthographie (Barrabas) bedenkt. Doch was besagt das vor einem Vollbringen, das dreierlei Themen bewältigt: die Auseinandersetzung zwischen Diktafur und Demokratie; der große und der ganz kleine Mann als Mitschöpfer und als Gefangene der Zeitgeschichte; das Heilige inmitten der ihm widrigen Welt. Im Gespräch des Augustus mit Calpurnia versucht der Prinzeps seine Proskriptionen und seine ändern Rechtsbeugungen mit dem Frieden und mit der Prosperität, kurz, mit den „herrlichen Zeiten“ zu rechtfertigen, die er dadurch dem Römervolk verschafft hat, auch mit dem Unheil, das sonst über das Reich hereingebrochen wäre. Calpurnia, der das sittliche Gewissen Urteil und Verhalten vorschreiben, erkennt das Nutzlose, nicht nur das Böse aller Untaten, sie mögen sich in was immer für Mäntelchen hüllen. Zwar vermag sie sich selbst nicht davor zu schützen, daß sie nach ihrem Tode als Gegenstand eines der Propaganda für Augustus und sein Regime dienenden Kults benutzt wird, doch ihr Triumph ist nicht von dieser Welt. Er drückt sich aus im Glauben und Hoffen der vielen, nie allzu vielen, die nur Gegenstand und Komparserie der geschichtlichen Vorgänge sind. In einer, wir wiederholen es nachdrücklich, shakespearischen Schlußszene, wird dies in die Sätze der Leichenwäscherinnen zusammengefaßt, die am Totenbett der Calpurnia Gespräche in der Art einer „Mutter verlorene Courage“ führen. Das klingt wie die rüpelhafte, tölpische Leitmelodie eines harrenden Advents in einem mittelalterlichen Mysterienvorspiel. Und schon setzt das Mysterium selbst ein. Mit höchster Kunst vermeidet es das gefährliche und eigentlich ungelingbare Wagnis, die heiligste Handlung, Christi Erlösungsopfer, auf die Bühne zu bringen. Csokor, Erbe der Antike und tief christlicher Dichter, verwendet jenen uralten Kunstgriff, den Homer gebrauchte, als er die Schönheit der Helene aus den Reden der von ihr entzückten Greise erraten ließ. Er beschwört auf die Szene nichts als den Nachhall des sühnenden Leids auf Golgatha. Wiederum ist damit, mit diesem hehren Thema, noch nicht der Ideengehalt des Dramas erschöpft. Es stehen noch zwei andere Fragen zur Erörterung: das Schicksal eines Volkes unter fremder Besetzung, das mystische Wirken der Gnade und Berufung. Als besonderen Reiz des Stücks haben wir zu rühmen, daß sogar hier, wo gar leicht die Grenzen des guten Geschmacks verletzt und religiöse Gefühle beleidigt werden könnten, dies nie erfolgt, obzwar sich Csokor vor jeder Süßlichkeit, ja zumeist vom Pathos frei hält und die erhabensten Dinge mit einem Zuschuß von Ironie, Witz und Esprit vorzutragen weiß. Auf das glücklichste ist ferner die Einordnung realer geschichtlicher, neutestamentarlicher Personen in eine imaginäre Handlung geraten, ob wir dem „reichen Jüngling“ aus dem Evangelium als einem Cicisbeo der Gattin des Pilatus begegnen, den hernach die wiederholte Stimme der Berufung aus doppelter Ver- stricktheit in Sünde und Volksverrat herauslöst; ob wir die gerade, spröde Gestalt des Hauptmanns Lon- ginus mit blutvollem Leben erfüllt sehen; ob Barabbas als vom Räuberhauptmann zum Widerstandskämpfer gewordener neutestamentarischer Vorläufer, hier des Maquis, dort der Irgun Zvai Leumi erscheint. Und wie unvergleichlich sind diese beiden gezeichnet. Pontius Pilatus, ganz anders, weniger abstrakt als etwa bei Anatole France — übrigens will uns auch Csokors Barabbas in seinen wenigen Szenen besser gefallen als Per Lagerqvists Romanheld —, und der Prätor Felix! Herrlich, wie die gesamte Trilogie, ist der Ausklang. Wie stets bei Csokor, ein knapper, straffer Dialog, der das Wesentlichste zugleich lapidar zusammendrängt und in eine transzendentale Atmosphäre einschwingt. Lange noch schwingt aber, klingt die innere Musik dieses reinen, vollkommenen Kunstwerks im ergriffenen Leser nach.