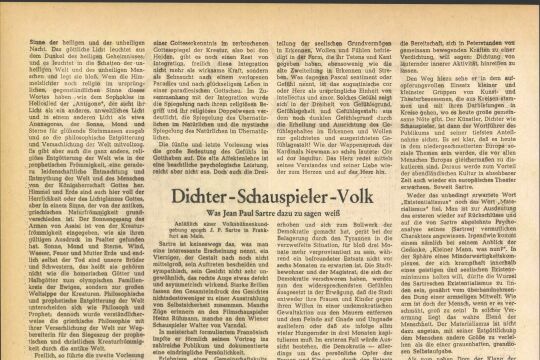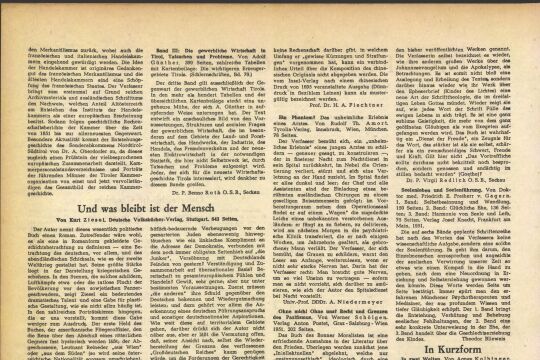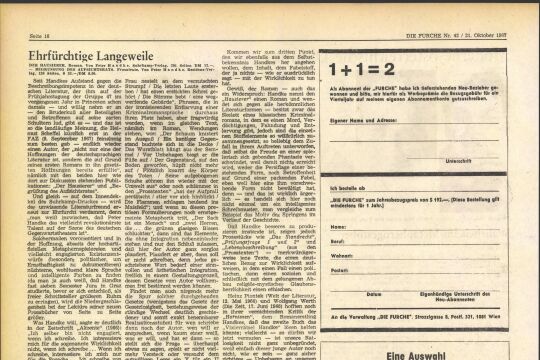Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
OST-BERLIN — MON AMOUR
Da paradieren, trippeln, tänzeln Militärkapellen und bieten in ihrer Marschordnung, mit den durch die Luft wirbelnden Tambourstöcken und Instrumenten jenen Anblick, der nicht selten auch dem Kenner des in Jahrhunderten geprägten Zeremoniells grotesk erscheint. Zu den flott geschnittenen Bildsequenzen ertönt „schräge“ Musik. Nach einer Weile stellt der unsichtbare Kommentator die Frage, wo diese Szenen sich wohl abspielen — etwa in Paris oder auf britischem, amerikanischem Boden? Die Antwort nennt West-Berlin. Worauf wieder gefragt wird — diesmal nach dem Charakter: „Eine Stadt wie jede andere?“
So beginnt, propagandistisch nicht ungeschickt, der programmfüllende Dokumentarfilm „Schaut auf diese Stadt!“ von Karl Gass. Es handelt sich dabei um einen der verschiedenen, von der DEFA unternommenen Versuche, kine-matographisch zur Mauer vom 13. August 1961 Stellung zu nehmen, das heißt, sie als „Grenzsicherungsmaßnahme der DDR“ zu rechtfertigen. Nachdem der Westen dieses Thema schon früh aufgegriffen und vom Thriller amerikanischer Herkunft bis zum puren Jux, den die Italiener sich (freilich neben einer seriösen Behandlung in „Berlin heute“) mit Toto und Peppino de Filippo leisteten, mehrfach verkinot und auch televisionistisch „verheizt“ hatte, konnte, wollte die Ost-Berliner Staatsfilmproduktion dem nicht nachstehen. Und so legte sie das Sujet, den „großen nationalen Stoff unserer Zeit“, denn gleich in Serie auf — dies allerdings nur auf dem Spielfilmsektor, wo in rascher Folge „ ... und deine Liebe auch“, „Der Kinnhaken“, „Sonntagsfahrer“ heruntergekurbelt wurden.
Am Anfang aber stand die Dokumentation oder das, was Ulbrichts Filmbeflissene so nennen: „Schaut auf diese Stadt!“ Der ironisch gemeinte Titel ist ein Zitat des verstorbenen Ernst Reuter, der, wie erinnerlich, 1947 zum Oberbürgermeister von ganz Berlin gewählt, durch sowjetischen Einspruch aber an der Übernahme des Amtes gehindert worden war. Das zeigt der Streifen natürlich nicht. In der oben skizzierten Einleitung wird auch mit keinem Wort, keinem Bild erwähnt, daß gegenwärtig Streitkräfte der Roten Armee an der Spree stehen — da sind nur die westlichen Alliierten, die „NATO-Gangster“. Ausweislich des auf der Leinwand sogar recht ausführlich Dargestellten eroberten die Sowjets Berlin, und damit basta. Der geschichtsklitternde Rückblick, die in gleicher Weise fragwürdige Schilderung der Situation bis zur Errichtung der Mauer ist „parteilich“ einseitig, spart — von der Blockade des Jahres 1948 über den revolutionären 17. Juni bis zu dem sich katastrophal auswirkenden und letztlich den 13. August bewirkenden Flüchtlingsstrom — wesentliche Ereignisse-aus?1 ' '
Die Einseitigkeit des, wie die In Ost-Berlin erscheinende „Deutsche Filmkunst“ meint, „mit juristischer Beweiskraft detaillierte geschichtliche Vorgänge erhellenden“ Pamphlets reicht bis in die stilistisch uneinheitliche, zwischen Satire und Agitation schwankende Form: Alles das, zum Beispiel, was West-Berlin als den „Tummelplatz des imperialistischen Militarismus“, den „Pfahl im Fleisch der DDR“, die „billigste Atombombe“ ausweist, ist — sofern der teilweise in hanebüchenem Deutsch verfaßte Text des Karl Eduard von Schnitzler nicht gerade kommentiert — mit Schlagermusik unterlegt; die Aspekte des „demokratischen Sektors“ dagegen begleiten Anleihen aus Beethovens Chorphantasie und 5. Symphonie. Plumper, primitiver geht es nicht mehr.
Nicht mehr? Aber gewiß doch! Unfreiwillig und schier mühelos lieferten die Mauerfilmer in Babelsberg mit dem Lichtspiel „... und deine Liebe auch“ (der Titel ist der Refrain einer volkseigenen Schnulze) den Beweis. Hier wird beispielsweise der „Grenzgänger“ Klaus — abgesehen davon, daß man ihm eine eigene, freilich als „politischen Analphabetismus“ gebrandmarkte Meinung über das Leben im allgemeinen und das im Arbeiter- und Bauernstaat im besonderen konzediert — als staatsfeindliches Subjekt rein äußerlich wie folgt charakterisiert: Er gewinnt im Glücksspiel, rasiert sich elektrisch, raucht fortgesetzt „Stuyvesant“, macht das Bett nicht und trägt „Fliege“. Demgegenüber erscheint der linientreue Glühlampenfabriksarbeiter, Funkamateur und spätere SED-Kampftruppler Ulli, als von Fortuna weniger begünstigt, meist unrasiert, nicht rauchend, als ordentlich möblierter Herr, der aus seiner Abneigung gegen Krawatten oder sonstiges kapitalistisches Halsgebinde kein Hehl macht. Die Dritte im Bunde, das heißt in der läppischen Dreiecksgeschichte, ist die brillentragende Postbotin Eva, die zunächst unentschieden zwischen den beiden Männern pendelt und bis zu ihrer Erleuchtung, teils pseudophilosophisch („Wenn man weiß, was man will, ist man nicht einsam“), teils, wie ein Kritikergenosse zu Recht rüffelt, backfischhaft-schwül („Aber etwas ist in mir, das ist manchmal stärker als ich; dann kommt das komische Kribbeln, und ich bin richtig wehrlos“) Tagebuch führt. Nun, der 13. August vertreibt das „komische Kribbeln“; er läßt sie reifen und sich für den Mauerwächter Ulli entscheiden, obwohl sie von Klaus ein Kind erwartet. Dieser aber landet wegen versuchter „Republikflucht“ in einem Strafarbeitslager, wo er zur Einsicht gelangt beziehungsweise gebracht wird.
Formal ist die reichlich konstruiert wirkende, schon bei der Konzeption verunglückte Polit-Schnulze ebenfalls ein Fehlschlag — ein blamabler dazu: Autor Paul Wiens^ Regisseur Frank Vogel und Kameramann Günter Ost wollten hier nämlich die „nouvelle vague“, mehr noch Alain Resnais kopieren. Die zu diesem Ende strapazierten Mittel wie etwa forsche optische Zugriffe ins Alltagsleben, in reale politische Geschehnisse (vom •Ostberliner Titow-Besuch bis zum Panzeraufmarsch am „Checkpoint Charlie“), ferner die Auflösung der Dialoge in „innere Monologe“ und Kommentare, die kontrapunktische Zuordnung von Bild und Wort tragen nicht, wie offenbar beabsichtigt, zur Veranschaulichung, zur Erklärung, Erhellung der rein vordergründig angelegten und dargestellten Geschichte bei, sondern verundeutlichen sie, erschweren das Verständnis zuweilen in einem Umfang, daß das ratlose Publikum sich, wie in Ost-Berlin und in anderen Städten der DDR geschehen, nur noch durch Gelächter zu helfen weiß.
Dessenungeachtet schreckte der nationalpreisgekrönte Drehbuchautor nicht davor zurück, den Mißgriff in direkte Beziehung zu „Hiroshima — mon amour“ zu setzen. Resnais sollte sich diesen Vergleich verbitten.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!