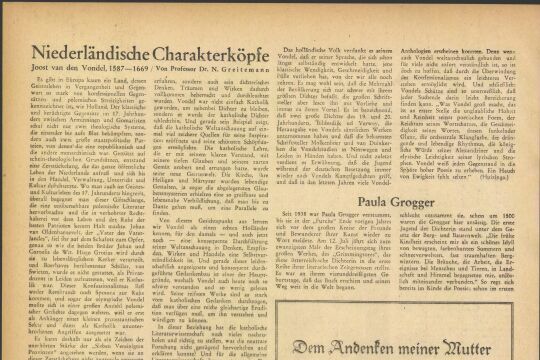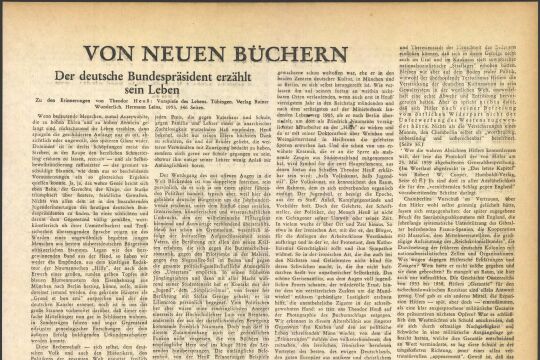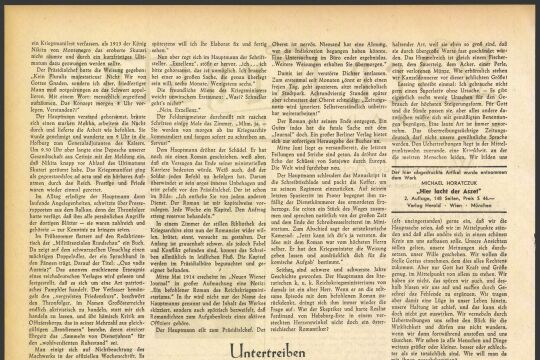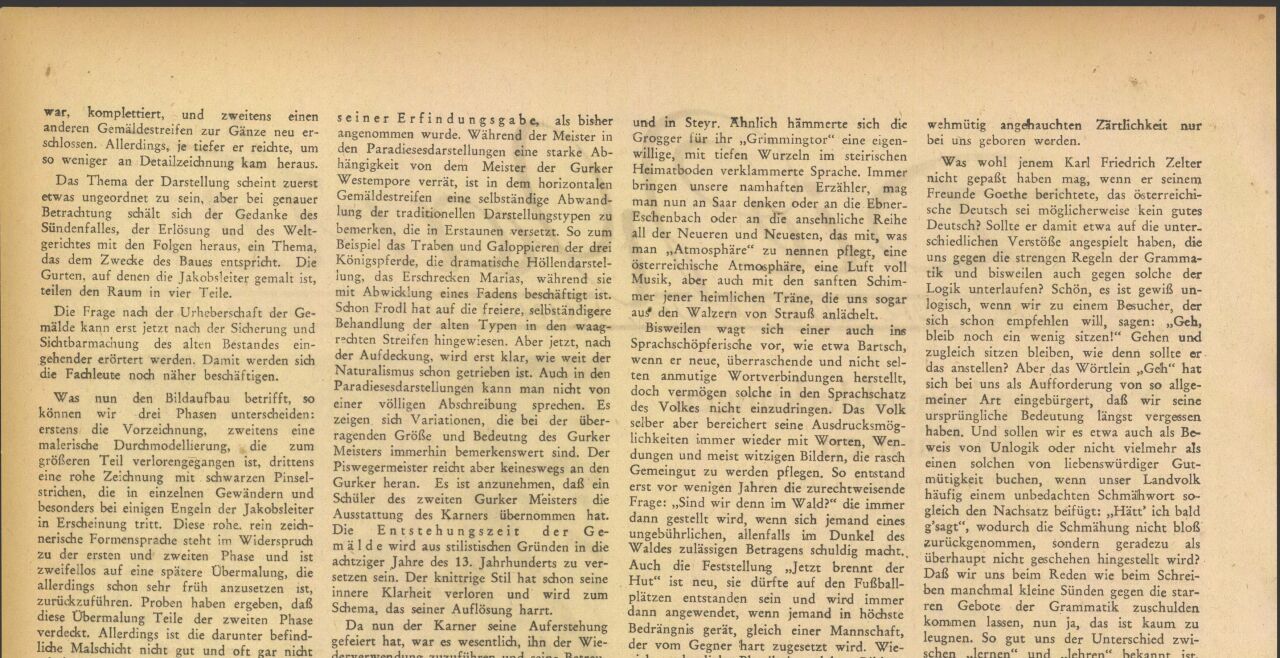
In den nachgelassenen Schriften des Sdtweizer Heinrich Federer, des vielgelesenen und vielgeliebten Erzählers im Priesterrock, findet sich der Satz: „Die große deutsche Orgel — so nenne ich unsere schöne, tiefe, heilige Muttersprache.“ Sinnend verweilt man im Banne dieses Bildes, nicht ohne sich ein wenig zu wundern, wenn Federer es in der nun folgenden Betrachtung nicht dahin ausbaut, daß er die große deutsche Orgel verschiedentlich erklingen läßt, je nach den Registern der unterschiedlichen Spielarten der deutschen Sprache.
Unsere österreichischen Mundarten weisen nidit bloß von Bundesland zu Bundesland, sondern häufig genug sogar von Tal zu Tal eine erstaunliche Mannigfaltigkeit auf, man könnte finden, eine größere, als unserem kleinen Österreich räumlidi zukommt. Freuen wir uns getrost solcher Vielfalt, die wir ja auch in Tracht und Brauchtum, in Lied und Tanz antreffen. Bezeugt uns doch auch sie wieder einmal die geisrige Beweglichkeit und den Einfallsreichtum unseres Volkes. Freilich durchläuft die Fülle dieser Mundarten allzu viele Wandlungen, als daß sich aus ihr der einheitliche Begriff eines „österreichischen Deutsdi“ gewinnen ließe, den man in Vergleich setzen könnte mit dem sozusagen „deutschen Deutsch“. Wir müssen uns da schon vorwiegend an die Schriftsprache halten, nicht ohne Bedauern, denn wir erkennen nun einmal in der Mundart den gültigeren Ausdruck des Volkes, und wenn man häufig von einem „reinen Schriftdeutsch“ reden hört, so wollten wir es ruhig darauf ankommen lassen, ob das, was diesem in den letzten Jahrhunderten zuwuchs, wirklich „reiner“ ist, als das, was ihm verlorenging, während es von unseren Mundarten großenteils getreulich beibehalten wurde. Der unvergessene Eduard Pötzl schrieb einmal, man bespöttle dort Wien gerne als eine Stadt von lauter „Haltern“, weil in der wienerischen Mundart das Wörtlein „halt“ so reichliche Verwendung finde, und weist dann nach, daß dieses Wort schon im Nibelungenlied in der gleichen Bedeutung zu finden ist.
Nur oberflädilicher Betrachtung kann Scheines, als decke sich unser österreichisches Schriftdeutsch völlig mit jenem, das man in Deutschland, im nördlichen vor allem, schreibt und spricht. Freilich ergeben sich die Unterschiede weniger aus Wahl und Form einzelner Worte, als aus Tonfall und Rhythmus der Sprache, wie sie sich durch die Anordnung der Worte und das Gefüge der Sätze einstellen. Solcherart macht sich im österreichischen Schriftdeutsch immer wieder die größere Schlichtheit spürbar, zugleich meist aber auch die innigere Gefühlswärme und traulichere Herzensnähe. Das wird uns beispielsweise bewußt, wenn wir die Mutterbriefe der Maria Theresia lesen, denen an Herzlichkeit nur wenige der außerhalb Österreichs geschriebenen, berühmten deutschen Briefe gleichkommen, vielleicht bloß die der Frau Rat Goethe und Mörikes.
Als das geeignetste Forschungsfeld für die Erkenntnis der österreichischen Sprachart müssen sich naturgemäß die Bücher unserer Dichter erweisen, der Erzähler vor allem, da sidi ja Lyrik und Drama zumeist in anderen, dem Alltagsgebrauch entrückten, gewissermaßen festlidt erhöhten Sprachformen entfalten. Nun wird gerade in der Erzählung das deutsche Schrifttum immer wieder durch Österreicher auf das wertvollste bereichert, ja wir dürfen den Mann, den das gereifte Urteil seiner Nachwelt immer nachdrücklicher schlechthin als den größten Erzähler deutscher Zunge erkennt, zu den Unsrigen zählen: Adalbert Stifter. Im Banne Jean Pauls, der Romantiker und Goethes stehend, meidet Stifter peinlich jeden mundartlichen Anklang und läßt selbst seine volkstümlichsten Gestalten, alle die Pechbrenner, Holzfäller und Beerensucher des Böhmerwaldes in strengem Schriftdeutsch reden. Dennoch ist seine Darstellungsweise unverkennbar österreichisch; seine liebevolle Vertiefung in Einzelheiten, sein gewissenhaftes Verweilen bei scheinbar Nebensächlichem, seine bedächtige Gelassenheit, all das entspricht durchaus der erzählenden Art unseres Volkes. Das nun konnte der Norddeutsche Hebbel ganz und gar nicht verstehen, darum lehnte er Stifter mit fast feindseligem Hohn ab und versprach bekanntlich dem, der nachweisen könne, ohne unbedingte Nötigung den ganzen „Nachsommer“ ausgelesen zu haben, die Krone Polens. In Stifters Erzählungen findet die „träumende Seele“ unseres Volkes, von der Hugo von Hofmannsthal einmal sprach, ihre reinste Deutung, österreichisch an ihm ist auch die zarte und schamhafte Scheu, mit der er heftige Äußerungen der Leidenschaft meidet.
Rosegger schuf sich, abrückend von der steirischen Mundart, seiner beiden ersten erzählenden Bücher, mit vielem Glück eine Sprache, die sich fast nur noch ihre eigenartig anheimelnde Melodik zu ihrer Herkunft bekennt. Ungemein fesselt die Sprache in den historischen Romanen der Kandel-Mazzetti, dieses altertümliche, wie das Kupfer hochbejahrter Türme edel patinierte, mit mundartlichen Anklängen kräftig untermalte Deutsch, von dem wir uns willig überzeugen lassen, daß es so und nicht anders ehedem im Österreich unter der Enns geredet wurde, rund um den Taferlberg und in Steyr. Ähnlich hämmerte sich die Grogger für ihr „Grimmingtor“ eine eigenwillige, mit tiefen Wurzeln im steirischen Heimatboden verklammerte Sprache. Immer bringen unsere namhaften Erzähler, mag man nun an Saar denken oder an die Ebner-Eschenbach oder an die ansehnliche Reihe all der Neueren und Neuesten, das mit, was man „Atmosphäre“ zu nennen pflegt, eine österreichische Atmosphäre, eine Luft voll Musik, aber auch mit den sanften Schimmer jener heimlichen Träne, die uns sogar aus den Walzern von Strauß anlächelt.
Bisweilen wagt sich einer auch ins Sprachschöpferische vor, wie etwa Bartsch, wenn er neue, überraschende und nicht selten anmutige Wortverbindungen herstellt, doch vermögen solche in den Sprachschatz des Volkes nicht einzudringen. Das Volk selber aber bereichert seine Ausdrucksmöglichkeiten immer wieder mit Worten, Wendungen und meist witzigen Bildern, die rasch Gemeingut zu werden pflegen. So entstand erst vor wenigen Jahren die zurechtweisende Frage: „Sind wir denn im Wald?“ die immer dann gestellt wird, wenn sich jemand eines ungebührlichen, allenfalls im Dunkel des Waldes zulässigen Betragens schuldig macht.. Auch die Feststellung „Jetzt brennt der Hut“ ist neu, sie dürfte auf den Fußballplätzen entstanden sein und wird immer dann angewendet, wenn jemand in höchste Bedrängnis gerät, gleich einer Mannschaft, der vom Gegner hart zugesetzt wird. Wieviel anschauliche Plastik ist solchen Bildern eigen!
Kaum eine andere Spielart der deutschen Sprache bedient sich in Rede und Schri t mit solcher Vorliebe des Deminutivs, der Verkleinerungsform, wie die österreichische. Besonders der Norddeutsche geht mit ihrer Verwendung sparsam um, es scheint, als erlitten für sein Ohr die Worte durch die verkleinernde Form eine Einbuße an jener Festigkeit ihres Kerns, die er für wichtig hält. Unser Volk aber nützt aus seinem feinen Sprachgefühl heraus die reichen, durch die verkleinerte Form gebotenen Abwandlungsmöglichkeiten der Wortbedeutung und der Gefühlswerte. Das „Mutterl“ ist nicht immer eine kleine, aber eine geliebte Mutter. Indessen kann auch eine völlig fremde Frau so angeredet werden, soferne sie nur nach Alter und Gehaben einer richtigen Mutter gleicht. Das „Brüderl“ braucht kein kleiner Bruder, ja es braucht überhaupt kein Bruder zu sein, man kann durch solche Anrede jeden Menschen eine gewisse vertrauliche Gewogenheit spüren lassen, wie das im Hobellied aus Raimunds „Verschwender“ sogar der Tod tut, wenn er sein Opfer nicht grimmig, sondern wienerisch gemütlich antritt. Deutliche Ironie stempelt das Liebespaar zum „Pärchen“, dieses aber wandelt sich versöhnlich zum „Paarl“ wenn durch Ehe oder Verlöbnis ein „solides“ Verhältnis hergestellt ist. Der Dichterphilosoph Richard Kralik sagte einmal im Freundeskreis, er warte nicht mehr auf das Glück, sondern bescheide sich dankbar mit dem Glückerl. Das Wort „Glückerl“ habe er in irgendeinem belangslosen Volksstück oder Singspiel gehört und es sei ihm haften geblieben als ein gutes, merkenswertes Wort. Es konnte in seiner witzig und zugleich wehmütig angehauchten Zärtlichkeit nur bei uns geboren werden.
Was wohl jenem Karl Friedrich Zelter nicht gepaßt haben mag, wenn er seinem Freunde Goethe berichtete, das österreichische Deutsch sei möglicherweise kein gutes Deutsch? Sollte er damit etwa auf die unterschiedlichen Verstöße angespielt haben, die uns gegen die strengen Regeln der Grammatik und bisweilen auch gegen solche der Logik unterlaufen? Schön, es ist gewiß unlogisch, wenn wir zu einem Besucher, der sich schon empfehlen will, sagen: „Geh, bleib noch ein wenig sitzen!“ Gehen und zugleich sitzen bleiben, wie denn sollte er das anstellen? Aber das Wörtlein „Geh“ hat sich bei uns als Aufforderung von so allgemeiner Art eingebürgert, daß wir seine ursprüngliche Bedeutung längst vergessen haben. Und sollen wir es etwa auch als Beweis von Unlogik oder nicht vielmehr als einen solchen von liebenswürdiger Gutmütigkeit buchen, wenn unser Landvolk häufig einem unbedachten Schmähwort sogleich den Nachsatz beifügt: „Hätt' ich bald g'sagt“, wodurch die Schmähung nicht bloß zurückgenommen, sondern geradezu als überhaupt nicht geschehen hingestellt wird? Daß wir uns beim Reden wie beim Schreiben manchmal kleine Sünden gegen die starren Gebote der Grammatik zuschulden kommen lassen, nun ja, das ist kaum zu leugnen. So gut uns der Unterschied zwischen „lernen“ und „lehren“ bekannt ist, so beharrlich pflegen wir ihn zu ignorieren, ja es würde sich kurios anhören, wenn der einfache Mann fragen wollte: „Wer hat dich denn das Klavierspielen gelehrt?“ statt: „Wer hat es dir denn gelernt?“ Grillparzer berichtet in seinen Notizen über die Entstehung der „Ahnfrau“, er habe sich damals mit zwei verschiedenen dramatischen Plänen getragen, aber eines Morgens, „im Bette liegend“, hätten sie sich ihm plötzlich vereinigt. Natürlich ist dieses „im Bette liegend“ grammatikalisch unmöglich, und schriebe dergleichen ein Schüler in sein Aufsatzheft, so geriete der zürnende Rotstift des Lehrers eilig in Bewegung. Wir dürfen kaum annehmen, daß dem Dichter, der sich im „Armen Spielmann“ auch als großer Erzähler von gewissenhafter Formkultur erwies, dieser „Fehler“ unbewußt unterlaufen sei, vielmehr genehmigte er sich die kleine Schlamperei wohl darum, weil sie ihm die Umständlichkeit eines eingeschobenen Nebensatzes ersparte, zumal sie ja auch den Sinn nicht gefährdete, denn es ist unmißverständlich, daß keineswegs die beiden Ideen im Bette lagen.
Wir bedienen uns unseres österreichischen Deutsch freudig als einer rotbackig gesunden, vollsaftigen, lebendig beweglichen Sprache, die uns nie im Stiche läßt, in der wir loben und lieben können, aber auch, wenn's nottut, wacker schelten, in der wir betend mit unserem Herrgott reden können, in der wir alles, auch das Zarteste, Innigste und Heimlichste sagen können — aber auch verschweigen, denn auch dies gehört zu einer rechtschaffenen Sprache. Und so rauscht, wo österreichisch geredet wird, die große deutsche Orgel wahrlich nicht in den kärgsten ihrer Register auf.