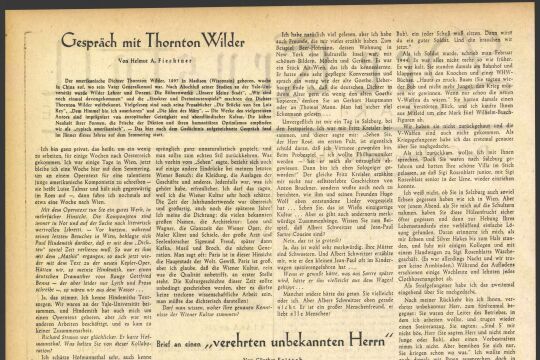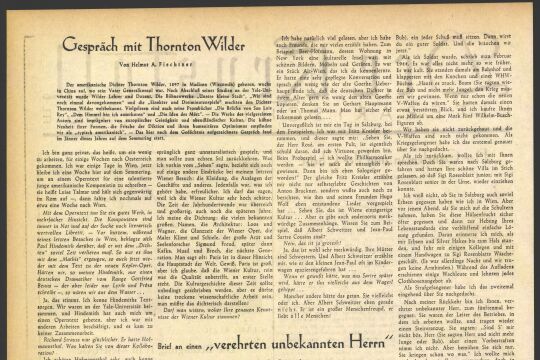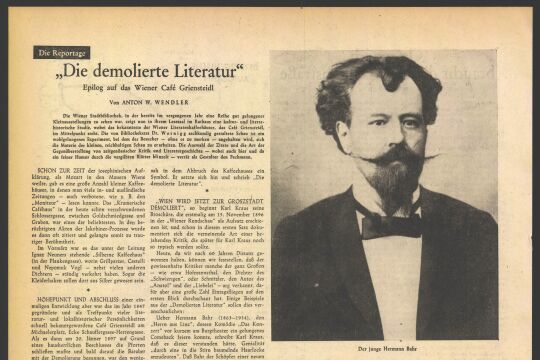Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Panorama der Schnitzler-Welt
In einem Wiener Brief aus dem Jahre 1922 an die amerikanische Zeitschrift „The Dial“ schrieb Hohnannsthal anläßlich einer Würdigung von Arthur Schnitzlers dramatischem und erzählendem Werk: „Es handelt sich um eine ganz bestimmte soziale Nuance und mentale Nuance zugleich, die sehr charakteristisch bleiben wird für die Zeit zwischen 1890 und dem großen Krieg und die man vielleicht später kurzweg die Schnitzlersche Welt nennen wird...“ Heute, 40 Jahre später und 30 Jahre nach dem Tod Arthur Schnitzlers (dessen 100. Geburtstag am 15. Mai dieses Jahres gefeiert wurde), ist es so weit: Wir können aus Schnitzlers umfangreichem Werk wenn nicht eine ganze Epoche, so doch das Gesicht und die Lebensformen einer bestimmten Gesellschaftsschicht rekonstruieren, eines gewissen wohlhabenden Wiener Bürgertums, das für uns so weit entfernt ist, so sehr dahin und versunken wie das galante französische 18. Jahrhundert oder wie der von Jacob Burck-hardt, Nietzsche und C. F. Meyer kultivierte „Renaissancismus“ mit seinem Ideal vom Leben und Sterben in Schönheit — zu dem übrigens die Menschen der Schnitzler-Zeit sich zuweilen hingezogen fühlten ...
Arthur Schnitzler lebte mit und in dieser Wiener Gesellschaft, und er war zu gleich ihr unbestechlich-kühler Diagnosti ker und Schilderer. Als Enkel, Sohn, Bru der und Schwager von Ärzten ist er aucl als Dichter Arzt geblieben. Er sah überal und sein ganzes Leben lang „Fälle“ psychologische und tiefenpsychologischi vor allem, in die freilich — war er j: selbst praktizierender Arzt — das Sorna tische sehr bedeutungsvoll hineinspielt Und er repräsentiert unter den Deutsch-schreibenden seiner Generation vielleichi den ausgeprägtesten Typus des großstädti sehen Schriftstellers, für den die Stadl selbstverständlicher und natürlicher Lc bensraum ist.
Aber hier muß gleich eine Ergänzung eine Korrektur, angebracht werden Schnitzler war ein Wiener Großstädter, und an seine spätere Frau schreibt er: „Der Natur stehe ich in Wirklichkeil herzlicher, ja, das ist das Wort, herzlicher gegenüber als allem andern auf der Welt und ich glaube sehr, daß ich aus Landschaften und aus einer Luft, die mich umgab, mehr Glück oder wenigstens Beruhigung empfangen habe als aus Symphonien Frauen und Bildern.“ Einmal, so berichtet Olga Schnitzler, muß sie mit ihrem Mann Sizilien fluchtartig verlassen: So sehr bedrückte ihn die fremde Umwelt, und erst als man wieder von heimatlichen Wälderr und Bergen umgeben war, als der erst« Regen niederging, atmete der „Großstädter“ auf und entspannte sich...
Großstädtisch war Schnitzlers Lebensführung, seine Eleganz und Distanz. Intimitäten und Vertraulichkeiten Hebte er nicht, mit keinem seiner Freunde hat ei sich geduzt, mit Ausnahme eines einzigen, der ihm damals besonders fragwürdig war. („Ein liebenswürdig freier Mensch, im Gesicht Roheit, Güte, Geist, Schwindel-haftigkeit“, notiert er einmal über Hermann Bahr, mit dem ihn in späteren Jahren eine herzliche Freundschaft verband.) — Mahler bewunderte er, mit Sigmund Freud verband ihn vieles, allzuviel, wie er meinte, so daß sich ein persönlicher Kontakt erübrigte, ja geradezu verbot: Erst mit 60 Jahren hat er ihn kennengelernt, obwohl die Wertschätzung auf Gegenseitigkeit beruhte. Noch zwiespältiger wai sein Verhältnis zu Theodor HerzI: Den Menschen achtete er, den Schriftsteller versuchte er zu fördern, aber Herzls Ideen, die dieser erstmalig in seinem epochemachenden Buch „Der Judenstaat“ aufgezeichnet hat, stand er fremd gegenüber und meinte, daß dessen Palästinaplan ein nicht statthafter Fluchtversuch aus der Realität sei.
Schnitzler notiert einmal: „Wer je Mediziner war, kann nie aufhören, es zu sein. Denn Medizin ist eine Weltanschauung.“ Zum Beruf des Mediziners gehört aber nicht nur die Diagnose, sondern auch die Therapie. Er sei, sagt Schnitzler ferner, mehr Naturwissenschaftler als Dichter, und als solcher hat er die Menschen seiner Zeit geschildert: mit ihrem Egoismus und Hedonismus; mit ihrem Bewußtsein der Vergänglichkeit und der Verfallenheit an den Tod — das endgültig« Ende ohne Sinn; mit dem Gefühl, daß nichts von Dauer ist, „daß alles gleitet und vorüberrinnt“; daß es keine Treu« und keine beständige Liebe gibt. Mit der exponiertesten Werken dieser Art — dem „Reigen“ und dem „Leutnant Gustl“ -hat sich Schnitzler viele Feinde gemacht, Dazu muß allerdings gesagt werden, da( er die notwendigerweise vergröbernde Darstellung jenes „Totentanzes der Liebe“ auf der Bühne strikt abgelehnt hat und sich erst nach 1918 eine szenische Aufführung des „Reigens“ abnötigen ließ „Leutnant Gustl“, eines der ersten Beispiele des „monologue interieur“, beurteilen wir heute vielleicht anders ah jene, die dem Dichter wegen Verunglimp-
fung der Armee sein Offizierspatent aberkannten. Aber es bleibt auch so noch in Schnitzlers Werk des Fragwürdigen genug. Doch auch davon wußte Schnitzler, und in einem selbstkritischen Gespräch,
das Olga Schnitzler in ihrem lesenswerten Erinnerungsbuch zitiert, sagte er:
„Nicht ungestraft habe ich meine Kindheit und meine erste Jünglingszeit in einer Atmosphäre verbracht, die durch den sogenannten Liberalismus der sechziger und siebziger Jahre bestimmt war. Der eigentliche Grundirrtum dieser Weltanschauung scheint mir darin bestanden zu haben, daß gewisse ideelle Werte von vornherein als fix und unbestritten angenommen wurden, daß in den jungen Leuten der falsche Glaube erweckt wurde, sie hätten irgendwelchen klargesetzten Zielen auf einem vorherbestimmten Wege zuzustreben, um dann ohne weiteres ihr Haus und ihre Welt auf sicherem Grunde aufbauen zu können. Man glaubte damals zu wissen, was das Wahre, Gute und Schöne war, und das ganze Leben lag in großartiger Einfachheit da ...“ An dieser Welt hat Schnitzler in späteren Jahren zu zweifeln begonnen. Ferner: er wisse nicht, ob die Neigung, um jeden Preis wahr gegen sich selbst zu sein, immer in ihm gelegen war. „Sicher aber ist, daß sie sich im Laufe der Jahre gesteigert hat, ja, daß mir diese Neigung heute die lebhafteste und beständigste Regung meines Innern zu sein scheint.“ So gelten seine Angriffe allem bloß Schönrednerischen und Zwiespältigen, vor allem jener gerade in Österreich so beliebten „Zweigleisigkeit“: dem Literaten, dessen Leben einen ganz anderen Weg nimmt als sein Werk, dem Politiker, der ohne tiefere Verantwortung sein besseres Wissen für sich behält, weil angeblich gewisse Dinge sich nicht eignen, der Menge wahrheitsgemäß vorgestellt zu werden...
Immer wichtiger wird für Schnitzler auch die Verantwortung, die jeder zu tragen hat:
„Ohne unseren Glauben an den freien Willen wäre die Erde nicht nur der Schauplatz der grauenhaftesten Unsinnigkeit, sondern auch der unerträglichsten Langeweile. Verantwortungslosigkeit hebt jede ethische Forderung, kaum, daß sie ins Bewußtsein trat, als wesenlos wieder auf; das Ich ohne das Gefühl der Verantwortung wäre Uberhaupt kein Ich mehr, die Erde kein Schauplatz von Tragödien und Komödien, die sich zwischen Individuen abspielen, sondern ein läppisches oder trauriges Possenspiel zwischen frei waltenden Trieben, die sich zufällig in dem einen oder anderen Individuum verkörpern.“
Als Dichter bediente sich Schnitzler zweier Formen: des Theaterstücks und der Erzählung von mittlerer Länge, also nicht eigentlich jener prosaischen Kurzform, wie sie etwa Maupassant, Tschechow oder Kipling ausgebildet haben. Hinzu kommen die breiter angelegten Romane „Der Weg ins Freie“ und „Therese“. Hier und in zahlreichen anderen seiner Werke spielen die sozialen Probleme, für die sich Schnitzler nach der Meinung vieler Literaturhistoriker überhaupt nicht interessiert hat. eine wichtige Rolle. Am besten hat dem Zahn der Zeit Schnitzlers Sprache widerstanden: diese klare, schmucklose und zugleich musikalische Prosa, die vieles, ja das meiste hinter sich läßt, was im letzten Jahrzehnt des vorigen und in den ersten 30 Jahren des 20. Jahrhunderts geschrieben wurde.
Die zweibändige, rund 2000 Seiten umfassende Dünndruckausgabe der erzählenden Schriften des S.-Fischer-Verlages vereinigt sämtliche von Schnitzler selbst noch fertiggestellte Prosaarbeiten in ihrer jeweils letzten Fassung. Es sind deren (von „Welch eine Melodie“ aus dem Jahr 1885 bis „Flucht in die Finsternis“ von 1931) insgesamt 58, einschließlich der beiden großen inneren Monologe „Leutnant Gustl“
unA ..Fränlpin Flc?“ Ale Aen #hntA kun-
digen wie sorgfältigen (ungenannten!) Herausgeber vermuten wir den Sohn des Dichters, Dr. Heinrich Schnitzler. Den prosaischen Schriften sollen, in gleicher mustergültiger Ausstattung, die Theaterstücke bald folgen. Dann wird das Panorama der Schnitzler-Welt ganz überschaubar sein.
Eine überaus wertvolle Ergänzung findet diese Sammlung in dem Erinnerungsbuch von Olga Schnitzler, der Gattin des Dichters, die aus genauer Kenntnis, klug und diskret Schnitzlers Lebenskreis schildert und seinen nächsten Freunden (Hofmannsthal, Theodor Herzl, Hermann Bahr und Richard Beer-Hofmann) eigene Kapitel gewidmet hat.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!