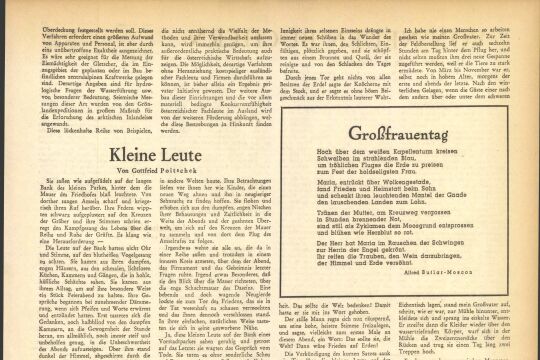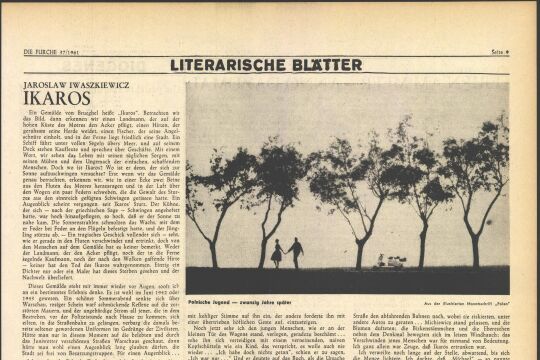Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Paradies mit Schönheitsfehlern
Von Kindheit an hatte der Wiener Georg Grünberg den Wunsch, Forscher zu werden. Dem Studenten schon ging diese Sehnsucht in Erfüllung: Er verbrachte acht Monate allein unter einem Indianerstamm des südlichen Amazonasgebietes am Rio dos Peixes, der wissenschaftlich noch unerforscht war. Mehrere günstige Umstände mußten zusammentreffen, um dieses Vorhaben trotz äußerst geringer finanzieller Mittel glücken zu lassen. Zu einem Stipendium der Universität in Sao Paulo verhalf ihm eine Empfehlung seines Professors, Dr. Haekel, vom Institut für Völkerkunde der Universität Wien. Prof. Dr. Baldus von der Universität Sao Paulo, Experte für Brasilienkunde, ebnete die Wege bei den brasilianischen Behörden. Harald Schultz, Assistent am Museu Paulista, half großzügig bei der Ausrüstung, der Missionar Pater Joao Dornstauder von der Frälatur in Diamantino erlaubte die Benützung eines Depots von Medikamenten am Posto Tatui. Auf seinen Rat wählte der junge Forscher den Stamm der Kayabi als Ziel, mit dem der Pater Seit 1955 guten Kontakt hatte.
Von Kindheit an hatte der Wiener Georg Grünberg den Wunsch, Forscher zu werden. Dem Studenten schon ging diese Sehnsucht in Erfüllung: Er verbrachte acht Monate allein unter einem Indianerstamm des südlichen Amazonasgebietes am Rio dos Peixes, der wissenschaftlich noch unerforscht war. Mehrere günstige Umstände mußten zusammentreffen, um dieses Vorhaben trotz äußerst geringer finanzieller Mittel glücken zu lassen. Zu einem Stipendium der Universität in Sao Paulo verhalf ihm eine Empfehlung seines Professors, Dr. Haekel, vom Institut für Völkerkunde der Universität Wien. Prof. Dr. Baldus von der Universität Sao Paulo, Experte für Brasilienkunde, ebnete die Wege bei den brasilianischen Behörden. Harald Schultz, Assistent am Museu Paulista, half großzügig bei der Ausrüstung, der Missionar Pater Joao Dornstauder von der Frälatur in Diamantino erlaubte die Benützung eines Depots von Medikamenten am Posto Tatui. Auf seinen Rat wählte der junge Forscher den Stamm der Kayabi als Ziel, mit dem der Pater Seit 1955 guten Kontakt hatte.
„Dennoch wären alle Bemühungen vergeblich gewesen, wenn mir nicht viele Brasilianer und die Kayabi selbst geduldig geholfen hätten“, betont Dr. Grünberg. Boote sind das einzige Verkehrsmittel, Flüsse die Straßen in den dichten Urwäldern des Maito Crosso, eines Gebietes in der Größe von halb Europa. Hier leben auch die Kayabd. Im Indianerdorf „Posto Tatui“ am Rio dos Peixes ist es eine Stammesgruppe von etwa 80 Menschen. Am 20. Jänner 1965 legten Gummisammler in einem Motorboot in der Nähe des Indianerdorfes „Posto Tatui“ am Rio dos Peixes an. Heraus stieg ein junger Forscher, der zugleich sein eigener Träger war. Er schleppte zwei große Kaffeesäcke über den schmalen Indianerpfad zum Dorf. Inhalt der Säcke war die Ausrüstung der „Einmannexpedition“: Lebensmittel für drei Monate, Bekleidung, Medikamente, Tagebücher, eine Kamera, ein Kleinkalibergewehr aus dem Museum von Sao Paulo und das „Hotelbett des Urwaldes“, die Hängematte mit dem Moskitonetz.
Wie würden die Einwohner den Fremdling empfangen? Freundlich oder mit Pfeilschüssen? Würden sie ihn für gefährlich oder harmlos halten? Den ungebetenen Gast dulden oder nicht? Vielerlei Gedanken gingen dem Studenten durch den Kopf auf dem Weg zu den Hütten der Indianer.
Die Kayabi zeigten sich zutraulich: Klein, geschmeidig und lächelnd umringten sie ihn und begrüßten ihn lautstark nach Art der Gummisammler, mit denen sie schon öfters in Kontakt gekommen waren. Für den Fremdling imitierten sie den fremden Gruß, auch wenn er ihnen, wie sich später herausstellte, nicht zusagte. „Die .bekleideten Feinde' (Bezeichnung der Indianer für die brasilianischen Gummisammler) sind wie die Affen, machen immer nur Lärm, wenn sie zusammenkommen“, bemerkten ironisch die „Wilden“ von den Zivilisierten, im speziellen Fall brasilianische Mulatten aus den nordöstlichen Notstandsgebieten. Die Indianer selbst begrüßen sich leise und zurückhaltend. Freilich hatten diese verachteten Gummisarnmler auch imponierende Dinge, wie etwa ein Tranisistorradio.Als jedoch einer mit seinem Apparat angeben wollte, bemerkten die Indianer überlegen: „Die Padres haben viel größere und lautere, und wenn wir wollen, bringt unser Padre jedem von uns eines mit.“
Weiß, mit Bart und Brillen mußte ihrer Ansicht nach der junge Fremdling zu dem merkwürdigen Stamm des Pater Joao gehören, der immer freundlich war, Geschenke brachte, nichts arbeitete und keine Frauen mochte. Tags darauf forderten ihn deswegen die Kayabi mit Gesten auf, eine Messe zu lesen. Nun begann die Schwierigkeit. Der Student entgegnete, dazu sei er noch zu jung, das akzeptierten die Indianer. Wie aber sollte er ihnen klarmachen, was er tatsächlich bei ihnen wollte? Mündlich war dies ohnehin nicht möglich, denn nur wenige der jungen Männer sprachen einige Worte Portugiesisch, das sie von den Gummisammlern gelernt hatten.
Indianer sind eine festgefügte Gemeinschaft, das wußte der Student der Völkerkunde wohl. Wer bei ihnen bleiben wollte, mußte einen Platz In diesem sozialen Gefüge finden. Der junge Forscher band seine Hängematte an einen Stützpfahl des Dachfirstes einer großen Hütte zu denjenigen der „Jungmännergruppe“. Das wurde wohlwollend entgegengenommen. Ebenso sein Bemühen, sie nachzuahmen, was allerdings mit großen Schwierigkeiten verbunden war: Er konnte nicht mit Pfeil und Bogen umgehen. Die vielen belauerten Wildtiere verschwanden scheu und blitzartig im großen Wald. Erst nach 14 Tagen traf er einen uralten Affen, was die Heiterkeit der Kayabi erregte: Das würde ein zäher Braten werden! Fische zu fangen, gelang keineswegs leichter. Es stellte sich heraus, daß der Einbaum dem Wiener Buder-schlag nicht gehorchen wollte und in wilden Kurven an den Fischen vorbeigeriet, falls er sie nicht rechtzeitig in die Flucht gejagt hatte. Bäume fällen und Hütten bauen ging natürlich auch nicht besser. Die Kayabi lachten über die Ungeschicklichkeit des Städters, der größer und stärker war als der stattlichste Mann unter ihnen (Durchschnittisgröße der Männer 157 Zentimeter, der Frauen 148 Zentimeter) und ungeschickter als ein siebenjähriger Indianerjunge. „Wahrscheinlich haben sie mich für schwachsinnig gehalten“, vermutet Dr. Grünberg. „Jedenfalls1 hatte meine Ungeschicklichkeit den Vorteil, daß sie mich für durchaus harmlos hielten. Man ließ mich machen, was ich wollte: beobachten, schreiben, zeichnen, photographieren oder auch mitarbeiten. Junge Männer dienten mir als Dolmetscher und übersetzten das Vokabular der Indianersprache ins Portugiesische. Durch ihre Geduld gaben sie mir die Möglichkeit, mich anzupassen.“ Für die Kayabi sind die Krankheitsursachen Wesen, sogenannte mama'e. In bestimmten Gestalten, etwa eines Affenzahnes, eines Doms, eines Steines oder Knochenatückes, setzen sie sich dm Körper eines Menschen fest. Die mama'e haben einen Häuptling, den Anyang. Diesem Meister aller Krankheiten kann man im Wald in Menschengestalt begegnen, wenn man allein auf der Jagd ist. Tumakai, der 45jährige Medizinmann, hatte oft Schwerarbeit, wenn der Bösewicht wieder am Werk war. Tabakrauchend tanzte er um die Hängematte des Kranken, blies ihn fortwährend an und stieß laute Schreie aus. Dann massierte er mit seinen schmalen Händen den Körper des Patienten und knetete die Krankheitsursache als einen kleinen, materiell gedachten, aber unsichtbaren Gegenstand aus ihm heraus. Der „mama'e“ wurde in ein eigenes Sieb geworfen und unter eigenartig zuckenden Bewegungen vor dem Hause unschädlich gemacht. Die Prozedur dauerte von einer halben bis zu einer Stunde und brachte den Schamanen bis zur Erschöpfung. Der junge Wiener erlebte den Urwald nicht als „Grüne Hölle“. Er erlebte die schier grenzenlosen Wälder eher als ein Paradies. Freilich hatte dieses Paradies auch seine Schönheitsfehler in Form mannigfaltigster Insekten. Ununterbrochen wehrte man sich gegen Mücken, Zecken, Bremsen und Wespen. Auf Schritt und Tritt geriet man unter die Ameisen, die bis zu fünf Zentimeter lang waren und äußerst schmerzhaft bissen. Die Indianer setzten sich daher bei einer Rast nie hin, sie hockten bloß, um nicht zuviel „Beißfläche“ zu bieten. Der Versuch des jungen Forschers, die Entstehung eines Mythos zu beobachten, schlug fehl. Dag kam so: Dr. Grünberg entdeckte eines Nachts am klaren Himmel einen Satelliten, der als großer leuchtender Stern seine Bahn zog. Was würden die Kayabi über die Entstehung des Wundensternes sagen? Er stellte sich unwissend und fragte den Indianer Moanyan: „Siehst du diesen Stern, einen solchen habe ich nie gesehen!“ „Das weißt du nicht?“, entgegnete Moanyan. „Das ist doch kein Stern, das ist ein Apparat, den habt ihr hinaufgeschossen!“ Und vorwurfsvoll: „Du weißt nicht einmal, was ihr hinausgeschossen habt!“ Dr. Grünberg verarbeitete nach seiner Rückkehr das gewonnene Material in seiner Dissertation. Er will die Forschung in mehreren Jahren fortsetzen und dabei die Sprache des Stammes erlernen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!