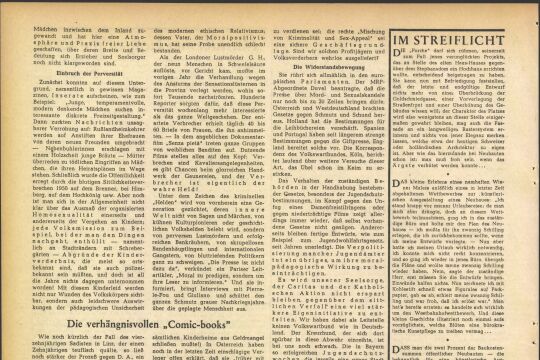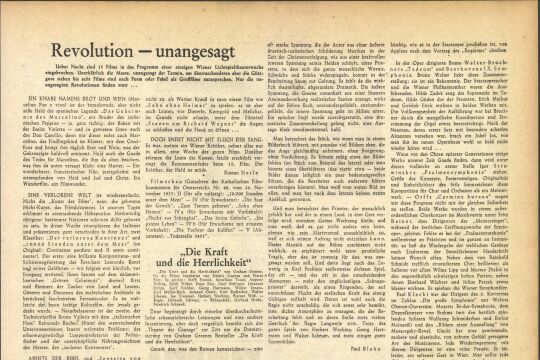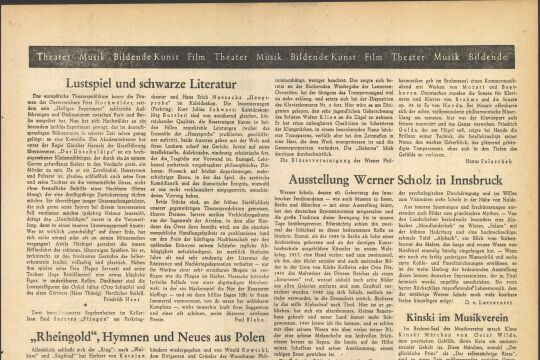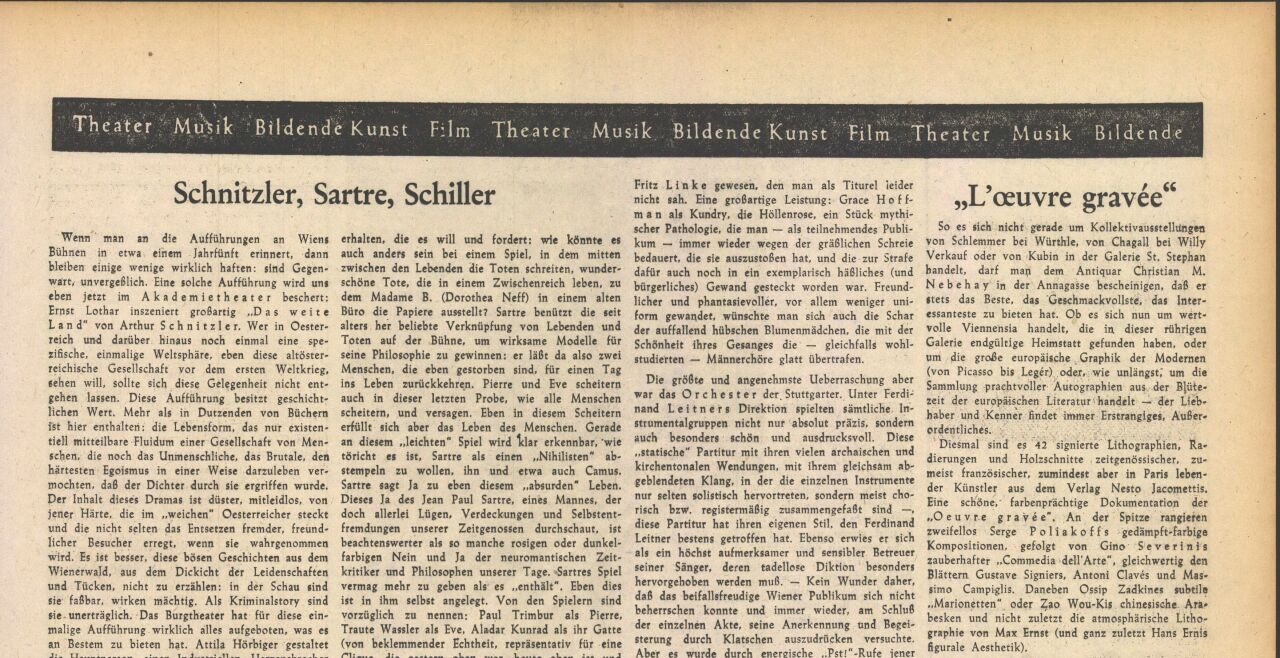
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Parsifal“ und Hindemith-Requiem
. Unter der Leitung ihres Generalintendanten Doktor Schäfer ist die Stuttgarter Oper mit einem Ensemble von 224 Mann in Wien eingetroffen und hat am ersten Abend ihres einwöchigen Gastspiels im großen Haus am Ring „Parsifal" von Richard Wägner auf geführt. -Solche Gesamtgastspiele unternimmt das Württembergische Staatstheater bereits seit 1950 — und man tut es gern und häufig. (Während der vergangenen Spielzeit zum Beispiel gastierten die Stuttgarter in Paris, Venedig, Edinburgh und Brüssel.) Man hat also eine ausgedehnte Praxis im Umgang mit fremden Bühnen und Häusern, und so ist es auch zu erklären, daß bei der Aufführung am vergangenen Sonntag alles so tadellos „klappte". Für Wien haben die Gäste ein besonderes Geschenk mitgebracht: die von Georg Reinhardt (als Regisseur) und Heinrich Wendel (als Bühnenbildner) erarbeitete Neuinszenierung des „Parsifal" wurde in Wien zum ersten Male: gezeigt und wird in Stuttgart erst im nächsten Jahr, zu Ostern, vorgeführt werden. Die Gäste haben es an Höflichkeit und Respekt nicht fehlen lassen. Und so wollen auch wir es halten.
Die Inszenierung des schwierigen Werkes war wohldurchdacht und von asketischer, zuweilen fast soldatischer' Strenge. Die herrschende Farbe ist grau: grau sind die Bäume, die Säulen des Gralstempels und die Mäntel der Gralsritter (obwohl Wagner weiße Waffenröcke und Mäntel, ähnlich denen des Templerordens, vorschreibt); und grau war — leider — auch die „freie, anmutige Frühlingsgegend" mit der „sanft ansteigenden Blumenaue“. Der einzige Farbfleck im 1. Akt war des Amfortas roter Mantel, und auch im 2. Akt — mit dem grünflammenden Hintergrund (Klingsors Zauberschloß) und dem Zaubergarten, der wie das Innere einer Riesenmuschel wirkte — sind die Farben gedämpft. — Gut und einfach war die Drehbühnenlösung, die man für die zweimalige Verwandlung des Waldes in den Gralstempel mit mächtig aufragenden Säulen fand. (Bei der großartigen Begleitmusik zu dieser Szene, die das
Theater erdröhnen machen soll, störte, sehr der unschöne und wenig sonore Klang der tiefen Glocken.)
Dagegen ließ die Besetzung der sechs Hauptpartien kaum einen Wunsch offen. Wolfgang Windgassen als Titelheld ist wohl der beste lebende Sänger dieser Partie, wenn auch vielleicht nicht ihr idealer Darsteller. Otto von Rohr gibt den Gurnemanz, schlicht, adelig und mit jenem Zug von Herzenshöflichkeit, der diese Gestalt auszeichnet;
stimmlich stand er seinem Schutzbefohlenen kaum nach. H. G. N ö c k e r als Klingsor und Gustav Neidlinger als Amfortas waren vor allem in der Erscheinung imposant; vielleicht wäre dies auch
Fritz Linke gewesen, den man als Titurel leider nicht sah. Eine großartige Leistung: Grace Hoffman als Kundry, die Höllenrose, ein Stück mythischer Pathologie, die man — als teilnehmendes Publikum — immer wieder wegen der gräßlichen Schreie bedauert, die sie auszustoßen hat, und die zur Strafe dafür auch noch in ein exemplarisch häßliches (und bürgerliches) Gewand gesteckt worden war. Freundlicher und phantasievoller, vor allem weniger uniform gewandet, wünschte man sich auch die Schar der auffallend hübschen Blumenmädchen, die mit der Schönheit ihres Gesanges die — gleichfalls wohlstudierten — Männerchöre glatt übertrafen.
Die größte und angenehmste Ueberraschung aber war das Orchester der. Stuttgarter. LInter Ferdinand Leitners Direktion spielten sämtliche Instrumentalgruppen nicht nur absolut präzis, sondern auch besonders schön und ausdrucksvoll. Diese „statische“ Partitur mit ihren vielen archaischen und kirchentonalen Wendungen, mit ihrem gleichsam abgeblendeten Klang, in der die einzelnen Instrumente nur selten solistisch hervortreten, sondern meist cho- risch bzw. registermäßig zusammengefaßt sind —, diese Partitur hat ihren eigenen Stil, den Ferdinand Leitner bestens getroffen hat. Ebenso erwies er sich als ein höchst aufmerksamer und sensibler Betreuer seiner Sänger, deren tadellose Diktion besonders hervorgehoben werden muß. — Kein Wunder daher, daß das beifallsfreudige Wiener Publikum sich nicht beherrschen konnte und immer wieder, am Schluß der einzelnen Akte, seine Anerkennung und Begeisterung durch Klatschen auszudrücken versuchte. Aber es wurde durch energische „Pst!“-Rufe jener daran gehindert, die im „Parsifal" keine Oper, sondern ein echtes Weihespiel sehen, das vor Profanierung geschützt werden muß.
Operntheater oder sakrale Handlung? Diese Frage begleitet das doppelbödige Werk seit seinem ersten Hervortreten. Die „Parsifal“-Symbolik. ist nämlich, ähnlich wie die der „Zauberflöte", schwer durchschaubar und vieldeutig. Wagners Affinitäten zum Christlichen und sein Bekenntnis zum „leidenden Gott“ stehen außer Frage. Aber das Liebesmahl und die Trauerfeier weisen — wie Max Graf in einer Studie erläutert hat — nicht nur christlich-kultische, sondern auch freimaurerische Züge auf. Auf jeden Fall erscheinen verschiedene christliche Symbole bis zur Verwirrung „verfremdet“ und umfunktioniert. So zum Beispiel, wenn Kundry, eine neue büßende Magdalena, dem „Erlöser“ Parsifal“ die Füße und Gurnemanz ihm das Haupt salbt. Aber das ist ein weites Feld und bedürfte einer gründlichen Durchforschung, die von den Wagner-Interpreten (zuletzt von Paul Arthur Loos in dem Kapitel „Kunst und Religion .irr seinem großen fnimėr wiener versucht, bisher jedoch noch in.it kei- nem eindeutigen Ergebnis abgeschlossen Vürue.
Im Großen Musikvereinssaal leitete Paul Hindemith eine Aufführung seines Requiems „für die, die wir lieben", mit dem Titel: „Als Flieder jüngst mir im Garten blühte", das vor etwa zehn Jahren im Konzerthaus erstaufgeführt wurde und damals an dieser Stelle ausführlich gewürdigt wurde. Der Eindruck, den man von diesem bedeutenden Werk für zwei Soli, Chor, Orchester und Orgel nach Worten von Walt Whitman empfing, war um nichts schwächer als bei der ersten Begegnung. Vom ersten großen Orchestervorspiel mit dem Orgelpunkt Cis, das die Erhabenheit des Todes schildert, über die Vision des weiten, jungen Landes, durch das sich der Trauerzug mit dem Sarg des Präsidenten Lincoln bewegt und das Chorlied an den „lieben und sanften Tod" bis zum leise verklingenden letzten Akkord — „dort in dem Röhricht fern, in den Büschen fahl und stumm“ — ist man im Bann eines ergreifenden, inspirierten, mit großer • Meisterschaft, geschaffenen Werkes, das in der Interpretation durch den Singverein, die Wiener Symphoniker und die Solisten Hilde Rössel-Majdan und Otto Wiener stärksten Eindruck hinterließ. — Ohne Pause folgte Bruckners 15 0. Psalm, der fast wie ein letzter Satz des Hindemith-Requiems wirkte: der große Lobgesang nach, der Totenklage.
Mit einem würdigen Programm erfreute auch der Oesterreichische Rundfunk am Vormittag des Totensonntags. Unter der Leitung von Kurt Richter brachten Chor und Orchester des Rundfunks zunächst einen etwas konventionellen Chorsatz Von Gluck („De nrofundis“), dann folgten, von Hilde Rössel-Majdan ausdrucksvoll vorgetragen, Mahlers „Kindertoten1ieder“, und zum Abschluß Hans Pfitzners große Chorphantasie „Das dunkle Reich“, deren Partitur 1929 erschienen ist, nachdem Pfitzner drei Jahre lang, nach dem Tod seiner ersten rrau, nichts veröffentlicht hatte. Der Eingangschor auf einen Text von C. F. Meyqr „Wir Toten, wir Toten sind größere Heere" ist kennzeichnend für Haltung und Stimmung dieses düsteren, kühn in musikalisches Neuland vorstoßenden Werkes, für welches Texte von Dehmel, Michelangelo und (mehrfach) C. F. Meyer nach ihrem pessimistischen Gehalt ausgewählt wurden, um der Phantasie des Musikers als Grundlage für immer heftigere, bitterere, düsterere Klagen zu dienen. — Ein eindrucksvolles Kor.zert in gediegener Ausführung.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!