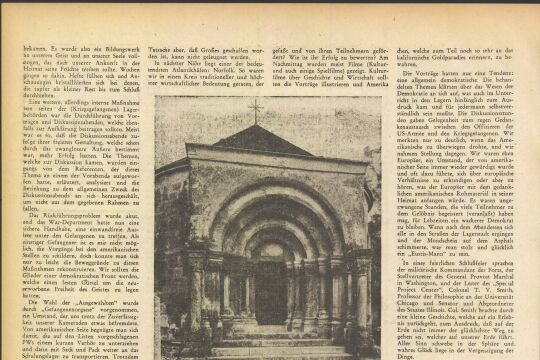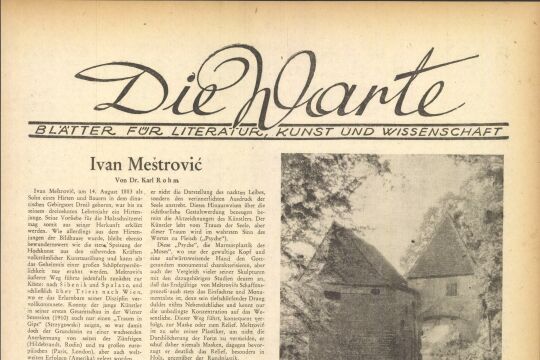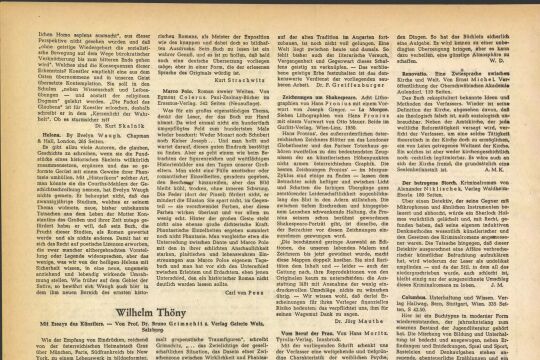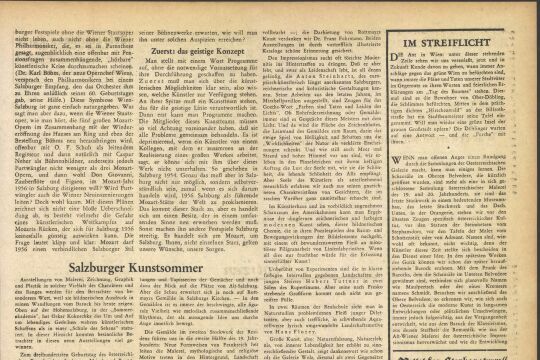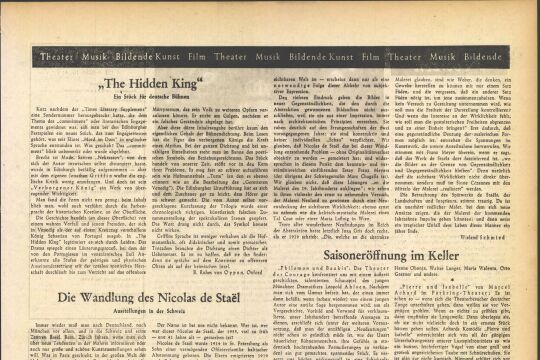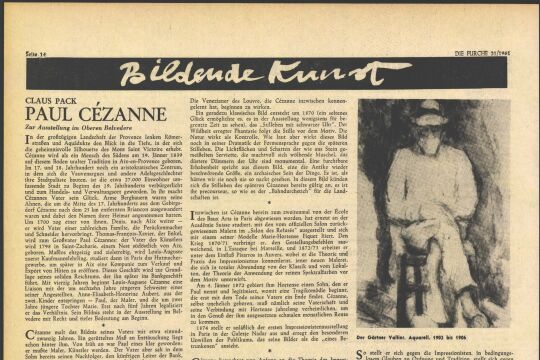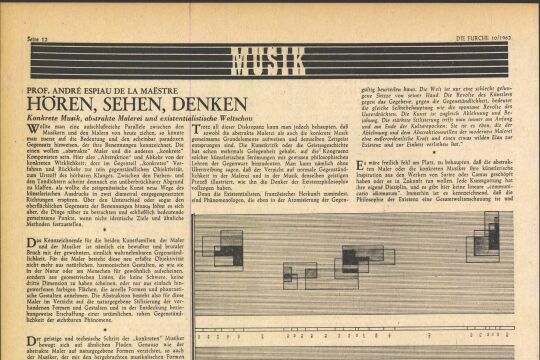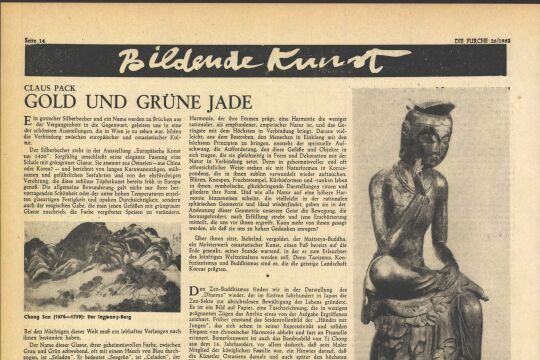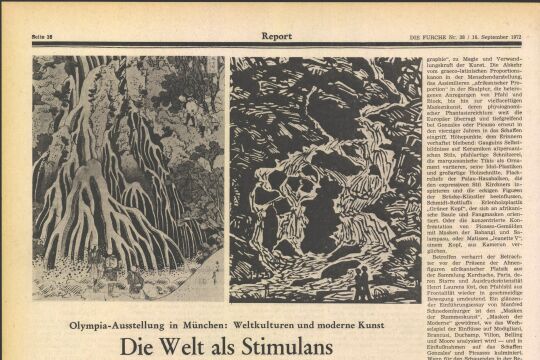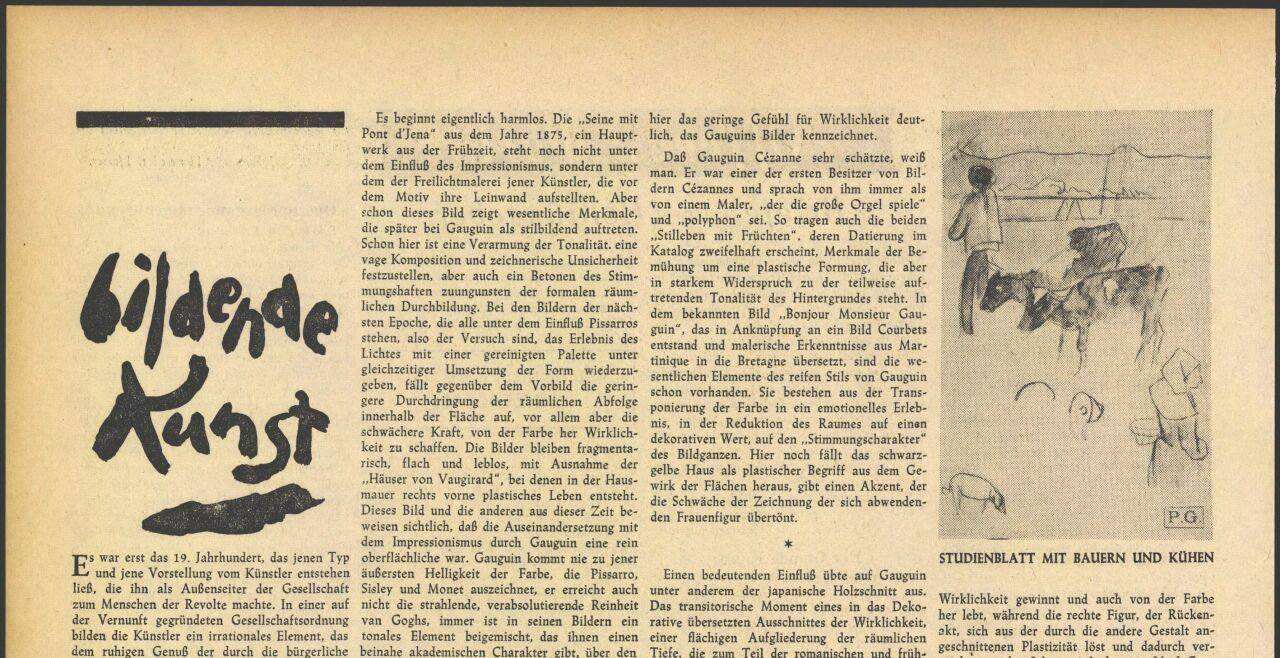
Es war erst das 19. Jahrhundert, das jenen Typ und jene Vorstellung vom Künstler entstehen ließ, die ihn als Außenseiter der Gesellschaft zum Menschen der Revolte machte. In einer auf der Vernunft gegründeten Gesellschaftsordnung bilden die Künstler ein irrationales Element, das dem ruhigen Genuß der durch die bürgerliche Revolution für eine breitere Masse gesicherten Güter in dem intransigenten Gefühl ihrer Mission entgegensteht, teils weil sie sich mit den vom Bürgertum geforderten Idealen nicht identifizieren können, da diese materialistischen Inhalts sind, teils weil sie aus ihrer Berufung heraus eine Sonderstellung einzunehmen glauben, die der demokratischen Gleichmacherei widerspricht. Da das Bürgertum in seiner neugewonnenen Macht den „Unterhalter“ im Künstler suchte — das 19. Jahrhundert bringt die verhältnismäßig überschätzte Erscheinung des „Interpreten“, des Virtuosen hervor, der noch heute immer wieder über das originale Werk gestellt wird —, mußte schon damals der Künstler seine schöpferische Freiheit, die Suche nach seiner eigenen, persönlichen Vision verteidigen. Man reagierte darauf mit Hohngelächter, Verachtung, Ausstoßung und Neid. Die Künstler selbst, die ihre gesellschaftliche Basis verloren hatten, wurden zu Revolutionären widtrHWilkaj Nicht im künstlerischen Bereich, denn hier folgten sie dem Diktat ihres Gewissens, aber in ihrer Hai1-tung zu einer Welt, die sie mit Verständnis-losigkeit betrachtete, während sie sich gerne in sie eingegliedert hätten. Denn ihre sozialen Ideale waren kleinbürgerlicher oder bürgerlicher Natur und ihr Traum bestand darin, in Ruhe und Sicherheit arbeiten zu können. Das gilt sogar für van Gogh, dessen unerbittliches Schicksal ihn in Gegensatz zur Gesellschaft brachte, in ein elendes Leben, das aber gesegnet durch den Reichtum seiner Kunst war. Das gilt weniger für Toulouse-Lautrec, der gegen seinen Körper und gegen seine Familie revoltierte, und am wenigsten für Paul Gauguin, der aus der bürgerlichen Sicherheit ausbrach, um einem romantischen Ideal nachzujagen.
Sein Leben ist zur Genüge bekannt und durch den Film und einen schlechten Roman von Somerset Maugham sentimental und bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Der wohlhabende, verheiratete Bankangestellte, der mit Erfolg bis zum Krach von 1883 an der Börse spekulierte, hätte bei einer klugen Nutzung seines Kapitals sehr wohl jene Grundlage besitzen können, die bei Cezanne durch die reiche Erbschaft nach seinem Vater geschaffen wurde. Er war kein „armer“ Künstler, das Geld kreuzte immer wieder seinen Weg, sei es in Gestalt einer kleinen Erbschaft nach seinem ersten, zweifellos harten Aufenthalt auf Tahiti oder aus anderen Quellen, nur gab er es mit vollen Händen und mit einem beinahe selbstzerstörerischen Trieb aus. Hier liegt zweifellos eine Wurzel zur Erkenntnis des wahren Wesens von Paul Gauguin, seiner „Revolte“. Seine Flucht aus der europäischen Zivilisation in ein „verlorenes Paradies“ war eine Form der Flucht vor sich selbst, das romantische Aufbegehren eines weniger leidenschaftlichen als sentimentalen Mannes auf der Suche nach der eigenen Persönlichkeit. Die Pathetik dieses Lebens wird durch die Legende verklärt, die sich verzerrend vor sein Werk stellt. Es ist nun das große Verdienst der Ausstellung im Belvedere, daß endlich auch Wien die Möglichkeit gegeben wird, sich mit seinem Werk auseinanderzusetzen, das deswegen so wichtig ist, weil es am Anfang einer Entwicklung stand, die zu gewissen Erscheinungen der zeitgenössischen Kunst führte.
Es beginnt eigentlich harmlos. Die „Seine mit Pont d'Jena“ aus dem Jahre 1875, ein Hauptwerk aus der Frühzeit, steht noch nicht unter dem Einfluß des Impressionismus, sondern unter dem der Freilichtmalerei jener Künstler, die vor dem Motiv ihre Leinwand aufstellten. Aber schon dieses Bild zeigt wesentliche Merkmale, die später bei Gauguin als stilbildend auftreten. Schon hier ist eine Verarmung der Tonalität. eine vage Komposition und zeichnerische Unsicherheit festzustellen, aber auch ein Betonen des Stimmungshaften zuungunsten der formalen räumlichen Durchbildung. Bei den Bildern der nächsten Epoche, die alle unter dem Einfluß Pissarros stehen, also der Versuch sind, das Erlebnis des Lichtes mit einer gereinigten Palette unter gleichzeitiger Umsetzung der Form wiederzugeben, fällt gegenüber dem Vorbild die geringere Durchdringung der räumlichen Abfolge innerhalb der Fläche auf, vor allem aber die schwächere Kraft, von der Farbe her Wirklichkeit zu schaffen. Die Bilder bleiben fragmentarisch, flach und leblos, mit Ausnahme der „Häuser von Vaugirard“, bei denen in der Hausmauer rechts vorne plastisches Leben entsteht. Dieses Bild und die anderen aus dieser Zeit beweisen sichtlich, daß die Auseinandersetzung mit dem Impressionismus durch Gauguin eine rein oberflächliche war. Gauguin kommt nie zu jener äußersten Helligkeit der Farbe, die Pissarro, Sisley und Monet auszeichnet, er erreicht auch nicht die strahlende, verabsolutierende Reinheit van Goghs, immer ist in seinen Bildern ein tonales Element beigemischt, das ihnen einen beinahe akademischen Charakter gibt, über den nur die Wahl des Sujets, die inhärente Romantik und die immer flächiger werdende Bildaufteilung hiHWegftäuschft'So schoivirF der „Landschaft ivoa Martinique“ aus dem Jahre- 1887;-die linear reich '“gegliedert erscheint, deren Plastizität sich aber in einer rein gobelinartigen Wirkung erschöpft. Das Bildnis von Gauguins Sohn Clovis, ein Jahr vorher entstanden, hat noch nicht diese nur dekorative Lösung erfahren. Hier strebt die Zeichnung des Kopfes noch eine plastische Durchdringung an, die nicht ganz gelingt, weil sie zuwenig differenziert verfährt, obwohl sie auf rein französische Tradition zurückgeht, wie auf den Mai'tre de Moulins, während sich in der Darstellung des Körpers, der Hände und des Hintergrundes impressionistische und dekorative Elemente mischen. Die „Landschaft bei Arles“, während der tragischen Begegnung mit van Gogh gemalt, ist seltsam blaß, unräumlich. Vergleicht man sie mit der leidenschaftlichen zeichnerischen Raumgestaltung des Holländers, wird auch hier das geringe Gefühl für Wirklichkeit deutlich, das Gauguins Bilder kennzeichnet.
Daß Gauguin Cezanne sehr schätzte, weiß man. Er war einer der ersten Besitzer von Bildern Cezannes und sprach von ihm immer als von einem Maler, „der die große Orgel spiele“ und „polyphon“ sei. So tragen auch die beiden „Stilleben mit Früchten“, deren Datierung im Katalog zweifelhaft erscheint, Merkmale der Bemühung um eine plastische Formung, die aber in starkem Widerspruch zu der teilweise auftretenden Tonalität des Hintergrundes steht. In dem bekannten Bild „Bonjour Monsieur Gauguin“, das in Anknüpfung an ein Bild Courbets entstand und malerische Erkenntnisse aus Martinique in die Bretagne übersetzt, sind die wesentlichen Elemente des reifen Stils von Gauguin schon vorhanden. Sie bestehen aus der Transponierung der Farbe in ein emotionelles Erlebnis, in der Reduktion des Raumes auf einen dekorativen Wert, auf den „Stimmungscharakter“ des Bildganzen. Hier noch fällt das schwarzgelbe Haus als plastischer Begriff aus dem Gewirk der Flächen heraus, gibt einen Akzent, der die Schwäche der Zeichnung der sich abwendenden Frauenfigur übertönt.
Einen bedeutenden Einfluß übte auf Gauguin unter anderem der japanische Holzschnitt aus. Das transitorische Moment eines in das Dekorative übersetzten Ausschnittes der Wirklichkeit, einer flächigen Aufgliederung der räumlichen Tiefe, die zum Teil der romanischen und frühgotischen Malerei des Abendlandes ähnlich ist,weil sie emotionell und nicht rational gliedert, kam seinem Romantizismus entgegen. Nicht wie Degas. verband er die scheinbare, Willkür f,cjes: Bildausschnittes mit einer Suggestion der Tiefe, sondern sah die rein dekorativen Werte, die ihm die naturabgewandte stilisierte Form dieser Graphik bot, als wesentliches Element seiner subjektiven Interpretation der Wirklichkeit. So schneidet er in der „Landschaft bei Le Poulou“ die Kuh im linken Vordergrund unorganisch entzwei und stellt die Gestalt des Mädchens in eine Raumtiefe, die aus illusionistischen und flächigen Elementen gemengt ist. Auch hier ist die Emotion stärker als die Formkraft.
Emotion und Form vereint, treten am stärksten noch in den beiden „Tahitierinnen am Strand“ in Erscheinung, von denen die linke Figur in der Zeichnung der Kontur plastische Wirklichkeit gewinnt und auch von der Farbe her lebt, während die rechte Figur, der Rückenakt, sich aus der durch die andere Gestalt angeschnittenen Plastizität löst und dadurch verzeichnet wirkt. Schon wird aber ein Ideal Gauguins sichtbar, das als das eigentliche Grundmotiv seiner Südseebesessenheit erscheint. Trotz seiner Beteuerungen, an den Busen der Natur zurückzukehren, seiner Jean-Jacques-Rousseau-Romantik, die ein Bild der Südsee beinhaltet, wie es nie existierte, lebte in ihm ein zutiefst klassizistisches Ideal. Es ist das Ideal eines Puvis de Chavanne, des verdünnten Griechentums, ein Ausbruch aus der Tradition der wahren Klassik, die noch romantiziert in Delacroix, vulgarisiert in Courbet, sentimentalisiert in Corot, patheti-siert in Daumier lebendig war. Tahiti und die Marquesas waren nicht erst zur Zeit Gauguins alles andere als irdische Paradiese. Zumindest hatte der weiße Mann sie schon mit jenen Seuchen und Lastern bekannt gemacht, die schließlich auch den körperlichen Tod Gauguins herbeiführten. Man braucht nur die Untersuchung einer Anthropologin wie Ruth Benedikt lesen, um nicht mehr an die^paradiesische, Unschuld dieser Inselreiche zu glauben. Für Gauguin waren sie ein Traum, der in Europa gründete und der ihn schließlich sein Leben kostete. Was er dort schuf, die letzten Bilder und Graphiken zeigen es mit aller Deutlichkeit, war die Wiedereinführung der Literatur in die Malerei, das Symbolische des Inhalts und die subjektive Stellungnahme des Malers gegenüber der Wirklichkeit, alles Dinge, die ein Maurice Denis, ein Puvis de Chavanne an abendländischen Sujets in einem verdünnten Klassizismus exerzierten. Es ist nicht ohne Tragik, daß auf Gauguins Stillleben von 1901 im Hintergrund die „Hoffnung“ von Puvis de Chavanne erscheint. Im Grunde beseelt ihn das gleiche Element eines Stiles, das hier gegen die Wiederauferstehung des klassischen Ideals — Plastizität und Raum bei Cezanne — die sentimentale Dekoration setzte. Wieviel bei Gauguin an aufbrechendem Jugendstil vorhanden ist sieht man in seinen Graphiken, wie wenig an plastischem Erlebnis an seinen Zeichnungen, die durchweg schwach sind und den versteckten Akademiker verraten.
Heute wie damals gelten die harten, aber nicht ungerechten Worte Cezannes, der über die Pont-Avisten sagte, und damit Gauguin meinte: „Sie wissen schon, die umreißen ihre biederen Figuren, ihre Gegenstände, mit einem rohen schematischen Strich, und dann wird mit flachen Tönen bis zum Rand gefüllt. Das schreit wie ein Plakat, ist gemalt wie mit der Schablone oder mit dem Locheisen. Nichts lebt.“ Oder über Gauguin selbst: „Er hat mich nicht verstanden. Ich habe den Mangel an Modellierung oder Abstufung nie gewollt und werde ihn nie akzeptieren. Solche Dinge sind Nonsens. Gauguin war kein Maler, er hat nur Chinoiserien gemacht.“ Was Gauguin schuf, im Gegensatz zur Auffassung Cezannes, die „Gewissenhaftigkeit, Aufrichtigkeit, Unterordnung“ verlangte, „Gewissenhaftigkeit vor den Ideen, Aufrichtigkeit vor sich selbst, Unterordnung unter den Gegenstand — unbedingte Unterordnung unter den Gegenstand“, war der Anspruch des Individuums gegenüber der Wirklichkeit, das Primat des Künstlers, das Übergewicht der subjektiven Stellungnahme gegenüber dem plastischen Gesetz, das objektiver Natur ist. Ihm zum Durchbruch verholfen und damit eine Entwicklung ausgelöst zu haben, die über Münch zu den deutschen Expressionisten bis zur automatistischen Malerei führt, ist die Bedeutung Gauguins.