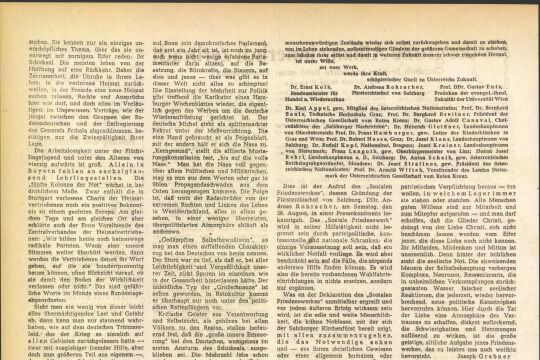Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Persöhnung von Lust und Arbeit
Im zweiten Teil seines Essays über Arbeit und Müßiggang versucht Gerhard Köpf eine Synthese.
Im zweiten Teil seines Essays über Arbeit und Müßiggang versucht Gerhard Köpf eine Synthese.
Müßiggang, so wußten es noch unsere sprichwortgeschulten Großeltern, ist aller Laster Anfang. Aber ist das Sprichwort auch ein Wahrwort? Gert Mat- tenklott hat da so seine Zweifel: „Der Müßiggang ist Teil eines Lebensprogramms, und er ist — wenn auch abgesetzt und ausgegrenzt als eine Zeit ohne Arbeit - keine Undefinierte Zeit. Im Gegenteil, sie ist sogar von den höchsten Ansprüchen umstellt: eine Zeit der Besinnung auf den metaphysischen Lebenssinn für die ei-' nen, Zeit der unentstellten geistigkörperlichen Persönlichkeitsentfaltung für die anderen: für die dritten Erfrischungszeit der Arbeitskraft. Dergestalt ist Müßiggang einer Disziplin unterstellt, die nicht minder rigoros ist als das moralische Gesetzwerk, das das Arbeitsverhalten regelt. Unter der Voraussetzung, daß der Untätige eine Pflicht zur Begründung seines befremdenden Verhaltens akzeptiert, erhält er in der Regel sogar erstaunlich großzügig und ohne viel Formalitäten die gesellschaftliche' Anerkennung.“
Müßiggänger ist also nicht gleich Faulpelz. Ein. geschichtlicher Überblick über die Phänomenologie des Faulen fördert interessante Feststellungen zutage. So hat Gert Mattenklott in seinem Charakterbild des Faulen darauf aufmerksam gemacht, daß die Literatur der Antike wenig genaues über den Typus des Faulpelzes zu sagen weiß: „Vom Faulenzen in der Bedeutung einer Untätigkeit ohne Grund, einer Provokation ohne die Lizenz eines bestimmten Lebenssinns scheinen die antiken Schriftsteller nichts zu wissen, es sei denn im Sinne einer Verweigerung der schuldigen Arbeitsleistung von Leibeigenen.“ Diogenes in seiner Tonne, der Alexander den Großen bittet, ihm einfach mal aus der Sonne zu gehen, scheint hier eine große Ausnahme zu sein. Aber Diogenes ist nicht in Wirklichkeit faul. Er ist wiederum Philosoph, mithin ein Müßiggänger, wie er in würdiger kontemplativer Versenkung auch der Mystik des Mittelalters und deren pietisti schen Erben im 18. Jahrhundert bekannt ist.
Offensichtlich hat die Faulheit, wie Mattenklott anmerkt, Asyl nur im Märchen gefunden. Dort bevölkern die Faulen sogar eine eigene Provinz, das Schlaraffenland, wo bekanntlich Faulheit nicht nur geduldet, sondern sogar belohnt wird. Mattenklott sagt: „Im kulturellen Gespräch über Faulheit bleibt das Märchen deren zuverlässigster und über lange Zeit einziger Anwalt. Das größte Massenelend entstand in der Periode rabiater Kapitalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse..., so daß schon die Drohung des Verlustes der Arbeitsmöglichkeit begründete Panik erzeugen mußte, eine ausgezeichnete Überlebensbedingung für die alte puritanische Arbeitsmoral, wie denn auch Faulheit - statt auf dem Katalog der Forderungen des selbstbewußt werdenden Proletariats - im Sündenregister zu finden ist, das die jeweils aufsteigende Klasse beziehungsweise ihre Propagandisten der Führungsschicht des Ancien Regimes vorhalten.“
DAS RECHT AUF FAULHEIT
Es ist eine hübsche Ironie der Geschichte, daß die theoretisch versierteste Begründung eines anthropologischen und gesellschaftlichen Anspruchs auf Faulheit ausgerechnet von Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Karl Marx stammt, der, 1842 auf Kuba geboren und aktiver Teilnehmer an den Aufständen der Pariser Kommune, im Jahre 1883 auf rund 70 Seiten eine Schrift verfaßte, die nicht weniger revolutionär genannt werden darf als das „Kommunistische Manifest“. Lafargue nannte sein Pamphlet „El droit ä la paresse: Das Recht auf Faulheit“: „Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht, eine Sucht, die das in der modernen Gesellschaft herrschende Einzel- und Massenelend zur Folge hat. Es ist dies die Liebe zur Arbeit, die rasende, bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Statt gegen diese geistige Verwirrung anzukämpfen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heiliggesprochen ... Ich, der ich weder Christ noch Ökonom noch Moralist zu sein behaupte, ich rufe gegen ihr Wort das ihres Gottes an und gegen die Vorschriften ihrer religiösen, ökonomischen oder freidenkerischen Moral erinnere ich an die schauerlichen Konsequenzen der Arbeit in der kapitalistischen Gesellschaft.“
Lafargue versteht sogar die Berg- redigt als eine Lobrede auf die ?aulheit, eingedenk der Worte: „Seiet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen; sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht, und doch sage ich euch, daß Salomo in all seiner Pracht nicht herrlicher gekleidet war.“ Ja, Gottvater selbst wird als Zeuge reklamiert, denn heiße es nicht von ihm, er habe sich nach sechs Tagen Arbeit zuerst einmal ausgeruht. Lafargue macht für alles individuelle und soziale Elend der Menschheit die Leidenschaft für die Arbeit verantwortlich. In üppigen Farben malt er ein Gegenbild von einer daumendre-henden Menschheit, die pfundweise saftige Steaks verschlingt, Burgunder schlürft und sich dem süßen Nichtstun hingibt. Die wenigen Unverbesserlichen sollten eben die Latrinen reinigen oder den Beerdigungsinstituten als Totengräber dienen. Lafar- gues Fazit, mit dem er seine Streitschrift beschließt, ist unmißverständlich und eindeutig: „0 Faulheit, Mutter der Künste und der edlen Tugenden, sei du der Balsam für die Schmerzen der Menschheit.“
Das literarisch bedeutendste Porträt eines Faulpelzes gelang dem Russen Iwan Gontscharow 1859 mit seinem Roman Oblomov, in dem fast nichts passiert. Seine Handlungsimpulse sind wie die seines Helden nur noch Trägheit und Teilnahmslosigkeit. Der Roman, der die müde gewordene russische Intellektuellenschicht thematisiert, war dennoch oder gerade deshalb derart erfolgreich, daß sich sogar Lenin veranlaßt sah, vor der Oblomoverei zu warnen.
Oblomov, der gutmütige faule Parasit, der von den Abgaben der 300 Seelen seines Gutes lebt, wird von der Petersburger Gesellschaft ausgerechnet an jenem 1. Mai bestürmt, der später der Tag der Arbeit werden sollte. Aber es gelingt Oblomov schließlich nicht einmal mehr, von seinem Sofa aufzustehen. Zwar macht er Pläne, wie er sich dem neuen materialistisch eingestellten Rußland anpassen könnte, doch ist er letztlich schon zu faul, um einen ersten Brief an seinen Gutsverwalter zu schreiben. Er macht sich auch nicht auf, um einer geliebten Frau zu folgen, denn er weiß ja, daß er von Olga geliebt wird. Als es Olga jedoch nicht gelingt, Oblomov seiner Faulheit zu entreißen, heiratet sie aus Trotz den tüchtigen Kaufmann Stolz. Für Oblomov zerfällt das Leben zuletzt nur noch in zwei Teile: „Der eine bestand aus Arbeit und Langeweile, das waren für ihn Synonyme; der andere bestand aus Ruhe und behaglicher Fröhlichkeit.“
DIE FARBE DES MÜSSIGGANGES
Stimmt die Spruchweisheit unserer Großeltern also doch? Arbeit macht das Leben süß, Faulheit stärkt die Glieder. Oblomov scheint dafür der beste Beweis. Das heißt nichts anderes, als daß der Faule den Fleißigen, der sich für seine Arbeit aufopfert, überleben wird. Das heißt aber auch, daß der Faule als lebendiger Gegenbeweis sinnloser Betriebsamkeit länger die Laus im Pelz der Tüchtigen bleiben wird. Seine Trägheit ist ein Akt der Insubordination, denn Saumseligkeit entlarvt Fleiß als graue Vernunft. Die Farbe des Faulpelzes ist blau: vom blauen Himmel, unter dem er sich einfach ins Gras oder an den Strand legt, hin zum blauen Montag, vom blauen Dunst zur blauen Stunde, am Ende gar zur blauen Blume der Romantik. Bei Friedrich Nietzsche aber lesen wir in „Menschliches, Allzumenschliches“: „Aus Mangel an Ruhe läuft unsere Zivilisation in eine neue Barbarei. Zu keiner Zeit haben die Tätigen, das heißt die Ruhelosen, mehr gegolten. Es gehört deshalb zu den notwendigen Korrekturen, welche man am Charakter der Menschheit vornehmen muß, das beschauliche Element in großem Maß zu verstärken.“
Heute, da die Welt des Erreichthabens auf der Kippe und ein Heer von Arbeitslosen ante portas steht, wird eine Umverteilung von Arbeit und Zeit nötiger denn je. Vielleicht gelingt es, der zerstückelten, uns weitertreibenden Zeit eine erfüllte Zeit entgegenzustellen, eine Zeit der Muße, in der wir uns wieder stärker auf uns selbst besinnen. Dann läge auch der Genuß nicht länger nur außerhalb der Arbeit. Dabei kommt es nicht darauf an, der faden Laschheit das Wort zu reden oder nur einen unverbindlichen Urlaubsflirt mit der Faulheit zu wagen. Vielmehr gilt das Augenmerk einer Kunst, die wir, wie ich fürchte, erst wieder lernen müssen. Müßiggang und Faulheit sind das Gegenteil von Fremdbestimmung und Verwertungszwang — somit aber Versöhnung von Lust und Arbeit, vielleicht am höchsten entwickelt im Liebesspiel.
Solches lehrt ansteckend und ist gar nicht egoistisch. Faulheit und Müßiggang heben Trennungen auf: von Arbeit und Freizeit, von Denken und Fühlen, von Kopf und Bauch. Wer sich für diese Zeit zu wenig Zeit nimmt, dem bleibt sie für immer verschlossen. Solche Überlegungen heben auch das moralische Verdikt auf, das beide Begriffe belastet. Den changierenden Übergang zwischen dem Müßiggang als Tugend und dem Laster der Faulheit markiert schon Nietzsche: „Wenn Müßiggang wirklich der Anfang aller Leister ist, so befindet er sich also wenigstens in der Nähe aller Tugenden; der müßige Mensch ist noch immer der bessere Mensch ab der tätige.“
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!