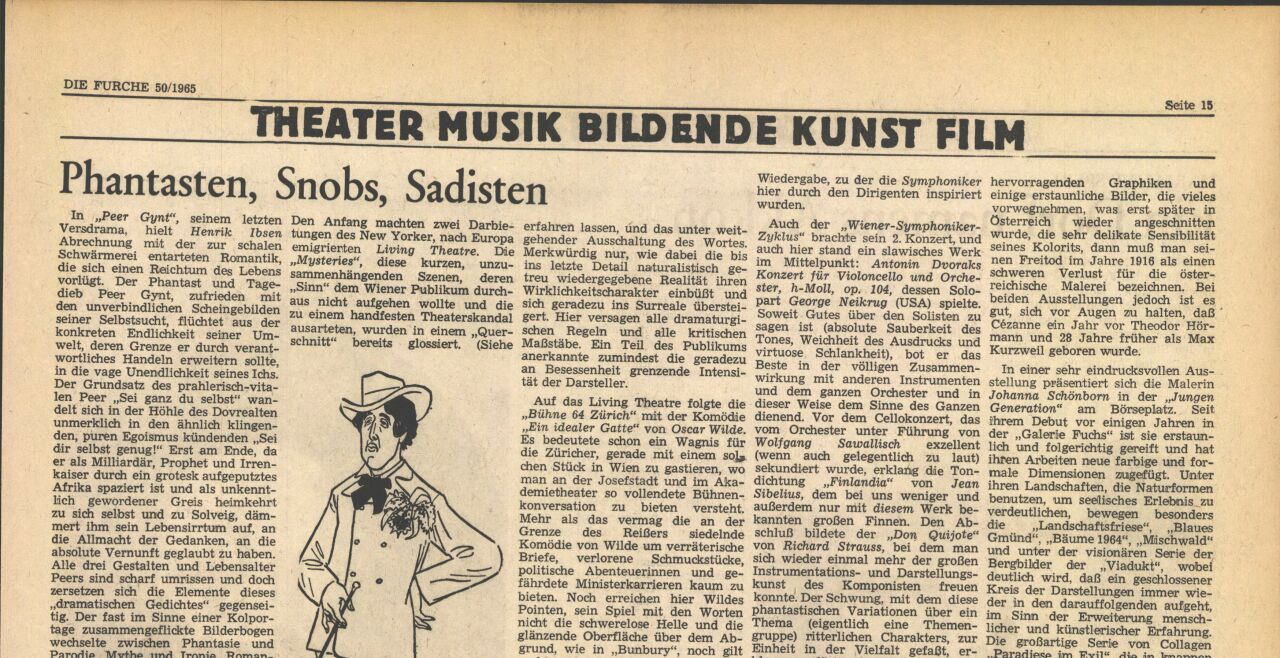
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Phantasten, Snobs, Sadisten
In „Peer Gynt“, seinem letzten Versdrama, hielt Henrik Ibsen Abrechnung mit der zur schalen Schwärmerei entarteten Romantik, die sich einen Reichtum des Lebens vorlügt. Der Phantast und Tagedieb Peer Gynt, zufrieden mit den unverbindlichen Scheingebilden seiner Selbstsucht, flüchtet aus der konkreten Endlichkeit seiner Umwelt, deren Grenze er durch verantwortliches Handeln erweitern sollte, in die vage Unendlichkeit seines Ichs. Der Grundsatz des prahlerisch-vitalen Peer „Sei ganz du selbst“ wandelt sich in der Höhle des Dovrealten unmerklich in den ähnlich klingenden, puren Egoismus kündenden „Sei dir selbst genug!“ Erst am Ende, da er als Milliardär, Prophet und Irrenkaiser durch ein grotesk aufgeputztes Afrika spaziert ist und als unkenntlich gewordener Greis heimkehrt zu sich selbst und zu Solveig, dämmert ihm sein Lebensirrtum auf, an die Allmacht der Gedanken, an die absolute Vernunft geglaubt zu haben. Alle drei Gestalten und Lebensalter Peers sind scharf umrissen und doch zersetzen sich die Elemente dieses „dramatischen Gedichtes“ gegenseitig. Der fast im Sinne einer Kolportage zusammengeflickte Bilderbogen wechselte zwischen Phantasie und Parodie, Mythe und Ironie, Romantik und Realismus.
Es fällt schwer, scheint fast unmöglich, das Ganze unter einen Bogen zu bringen, eine ideelle Einheit dieses vielschichtigen Werkes zu finden. Die Neuinszenierung im Burgtheater unter Adolf Rott wird bestimmt von der Weite und Farbigkeit der mit Projektionen kombinierten grandiosen Bühnenbilder von Günther Schneider-Siemssen. Im Mittelpunkt steht Josef Meinrad als flunkernder, faselnder Raufbold und Lügenprinz, der fast zum Conferencier seiner Szene wird. Er ist kein großer Peer Gynt, hält aber mit anhaltender sprachlicher Energie die Riesenrolle durch und fällt erst ab, wenn er auf die rhetorischen Flausen verzichten muß. Unter den zahllosen Nebenrollen (es sind wirklich nur Episoden neben dem Riesensolopart) gibt Alma Seidler als Mutter Aase eine rührende Charakterdarstellung. Die Rolle welche die berühmte Schlittenfahrt ins MoriarSoria-Schloß einschließt, trägt immer “noch. Hier hat Ibsen nicht nur auf Papier gedichtet, sondern eine Gestalt geschaffen, die leibhaftiger ist als die blonde, holde und reine Solveig, die kaum zu Worte kommt. Johanna Matz kann ihr nicht mehr geben. Käthe Gold ist „die Grüne“, die Peer in ihren Höllenpfuhl lockt, Theo hingen der Dr. Begriffenfeld, Paul Hörbiger gibt eher einen gemütlichen, als einen skurill-dämonischen Knopfgießer. Das geduldig ausharrende Publikum hielt sich an das Bühnenpanorama und die Übersetzung von Christian Morgenstern, die noch am ehesten (trotz der kaum mehr erträglichen Salonmusik von Edvard Grieg) einen Teil vom Geist Ibsens vermittelt.
•
Der englische Dramatiker Terence Rattigan (Verfasser der auch in Wien unter anderem wohl bekannten Erfolgsstücken „Browning Version“, „Die tiefe blaue See“, „Einzeltische“) wird wegen seines „fast“ angeborenen Bühnensinns und des Ehrgeizes, mehr als bloße „Unterhaltung“ zu bieten, sehr geschätzt. Das Theater in der Josefstadt bringt eine Neuinszenierung seines mit Recht gerühmten „Winslow-Boy“. Die historische Begebenheit des 13jährigen, der wegen des Diebstahls eines Schecks über 5 Shilling aus der königlichen Marinekadettenanstalt ausgeschlossen wird und dessen Unschuld sich erst erweist, als seine Familie durch den Prozeß zugrunde gerichtet und der Fall das Parlament aufgestört hat, fesselt auch heute noch. Im Grunde ein englisches Sittenbild aus den Jahren vor 1914, wirkt es zeitlos als unbeirrter Kampf nicht um die Gerechtigkeit, denn die ist „höheren Mächten“ überantwortet, aber um das von Menschen geschaffene Recht. Rattigan mischt in seinem glänzend gebauten Stück Ernst und Humor und sorgt für Spannung bis zum Ende. Unter der Regie von Hans Jaray gefielen am besten Franz Eltons als Winslow-Boy, daneben Elfriede Ramhapp und Peter Matte als seine Geschwister. Überzeugend (wenn auch im Text noch merkwürdig unsicher) Johannes Heesters als eine Art englischer Michael Kohlhaas, nur mit mehr Huimor als der deutsche. Es wirkten noch mit Marianne Schönauer, Hans Jaray als britischer Superanwalt und Michael Toost. Lebhafter Beifall für Stück und Darsteller.
'
Keine größeren Kontraste sind denkbar als eine Woche der Gast-piele im Theater an der Wien.
Den Anfang machten zwei Darbietungen des New Yorker, nach Europa emigrierten Living Theatre. Die „Mysteries“, diese kurzen, unzusammenhängenden Szenen, deren „Sinn“ dem Wiener Publikum durchaus nicht aufgehen wollte und die zu einem handfesten Theaterskandal ausarteten, wurden in einem „Querschnitt“ bereits glossiert. (Siehe
„Furche“ Nummer 49). Am zweiten Abend zeigten die Amerikaner in „The Brig“ von Kenneth H. Brown den Tagesablauf in einem Gefängnis für amerikanische Marinesoldaten. Zwei Stunden brüllender, tobender Sadismus, bis aus den gequälten, geschundenen, zusammengehauten Strafgefangenen nur noch eine wehrlose, unmenschlich-mechanisch reagierende Masse übrig ist. Auch hier, wie schon in den „Mysteries“, wollen die beiden künstlerischen Leiter des Theaters (Judith Malina und Julian Beck) mit ihrem Ensemble durch Schockwirkung „Realität psychisch und physisch bis zum Exzeß“ erfahren lassen, und das unter weitgehender Ausschaltung des Wortes. Merkwürdig nur, wie dabei die bis ins letzte Detail naturalistisch getreu wiedergegebene Realität ihren Wirklichkeitscharakter einbüßt und sich geradezu ins Surreale übersteigert. Hier versagen alle dramaturgischen Regeln und alle kritischen Maßstäbe. Ein Teil des Publikums anerkannte zumindest die geradezu an Besessenheit grenzende Intensität der Darsteller.
Auf das Living Theatre folgte die „Bühne 64 Zürich“ mit der Komödie „Ein idealer Gatte“ von Oscar Wilde. Es bedeutete schon ein Wagnis für die Züricher, gerade mit einem soj chen Stück in Wien zu gastieren, wo man an der Josefstadt und im Akademietheater so vollendete Bühnenkonversation zu bieten versteht. Mehr als das vermag die an der Grenze des Reißers siedelnde Komödie von Wilde um verräterische Briefe, verlorene Schmuckstücke, politische Abenteuerinnen und gefährdete Ministerkarrieren kaum zu bieten. Noch erreichen hier Wildes Pointen, sein Spiel mit den Worten nicht die schwerelose Helle und die glänzende Oberfläche über dem Abgrund, wie in „Bunbury“, noch gilt es hier einen Ibsen-Rest zu tragen, wie jene Lady Chiltren, der einzige ernsthafte Charakter im Stück, die auf ihre ideale Forderung, einen „idealen Gatten“ ohne Furcht und Tadel zu haben, am Ende verzichten muß. Aber es gibt immerhin Rollen und große Szenen. Das Züricher Ensemble unter der Regie von Franz Josef Wild bot eine annehmbare Aufführung. Filmstar Karlheinz Böhm (der junge Franz Joseph der Sissy-Füme) spielte mit versierter Eleganz den hilfsbereiten Zyniker Lord Goring, Anaid Iplcjian eine beeindruckende Lady Chiltren, Alexander Kerst (nicht ganz gleichwertig) ihren „idealen“ Gatten. Nett Helga Schlack als muntere Mabel, Alfred Lohner als Pere Noble, zu leicht durchschaubar Ruth-Maria Kubitschek als abenteuerliche Mrs. Cheveley. Freundlicher Beifall.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































