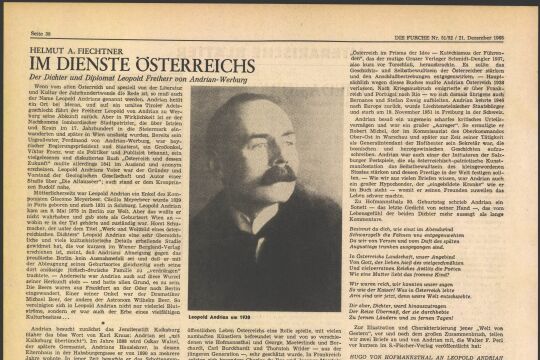Mit höchster Schöpferkraft erhob sich der Genius österreichischer Dichtung einmal in der Barockzeit, darnach ein zweitesmal dm ersten Viertel des gegenwärtigen Jahrhunderts. Dazwischen lagen das 18. und 19. Jahrhundert. Gewiß, Schöpfungen aus diesen beiden — Grillparzers etwa, Nestroys, Raimunds' — offenbaren noch immer ihre Größe, heute wie zur Zeit ihrer Entstehung. Dennoch prangt das, was ihnen vorausging (unsere Barockdichtung, etwa bis 1700) und was ihnen folgte (Expressionismus von Däubler und dem frühen Kokoschka, dem Dramatiker, bis zu den Synthetikern Musil, Gütersloh und Broch), mit einer Sprach- gewalt, die dort ganz einfach fehlt, wo der Klassizismus seinen — das freie Strömen der sprachlichen Kraft hemmenden — Einfluß ausübt. Bei Grillparzer und Raimund vermochte er dies noch.
Hätten die Zeitgenossen eines Grillparzer im 19. Jahrhundert Worte finden können, wie sie der Tiroler Barockdichter Adam von Brandis 1679 in seinem „Des Tirolischen Adlers Immergrünendes Ehren-Kräntzel“ in seiner Herrscherapotheose, in seiner Huldigung fand:
„Daß wir unter dem Schatten des Adlers ruhend der erwünschten Sicherheit genießen, und gehet dem vollkommenen Vergnügen der wohlgetrösteten Untertanen nichts anderes ab, als daß sie mit einhelliger Stimme wie der Knecht David die Göttliche Allmacht flehentlich anrufen, sie wolle den Hochlöblichsten österreichischen Namen unzählbar vermehren und den Gnadenfließenden Thron mit unabgänglicher Nachfolge besetzt halten!“
Es kommt uns hier durchaus nicht darauf an, daß es der monarchische „Thron“ ist, dem hier gehuldigt wird: später wird uns bei einem unserer Expressionistendichter eine andere Art von „Thron“ begegnen. Vom Inhalt ist ja hier gar nicht die Rede, nur von der gesteigerten Ausdruckskraft der Sprache. Sie stellt ein gewisses sprachschöpferisches Potential dar. Mit demselben Potential kann man auch genau das Gegenteil dessen aussagen, was hier den Inhalt Adam von Brandis’ ausmacht! Man kann Negation und Empörung ebenso gesteigert aussagen, wie hier der „Gnadenfließende Thron“ apostrophiert wird. Klar bewiesen wird dies etwa durch O. Kokoschkas „Brennenden Dornbusch“. Jedoch, ob der Inhalt positiv oder negativ sein mag: in beiden Fällen beschwört das Drängen der Empfindung im Dichter die Nennung der Namen von Göttern herauf. Ob Begeisterung, ob Verzweiflung: Götter! Etwa im bereits zitierten „Ehren- Kräntzel“:
„Nachdem bei viel tausend Jahren Phöbus hat die Erd umfahren,
Hat er endlich mit seinem Schein Unser Tirol genommen ein.
Und des Adlers Brut vergunnt Daß sie da bescheinen kunnt Der lieblich Auster, dessen Gaben Sie bereicht und b’schützet haben.
Pluto, Mars, Medusa weich,
Es lebe das Haus Österreich,
Es leb’ das löblichste Haus,
Bis aller Welt Bestand ist aus."
Das typisch barocke Daseinsgefühl des die Macht und Herrlichkeit seines Herrscherhauses Preisenden spricht aus diesen Worten. Das Haus Österreich, meint der Tiroler Adelige, möge währen bis ans Weitende, ja: „bis aller Welt Bestand ist aus“. Die Jungen, die der Tiroler Adler ausbrütete, seine „Brut“ (das Wort meint hier natürlich nichts Abwertendes!), erlangten durch Phöbus die Gunst, vom „lieblichen Auster“ bereichert, beschützt zu sein. Der antike Sonnenmann hat dies den Tiroler Adlerjungen „vergunnt“. Hingerissen von Begeisterung bricht Adam von Brandis aus in den Aufschrei, der alle feindlichen Gewalten bannen will:
„Pluto, Mars, Medusa weich!“
Die ebenso wie „Phöbus“ der Antike entnommenen negativen Mächte des düsteren Jenseits; Pluto — des Krieges: Mars — und der Häßlichkeit: Medusa sollen entweichen! Nicht im entferntesten wird es geleugnet, daß diese bösen Gewalten vorhanden sind. Jedoch Adam von Brandis äußert leidenschaftlich den Imperativ, der sie hinwegbannen will. Unser österreichischer Barockdichter ist zwar ein huldigender Hymniker; doch dies ist durchaus nicht dasselbe wie etwa ein verlogener Schmeichler. Die Gattung des bewußten Lügners, der sich durch Lobhudeleien Vorteile erschwindeln will, ist in der österreichischen Literatur so gut wie gar nicht aufgetreten: dies gereicht unserem Land zur Ehre! Ausdrücklich ist hervorzuheben, daß der Dichter nicht etwa „das löblichste Haus“ als bis ans Ende aller Tage fortdauernd hinstellt; daß er vielmehr nur dem heftigen Wunsch, dem Imperativ, daß dies sein soll, seinen so beredten Ausdruck gibt! Müssen denn Wünsche in Erfüllung gehen? Müssen Imperative befolgt werden? Mußten die Feindmächte „Pluto“. „Mars“ und „Medusa" dem Dichter gehorchen, der sie „entweichen“ hieß? Österreichs Geschichte hat ebenso die Stunde des Jahres 1679, da „Des Tirolischen Adlers Immergrünendes Ehren-Kräntzel“ diese Worte enthielt, durchlaufen, diese Stunde des gläubigen Imperativs eines Adam von Brandis, wie sie sieben Generationen danach das Jahr 1918 durchlief, das Jahr, da das „löblichste Haus“ anstatt weiterzuregieren, „bis aller Welt Bestand ist aus“, dem „Mars“ erlegen ist — dem Weltkrieg 1914 bis 1918 — und der „Medusa“, der ärgsten, entstellenden Diffamierung.
Österreichs jahrtausendelange Geschichte faßt diese wie jene Stunde gleichermaßen in sich. Und — wie es so oft geschieht — die positive der beiden Stunden sollte sich als die frühere, die negative als die spätere ereignen. Äußerlich schien ja die Welt von 1918 ein viel höheres Niveau darzubieten — zumindest was das rein zivilisatorische Moment betraf — als 1679. Trotzdem darf man es nicht übersehen, daß die Grausamkeit und barbarische Unmenschlichkeit des zur Qual ungezählter Verwundeter erfundenen — Waffenarsenals, von dem der erste Weltkrieg Gebrauch machte, keineswegs langsamer angewachsen war, als es für die positiven Errungenschaften der europäischen Menschheit, seit 1679, galt! Es scheint sogar, als sei das seit der Barockdichtung neu hinzugekommene Quantum sowohl an Bösem als an Gutem derart angewachsen, daß der Dichter Österreichs 1918 bereits von bösen und guten Engeln zu sprechen berechtigt war, ja sogar wie dies für den unglücklichen, genial begabten Expressioni'stendichter Ernst Weiß zu traf, sogar von Gott und Gegengott: Also von einer geradezu an Alt-Iran und Zarathustra erinnernden Polarisierung eines Urdualismus. Im lyrischen Werk von Emst Weiß tritt nichts deutlicher zutage als „Medusa“ — jene Macht, der zu „entweichen“ der Barockdichter einst befohlen hatte! Bis in die Einzelheiten dem „Medusen“-Schrecken ähnlich zeigt sich etwa das dichterische Bild, worin der expressionistische Dichter den Gegenpol dessen, was der Barockdichter formuliert hatte, tatsächlich erreicht:
„Um schwarz vereistes Andromeda-Gestirn hält Gegengott sich eng geringelt.
Blinden Planeten hat er mit Augen völlig umglast, Spion der Seelen, Polizeihund, auf Menschen gehetzt.
Mit Millionen Armen peitscht er vor sich rasend rauchende Flammenfelder der Sonne,
Giftig, mit giftiger Güte lockt er lebendige Wesen ans giftige Licht."
Hier scheint das Medusenhafte ganz nahe herangerückt zu sein. Man glaubt es beinahe zu spüren. Auch „Mars“, den der Barockdichter vom „Hause Österreich“ so weit hinweggewünscht hatte, trumpfte hier auf: „Polizeihund, auf Menschen gehetzt.“ Und immer wieder kleiden sich in unserer österreichischen Literatur, manchmal sogar auch im Werk von deren satirischen Meistern (Nestroy, später Herzmanovsky- Orlando) die Gewalten sowohl des positiven als des negativen Erlebenspoles in antike Inkarnationen ein (in der sonstigen deutschsprachigen Literatur erscheint dieses Motiv zwar auch, es ist aber seltener) — so die hier gleichsam mit dem Minuszeichen versehene „Andromeda“ (eine wirklich/ echte „Medusa“, denn an deren „Schlangenhaar“ denkt man ja auch, weil sich um sie der „Gegengott“ „ringelt“!), zu welcher der strahlende „Phöbus“ des Barockdichters so recht den Kontaktpunkt bildet — sie sind beide Male nicht etwa im Sinn einer Gelehrsamkeit, sie sind vielmehr ursprünglich-dichterisch antikisiert! Ja, auch alle Ungelöstheit des Daseinsrätsels fand einen Ausdruck in der aus Mythologie entnommenen Gleichnissprache um 1918; und er entkam dem Herzen des vom Daseinsproblem Gepeinigten ebenso unmittelbar und stark, wie der „Phöbus“ des Barockdichters, in großartiger Naivität, vormals entsprungen war. Der aus der Nähe von Wien geborene Georg Kulka vermochte die Worte zu formulieren:
„Im Nadir aller Nächte Verrammelte erlöste KIRKE zum Kriechen."
Die „Kirke“, von deren Namen wir das lächerliche Zeitwort „Bezirzen“ als eine nicht gerade geschmackvolle Ableitung bildeten, wird hier so sehr im innersten Wesen erfaßt, daß ihr Sänger — Homer, die Odyssee gestaltend — es dem späten, Jahrtausende später geborenen Nachfahren gewiß bezeugt haben würde, er sei sein echter Nachfolger im Geiste: Kirkes Wesen ist das einer „partiellen“ Erlöserin! Unzählige sind zugeschlossen, „verrammelt“; Ungezählte krümmen sich „im Nadir aller Nächte“! Aufrichten können sie sich zwar durch Kirkes Zauber noch nicht, aber bis zum „Kriechen“ können sie es bringen. Immerhin etwas, wenn auch nicht eben viel! Obwohl ein bitteres Schicksal beiden Dichtern, Ernst Weiß und Georg Kulka, einen elenden Tod bereitete, haben sie in der Expression, wie zuvor der Dichter in der
Barocksprache, echte Aussagen im Idiom der antiken Symbolwelt erbracht.
Gäbe es endlich das, was wir sehnlichst erhoffen müssen: Gäbe es ein echtes österreichisches Nationalgefühl, das in die Tiefen der vergangenen Jahrtausende zurückreicht, die versunkenen Epochen in unserem Bewußtsein mit einbegreift, gäbe es dies endlich, endlich! Es müßte dann zur Kenntnis nehmen, daß schon während der Barockepoche Dichter lebten, die „Ehrenösterreicher“ genannt zu werden verdienten. Denn wie sollte man sonst einen aus entlegener Ferne nach Wien gekommenen Sänger der „imperialen“ Barockherrlichkeit des „Hauses Österreich“ nennen? Kein anderer Name als „Ehrenösterreicher“ geziemte dem aus Breslau heimischen Daniel Kaspar von Lohenstein. Unter der Regierung Leopold I., 1858 bis 1705, war er zeitweise der Gesandte seiner schlesischen Vaterstadt. Daß diese Stadt noch kurz vorher, im Dreißigjährigen Kriege, sogar zu der dem Kaiser feindlichen Gegenpartei gehört hatte: Es war für Lohenstein kein Hinderungsgrund, ein herrliches Hochzeitslied anzustimmen, als sich Leopold I. in einer ersten Ehe mit Claudia Felicitas von Brieg vermählte. Da diese für ein Gebiet, das am Flusse Oder gelegen war, die Gestalt der Herrin verkörpert hatte, ist es der Oderfluß, der in der Ichform (dies muß man, um die Huldigung zu verstehen, wissen) alle anderen Flüsse an Hingabebereitschaft übertrifft; Isar und Mur opfern köstliche Gaben, jedoch nicht sich selbst:
„Muß Mitternacht doch selbst so denn empfinden Des Sommers Glut, des Mittags Brand.
Wie soll sich nun nicht mein kalt Eis entzünden,
Die Andacht reizen meinen Strand?
Ja, die Freude, die mich regt,
Macht, daß mein Strom ein Meer voll Feuer hegt.
Die Mure prangt jetzt mit der Hochzeitskerze,
Es liefern Inn und Ister Gold —
Die Isar Perl’n, ich opfere mein Herze,
Durchlauchtigster großer Leopold!"
Empfinden wir noch den Höhenflug in solchen Worten einer Begeisterung, die vor Jahrhunderten gebrannt hat? „Ein Meer voll Feuer“ — voll des Freudenfeuers? Die Gabe des Goldes bringt „Ister“ (die Donau!) dar, die Kerze liefert die „Mure“ (Mur).
Wohl hört es sich unglaublich an, und dennoch ist es wahr: Im 20. Jahrhundert ist innerhalb Österreichs Dichtung etwas auferstanden, was die Barockpracht dieser Huldigungssprache nach fast drei Jahrhunderten neu hat aufleben lassen: Expressionistendichter aus unseren Alpenländern stimmten aufs neue ein in die Tonflucht der Hymnik, wie sie unterm ersten Leopold das österreichische Volksingenium durchwogt hatte. Und daran hinderte manche unserer Dichter zwischen 1907 und 1925 nicht einmal dies, daß das Herrscherideal seit dem Barock verschlissen und verkommen war, und mehr noch, nicht einmal die teilweise revolutionäre, republikanische oder anarchistische Gesinnung unserer stärksten Dichter um 1910 konnte es verhindern, daß Klänge wie einst im Barock aufs neue erbrausten! Wesensähnlich dem Lohenstein-Gedicht, sogar bis in den Bereich des Wortschatzes hinein, erklingt die Schlußstrophe des „Nordlicht“-Dichters Theodor Däubler (1867 bis 1934) im Gedicht „An Siena“:
„Den Samen schenken wir den unbescholtnen Schollen.
Der Auferstehungsatem fordre mich von Söhnen.
Den Glauben lenken wir nach vollem goldnen Wollen,
Aus Füllhörnern den Thron der Sonnen hold zu krönen.“
Ein visionärer Thron, eiin „Thron der Sonnen“, wird hier geschaut. Wirkt er nicht, nach Jahrhunderten, wie eine verklärte, sublimierte Gestalt, die unserem Jahrhundert dasselbe im Geist bedeuten könnte, was der „Gnadenfließende Thron“ dem Adam von Brandis in seiner Epoche bedeutet hatte? Völlig dem Barock verwandt sind hier auch die „den Thron der Sonnen krönenden“ Füllhörner. Wer weiß es denn nicht, wie häufig etwa „Das Füllhorn der Pomona“ auf barocken Gemälden auftritt? Nur sind es nunmehr, in völlig veränderter Welt, spirituelle Gaben, nicht mehr sinnlich greifbare wie in Lohensteins Gedicht, welche den Inhalt der zur Ausspendung bereiten Füllhörner aufbereiten. Der „Glaube“ wird auf das Füllhorn hinzu „gelenkt“, das „Wol- ler" desgleichen. Also: nur noch geistige Kräfte! Aber noch immer wird, als „golden“, das ins Füllhorn hinein zu verschließende „Wollen“ veranschaulicht.