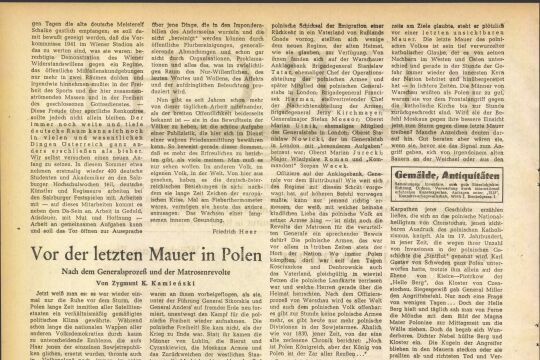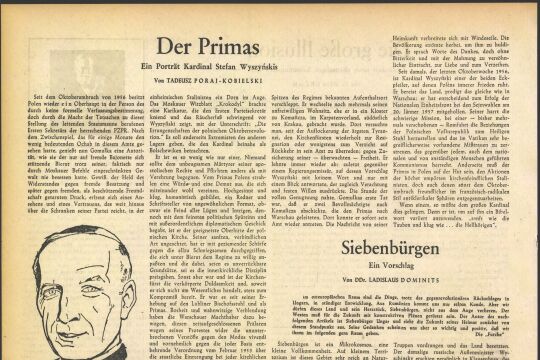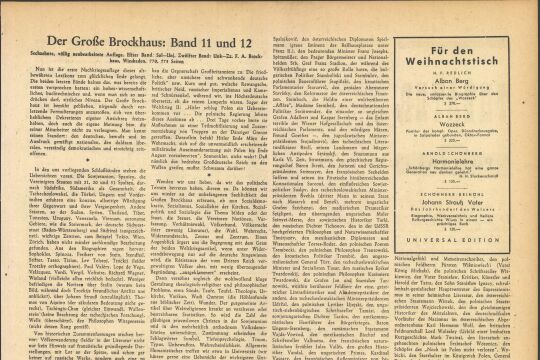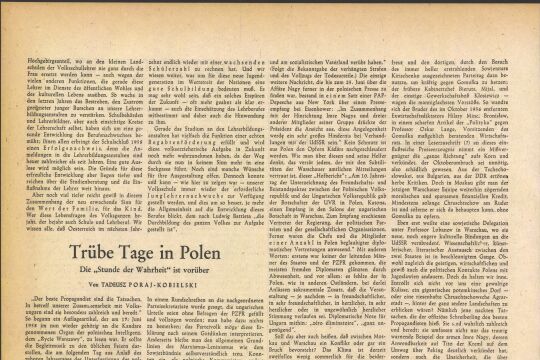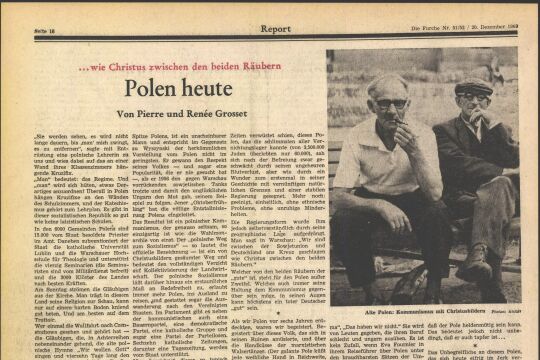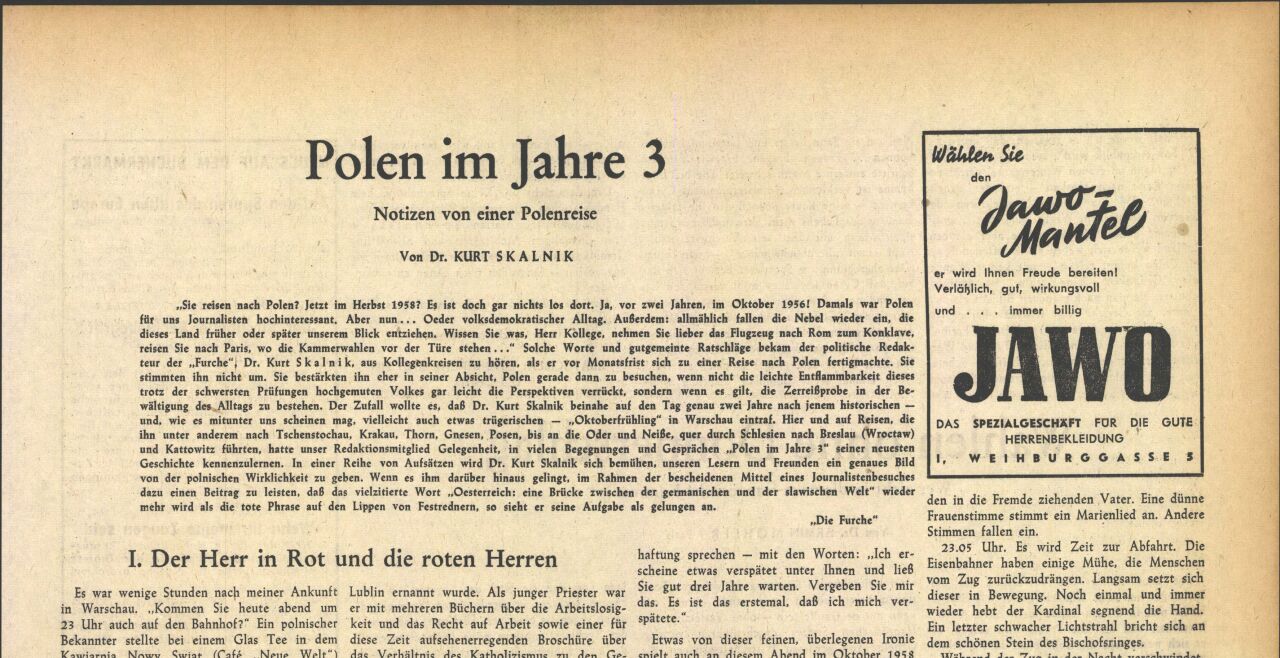
Polen im Jahre 3
Oesterreich: eine Brücke zwischen der germanischen und der slawischen Welt“ wieder mehr wird als die tote Phrase auf den Lippen von Festrednern, so sieht er seine Aufgabe als gelungen an.
Oesterreich: eine Brücke zwischen der germanischen und der slawischen Welt“ wieder mehr wird als die tote Phrase auf den Lippen von Festrednern, so sieht er seine Aufgabe als gelungen an.
Die Furche“
I. Der Herr in Rot und die roten Herren
Es war wenige Stunden nach meiner Ankunft in Warschau. „Kommen Sie heute abend um 23 Uhr auch auf den Bahnhof?“ Ein polnischer Bekannter stellte bei einem Glas Tee in dem Kawiarnia Nowy Swiat (Cafe „Neue Welt“) diese Frage Und um jede längere Erklärung vorwegzunehmen, setzte er gleich hinzu: „Der Kardinal reist heute zum Konklave nach Rom ab. Wenn Sie ihn sehen wollen, gibt es leider nur diese eine Gelegenheit.“
Hiermit war die Antwort ebenfalls schon gegeben.
Bahnhöfe sind selten in den schönsten Bezirken einer Großstadt anzutreffen. Warum sollte es mit dem Hauptbahnhof des noch für Jahrzehnte seine schweren, ehrenvollen Kriegsnarben der Welt zeigenden Warschaus anders sein? Das kleine, schmucklose Gebäude läßt auf den ersten Blick eher eine Vorortebahn erwarten. Allein: irgendein Fünf jahresplan will ja einmal die Schienenstränge unterirdisch bis in das Herz der polnischen Metropole führen und hier, ähnlich wie in Brüssel, einen unterirdischen Zentralbahnhof erstehen lassen. Bis dahin freilich mag noch einiges Wasser die Weichsel abwärts in die Ostsee fließen.
Trübe schaukeln die, schwachen.., Lampen auf dem ungedeckten, zugigen Perron. Feuchter Dampf steigt von den Bremsventilen des langen Schnellzuges auf. Die letzten Waggons sind überfüllt. Sie dienen dem „Lokalverkehr“. Spätestens in Kattowitz wird man sie abhängen. Dann werden die Bäuerinnen in ihren bodenlangen Kitteln, und die Männer in den Lodenjoppen, die durch die billigen Verkehrsmitteltarife zu Verwandtenbesuchen direkt eingeladen werden, wieder bei ihren Familien sein. Die vorderen Wagen aber müssen weiterrollen. Auch der ungebührlich lange und lästige Aufenthalt an der tschechischen Grenze kann sie nicht aufhalten. Morgen mittag werden sie in Wien sein.
Eine 200 bis 300 Köpfe umfassende Menschenmenge zeigt uns das Ziel. Sie wogt vor dem leeren Schlafwagen mit der deutschen Aufschrift, den Cook als Sonderwagen für Kardinal Wyszynski und sein kleines Gefolge zur Verfügung stellte. Die Vorhänge sind zwar heruntergelassen, aber der Wagen ist leer. Der Kardinal ist noch nicht eingetroffen. Die Wartenden sind geduldig. Uns aber geben sie Gelegenheit, die Menschen näher zu betrachten, die es sich nicht nehmen lassen, „ihrem Kardinal“ am späten Abend eines naßkalten Oktobertages das Geleit zu geben. Es ist ein Querschnitt durch den polnischen Katholizismus der Gegenwart. Priester und Laien, Akademiker und „Kirchenvolk“ — das wohl in allen Ländern verwandte Züge zeigt. Das Violett einiger Weihbischöfe leuchtet auch bei dem trüben Licht. Im Kreise der in Warschau anwesenden Mitglieder der kleinen, das Vertrauen der Hierarchie genießenden Abgeordnetengruppe steht — unverkennbar durch seine große französische Baskenmütze — das „Einzwölftel Staatsoberhaupt“: der katholische Schriftsteller und Angehörige des zwölf Köpfe umfassenden Staatsrates, Jerzy Zawieyski.
Die wie ein gelber Mond über der Szene schwebende Bahnhofsuhr zeigt 22.45 Uhr. Bewegung kommt in die Wartenden. Von der Spitze des Zuges naht eine kleine Gruppe. Sie muß durch einen Nebeneingang in das Bahnhofsgelände gelangt sein. Scheinwerfer flammen auf, das Knistern der Blitzlichter setzt ein: in ihrem Licht tritt uns die hochgewachsene, von vielen Bildern bekannte Gestalt des Primas von Polen entgegen.
„Soli Deo“ (Ich diene Gott allein), diesen Wahlspruch hatte sich der in dem kleinen Dorf Zuzela am Bug, in der Nähe von Bialystok, geborene Sohn des Dorfschullehrers und Organisten gewählt, als er 1946 zum Bischof von
Lublin ernannt wurde. Als junger Priester war er mit mehreren Büchern über die Arbeitslosigkeit und das Recht auf Arbeit sowie einer für diese Zeit aufsehenerregenden Broschüre über das Verhältnis des Katholizismus zu den Gewerkschaftern hervorgetreten. Der Krieg sah den 38jährigen Pater Wyszynski im polnischen Untergrund als Seelsorger der Warschauer Studenten und Arbeiter. „Soli Deo“: Am 3. Jänner 1949 bringt der greise Kardinal von Krakau,
Sapieha, Wyszynski die Ernennung zum Primas von Polen. Die Flut, die in jenen Jahren überall im sowjetischen Einflußbereich gegen die Grundfesten der Kirche andrängt, steigt. Im September 1953 wird Erzbischof Wyszynski, als er von einer Abendmesse in der St.-Annen-Kirche in sein Palais in der nahen Miodowastraße zurückkehrt, von schwerbewaffneter Polizei erwartet und verhaftet. „Soli Deo.“ Jahre der Haft in verschiedenen Klöstern folgen. Der Kirchenfürst, den Papst Pius XII. zum Kardinal macht, nützt die Zeit. Die Lektüre der Klassiker des Marxismus-Leninismus läßt ihn später nicht ohne Ironie einmal bemerken: „Ich bin besser in der kommunistischen Lehre bewandert als irgendein Mitglied des Politbüros. Ich werde ihnen jederzeit bei einer Diskussion überlegen sein.“ Im Oktober 1956 war der Zeitpunkt der Diskussion gekommen. Am 28. dieses Monats kehrte der Kardinal in sein Palais zurück. Am darauffolgenden Sonntag begann er eine Predigt in der überfüllten Heiligenkreuzkirche — hier sollte er am ersten Sonntag nach seiner Verhaftung sprechen — mit den Worten: „Ich erscheine etwas verspätet unter Ihnen und ließ Sie gut drei Jahre warten. Vergeben Sie mir das. Es ist das erstemal, daß ich mich verspätete. “
Etwas von dieser feinen, überlegenen Ironie spielt auch an diesem Abend im Oktober 195 8 um die Mundwinkel des Kardinals angesichts der wartenden Gläubigen. Dem Gruß und Segen folgt, in scherzhaftem Ton vorgetragen, der Befehl: „Solange ich fort bin, betet allein den Rosenkranz!“ Alle lachen. Aber nicht allen ist wohl dabei. Wird er auch wirklich wiederkehren?
Der Kardinal ist eingestiegen; bald erscheint er aber beim Fenster. Ein großes Gedränge setzt ein. Jeder will nach vorne. Will noch das eine oder andere Wort mit dem Primas wechseln, ihm wenigstens einen frommen Wunsch auf die Reise mitgeben — und immer wieder die Bitte, sie nicht zu vergessen, sie auf keinen Fall allein zu lassen. So verabschiedet eine große Familie den in die Fremde ziehenden Vater. Eine dünne Frauenstimme stimmt ein Marienlied an. Andere Stimmen fallen ein.
23.05 Uhr. Es wird Zeit zur Abfahrt. Die Eisenbahner haben einige Mühe, die Menschen vom Zug zurückzudrängen. Langsam setzt sich dieser in Bewegung. Noch einmal und immer wieder hebt der Kardinal segnend die Hand. Ein letzter schwacher Lichtstrahl bricht sich an dem schönen Stein des Bischofsringes.
Während der Zug in der Nacht verschwindet, verlassen die Vertreter der Warschauer Katholiken den bald stockfinsteren Bahnsteig und zerstreuen sich allmählich. Nirgends ist eine Uniform zu finden. Nur ein einsamer Milizposten dreht gähnend seine Runde. Jetzt löscht vielleicht Kardinal Stepinac in seinem Heimatdorf, das ihm zur Haft wurde, die Lampe, und Kardinal Mindszenty findet in der amerikanischen Gesandtschaft in Budapest keinen Schlaf. Der polnische Oberhirte aber ist auf dem Weg nach Rom, wo er — wenn wir den inzwischen lautgewordenen Stimmen trauen können — eine möglicherweise historische Rolle im Konklave spielen sollte.
Dies war mein erster Abend in Polen.
Genau eine Woche später war der Warschauer Hauptbahnhof abermals unser Ziel. Die Szene hatte gewechselt. Es war jetzt Tag. Ein anderer Bahnsteig wartete. Nur der feuchte Oktobernebel der Masowschen Flußniederung sog sich abermals in die Kleider. Kleine Fähnchen wehten: weißrote, in Abwechslung mit sowjetischen. (Der polnische Wind muß etwas gegen rote Fahnen haben. Die meisten von diesen — und nur diese — waren eingerollt.) Die Posten der durch gelbe Aufschläge gekennzeichneten polnischen Garde — zum Unterschied von anderen Ländern (und nicht nur solchen des Ostblockes) legt die polnische Armee bis zum letzten Uniformknopf größten Wert auf ein repräsentatives, den eigenen Traditionen entsprechendes Aeußeres — haben an dem ausländischen Besucher ihr Interesse nicht verschwendet. Und doch ist dieser eben dabei, in geheiligte Bezirke einzudringen. Steht doch auf dem Bahnsteig jener Sonderzug, der Gomulka und die polnische Regierungsdelegation nach Moskau bringen wird. Rechts sind die Diplomaten aufgestellt. Dort gehört man nicht hin. Also links halten. Doch, halt: der Mann mit dem verbeulten Filzhut kommt einem von Bildern bekannt vor. Kein Zweifel: es ist Go-mulkas Vorgänger als Generalsekretär der polnischen KP, Edward Ochab, und das pfiffige, große Jungengesicht daneben gehört niemand anderem als Außenminister Rapacki. Nein: inmitten des ZK der polnischen KP ist keineswegs unser Platz. Ein Radiokabel erweist sich als Ariadnefaden. Es führt dorthin, wo man hingehört: in den Kreis der in- und ausländischen Presse.
Zu Meditationen über das geringe Sicherheitsbedürfnis der polnischen Staatslenker, das sich von dem anderer kommunistischer Führer merklich unterscheidet, ist wenig Zeit. Ein militärisches Kommando. Die Kapelle der Ehrenkompanie intoniert „Jesze Polska nie zginela ...“ Mit blankem Säbel meldet der Offizier dem drei Meter vor uns haltenden Mann im grauen Wintermantel. Das Spielen der Nationalhymne läßt Zeit, ihn zu studieren: Das also ist der kommunistische Führer eines leidenschaftlich antikommunistischen Landes, der Marxist, den vor zwei Jahren glühende Patrioten und Katholiken „swoj“ (unser eigen) nannten. Der Reif hat in der Zwischenzeit manche im „Oktoberfrühling“ gewachsene Blüte wieder versengt und die stürmische Liebe zu „Wladyslaw“ ist inzwischen bei vielen einer „Vernunftehe“ gewichen. Allein die überwiegende Mehrheit aller Polen ist auch heute noch der Ansicht, daß Gomulka nach wie vor zu seinem Versprechen, Niemals werde ich es zulassen, daß Polen zur 17. Sowjetrepublik wird“, steht.
Der Mann im grauen Wintermantel verrät vor dieser Reise nach Moskau — von der manche fürchten, daß sie weitere Korrekturen de# „eigenen polnischen Weges zum Sozialismus“ zur Folge haben könnte, andere aber glauben, Rußland werde sich wegen seiner offenen Frage mit China kulant zeigen — mit keiner Wimper leine Gedanken. Seine Statur ist übrigens robuster, als man nach manchen Bildern glauben könnte, das Gesicht zeigt frischere Farben. Ist er der Garant der (relativen) polnischen Freiheit oder ist er nur — so ein in diesen Tagen in Warschau kursierendes, gar nicht heiteres Scherzwort — der Schlosser, der die verrostete Schraube
ölte, um sie dann besser und fester anziehen zu können... Fragen, Fragen, Fragen: der drei Schritte entfernte Mann schweigt. Die Nationalhymne ist verklungen. Ministerpräsident Cyran-kiewicz — seine Leute nennen den die feineren Genüsse des Lebens nicht verschmähenden massigen Mann mit dem seit Auschwitz kahlen Kopf einen „Berufsschwimmer“ — tritt hinzu. (Das eher gutmütige Spottwort bezieht sich darauf, daß Cyrankiewicz es wohl verstanden hat, vor und nach dem Oktober mit dem Strom zu schwimmen.) Gomulka und die anderen Männer der polnischen Delegation besteigen den Zug. Ein paar Blumenbukette verschwinden in den Fenstern. Einige Scherzworte kommen als Dank. Noch einmal steht Gomulka, sichtlich widerwillig — im ganzen Land wird man vergeblich Gomulka-Bilder und Gomulka-Büsten suchen —, den Pressephotographen Pose.
Der Zug zieht an. Keine Sprechchöre, kein Händeklatschen. Mit ernstem Blick verfolgt Verteidigungsminister Marian Spychalski — dem ehemaligen Architekten und Mithäftling Gomulkas sitzt die elegante Generalsuniform wie angegossen — lange den nach Osten entschwindenden Zug.
Auch er trägt seine Gedanken nicht auf der Stirne.
In der nächsten Nummer:
ZBAWICIELA: EINE KIRCHE UND EIN GLEICHNIS