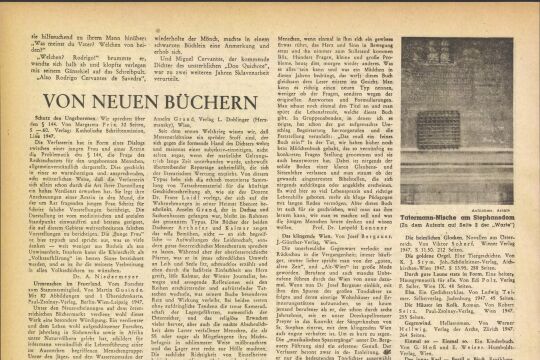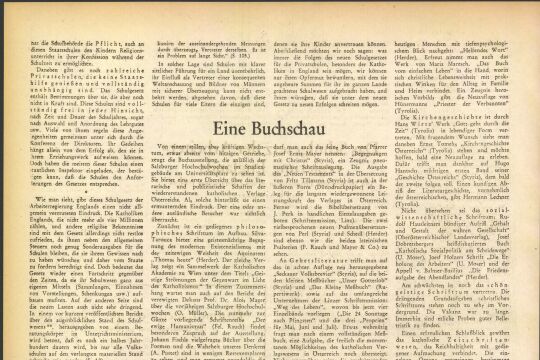Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Politische und unpolitische Pseudoromantik
Kurz vor Antritt ihres Schweizer Gastspiels hat das Studio der Ho c h-schulen noch eine Nestroy-Premiere herausgebracht: „Freiheit in Krähwinke 1“. Die Versuchung, diese politische Posse von 1848 zu einer Art mahnender Vorfeier für 1948 zu gestalten, war für junge Leute, welche nidit nur für das Theater auf der Bühne, sondern auch für das Theater unseres Lebens helle Augen und warme Herzen haben, groß genug. Nun, Michael Kehlmann und seine Mitarbeiter sind dieser Versuchung mit zuviel Verstand erlegen: So entstand ein Nestroy, der zwischen dem neuen Salzburger Kabarett-Jedermann, dem Wiener Werkel und seinen zeit-und unzeitgemäßen Nadifolgern und einem moralpolitisdien Witzblatt für reifere Semester hin und her schwankt. Damit soll diese vom Publikum mit warmem Beifall aufgenommene Neubearbeitung keineswegs schlechthin abgelehnt werden. Die zahlreichen Nestroy-Inszenierungen der Wiener Theater in den letzten zwei Jahren lassen aber ein Grundproblem akut werden: Nestroy steht heute am Scheidewege. Wollen wir einen „amerikanisdien“ Nestroy von 1947 oder einen Wiener Nestroy von 1848? In den Vereinigten Staaten ist in den letzten Jahren ein neuer Typ von Zeitstück aufgekommen: man schreibt ältere Stücke auf die Tagesmode um, färbt sie täglich neu ein. Diel Schauspieler erfahren erst kurz vor der jeweiligen Vorstellung die neuesten zeithaften Anzüglichkeiten, welche sie in ihrer Rolle eben für diesen Tag unterzubringen haben! Nun hat bekanntlich einer der erfolgreichsten amerikanischen Dichter der Gegenwart, Thorn-ton Wilder, Nestroy ins Amerikanische übersetzt — wir verwehren uns aber der Vorstellung eines mit Broadwaywitzen erhitzten Nestroy! An einen solchen rüdct aber diese letzte Wiener Attrappierung heran, wenn sie die UNO im Jazzrhythmus auf die Bühne bringt und aus der „Reaktion von 1848“ das sehr umstrittene gleichnamige Schlagwort von 1947/48 werden läßt! Wir glauben, daß der Ruf „Zurück zum Nestroy von 1 8 4 8!“ nicht reaktionär, sondern ein Gebot dieser Stunde unseres Welttheaters ist! Man begnüge sich — und lasse Nestroy selbst sprechen: wer seine Worte, seine voll plastischen Lebens sprühenden Gestalten, seine Ironie Und seine Lebensweisheit nicht versteht, wird auch durch den Souffleur von 1947 keinen Einblick in die Verhältnisse der zwei Bühnen *- des Seins und des Scheins — erhalten, er wird darauf angewiesen bleiben, geklebte Schlagworte für Wirklichkeit zu nehmen: auf der Rampe der Studios, auf der Rampe unserer Universität, auf der Tribüne des öffentlichen Lebens!
Ein neues Genre kreieren das Theater in der Josefstadt mit „Santa Cruz“ von Max Frisch und die Stephansspieler mit dem „T o b i a s Wunderlich“ von H. O r t n e r. Sosehr die Themen und auch die Qualität der Aufführungen differieren, so weit, kulturgeographisch gesehen, der Weg von der Josefstadt in die Dingelstedtgasse ist, beide Male handelt es sich hier um dieselbe Marke „Edelkitsdi“. Da diese, wie falscher Schaumwein, sehr gangbar, genüßlich und leichtflüssig ist, scheint in beiden Stücken der Publikumserfolg gesichert. Dennoch wollen wir nicht hoffen, daß sich die Wiener Theater, nachdem sie im Vorjahr in allerlei Halb- und Unterwelten lustgewandelt sind, sich nunmehr einer neuen Gartenlaube verschreiben: Romantik für verschämte Rationalisten, “Traumspiale für sehr wache Geschäftsleute, Poesie für absolut Phantasielose! Der Schweizer Max Frisdi nennt sein Opus eine „Romanze in sechs Bildern“. Frisch hat eine Vorliebe für Stücke, die im Niemandsland spielen. In „Nun singen sie wieder“ unterhalten sich tote, von den Deutschen erschossene Ostmenschen mit ebenfalls toten deutschen Fliegern in einer Astralsphäre, welche gleich weit entfernt ist vom Märchen, von der Legende, vom echten Mythos und Mysterium„ aber auch vom Lande Orplid, der Heimat des schöpferischen Genies, des wirklichen Dichters! In seiner Romanze verwandelt nun der Autor ein altes Schloß in eine Somnambulenbar.1 Dem herrschaftlichen Paar begegnet in dem Vaganten Pellegrin die Erinnerung an Erlebnisse, welche vor 17 Jahren eine Rolle in seinem Leben gespielt haben! Wo soll nun weitergespielt werden? Da, wo Mann“ und Frau vor 17 Jahren stockenden Herzens steckengeblieben sind, da sie beide ihre Rolle nicht mehr aus eigener Kraft weiterzuspielen vermochten, oder in der Gegenwart, welche verschattet wird durch das Hereinschneien dieses träumerischen Lumpen? Bevor noch der Autor sich endgültig entscheidet, stirbt Pellegrin, sein Kind sagt ein Sprüchlein auf, die Ehegatten haben sich wieder gefunden. Uber der Bühne aber steht ein zarter Duft, ein feiner Schimmer von Ferne, Frühlicht, Sehnsucht und Sentimentalität. Der hochkultivierten sensiblen Regieileistung, dem wohltemperierten, sorgsam abgestimmten Spiel des Ensembles der Josefstadt ist es geglückt, diese Arbeit, der man die Anstrengungen des Hirns, nicht aber des Herzens anmerkt — so „gekonnt“, so geschickt „gemacht“ ist' sie —, zu einer Melodie (also doch-noch Romanze!) werden zu lassen. Eine ernste Frage: Soll und darf eine hervorragende Bühne ein Werk ohne echten Tiefgang, ohne wirklichen Gehalt mit soviel Klugheit, Menschlichkeit und Stimmungsmusik umkleiden, daß es sich zu guter Letzt doch noch wie ein wahres Schauspiel gerieren kann?
Dieselbe Problematik — noch vermehrt um einige andere Fragenkreise — tritt uns in der Tobias-Wunderlich-Aufführung der Stephansspieler entgegen. Dieser Tobias Wunderlich war vor zwanzig Jahren ein Welterfolg. In einer Welt, welche den Zynismus der ersten Nadtkriegszeit eben zu verdauen begann (ohne ihn jedoch vergessen zu können und auch ganz entbehren zu wollen), welche sich wieder nach „Romantik“ sehnte, ohne noch das Raffinement der französischen Neuromantik zu kennen, mußte dieser biderbe Holzschuhmadiermeister Tobias Wunderlich, dem seine heilige Barbara aus dem Altarschrein zusteigt, weil die bösen Bauern diesen nach Amerika verkaufen wollen, rührend, poetisch, zumindest kraftgenialisch wirken: Dieser breite Klotz mit dem schwärmerischen und schwärenden Herzen, der bei Bedarf vom „Dom des Waldes“ und der Kunst zu sprechen weiß, ein Meistersinger ohne San* geskraft, im Tiefsten weder wundersam noch auch dem echten Wunder hörig, eben nur „wunderlich“. Um nicht mißverstanden zu werden: lobenswert — und zeitbedingt— die Tendenz der Entlarvung bäuerlicher Dekadenz, des harten, vergilbten Scheinchristentums „volksfrommen Brauchtums“ ... 1925 fordert hier sein Recht, wir wollen auch nicht leugnen, daß dieselben Verhältnisse auch heute noch an nicht wenigen Orten anzutreffen sind, daß ihre Untersuchung nicht nur Gegenstand eines Bühnenstückes von 1925 sein sollte ... Der Zeitbedingten Kritik antwortet aber kein Positivum: die Mär von dieser heiligen Barbara ist weder glaubensmäßig noch rational, nur sentimental zu verstehen! Für diese Art von Sentimentalität fehlt uns jedoch heute das Organ — sosehr es uns erfreut, daß die liebwerte Heilige am Schluß dem hungrigen Holzschuhmachermeister, Geisterseher, Künstler und Hauspoet Tobias Wunderlich eine Schüssel selbstgemachter Knödel auf den Tisch stellt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!