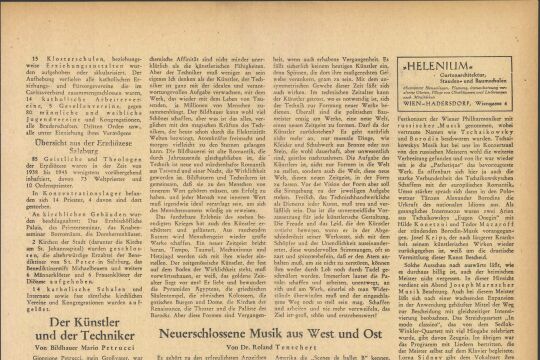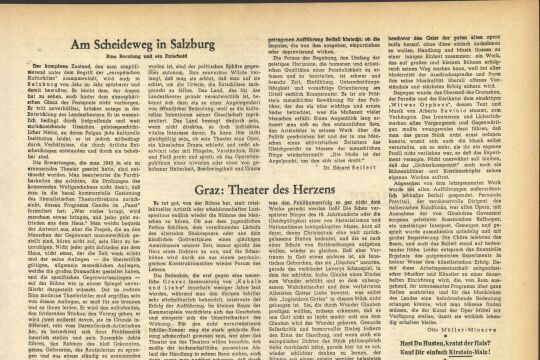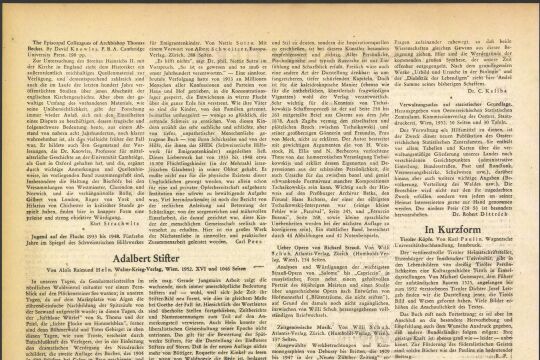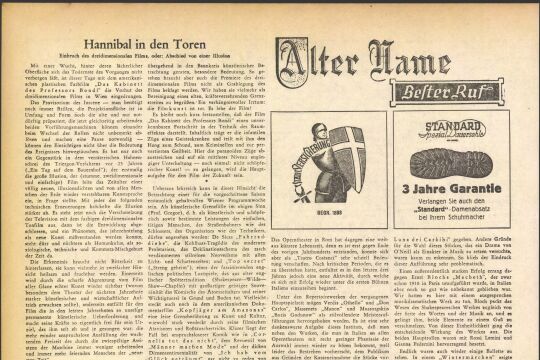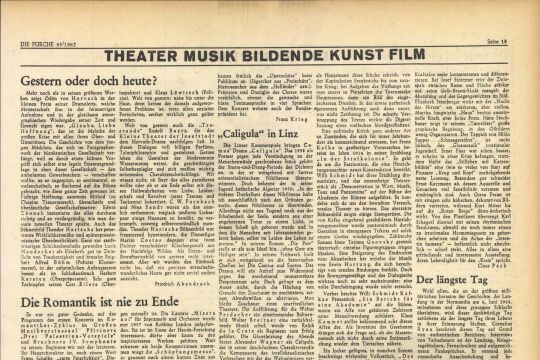Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Profil ohne Repertoire
Zürich, im Juli Es kann nicht behauptet werden, daß die Zürcher „Woche der modernen Oper“ so etwas wie einen Ausweg aus der latenten Krise dieser Kunstgattung gezeigt hat. Wahrscheinlich bedeutet die zur gleichen Zeit in Wien erfolgte Uraufführung des „Sturms“ von Frank Martin für die Gegenwart der modernen Oper mehr als die Gesamtheit der sechs Werke, die in Zürich vorgeführt wurden, für deren Zukunft. Und doch: der Boden, aus dem einmal das Geniewerk einer wirklich modernen Oper entsprießen kann, wird in Zürich besser bestellt als anderswo: er wird beackert, besät und natürlich auch gedüngt. Anderswo liegt er brach.
Aus der Vielfalt der Werke ragt eines heraus, das wirklich in die Zukunft weist: die Zwölftonoper des Schweizer Komponisten Armin S c h i b 1 e r, „Die Füße im Feuer“, die nach Conrad Ferdinand Meyers Gedicht eine Episode aus den Hugenottenkriegen erzählt. Die Ballade, in der Düsternis eines Schlosses abrollend, wird musikalisch treffend und auch dramatisch packend illustriert. Freilich, mehr als die Kraft einer Illustration kann die Musik nicht liefern. Und im Kontrast zu dem gleichfalls aufgeführten „Wozzeck“ von Alban Berg wird man sich des Gefühls nicht entschlagen können, daß nur eine stilistische Linie die beiden Komponisten verbindet. Immerhin ist es eine, die eine Fortsetzung haben könnte.
Keine Fortsetzung hat die Musik Ferruccio B u s o n i s gefunden, wie sie in des Meisters Oper „Doktor Faustus“ enthalten ist. Die sonderbarsten Extreme berühren sich in ihr: gelahrte Kontrapunktik, deutsche Romantik, italienische Melodik, ja sogar eine lange Orgeltoccata stehen nebeneinander, so dicht, daß man sich manchmal fragt, wie in einem Kopf so viele Weisen einträglich vereint sein konnten. Und sonderbar, auch in der lediglich vom Geschmack bestimmten Kategorie der ästhetischen Beurteilung findet sich eine Parallele zur Stilistik: Zwischen den Urteilen genial, talentiert, gekonnt schwankend, entscheidet man sich zuletzt für einen Nenner, welcher heißt: Bewunderung einer vielseitigen und starken Persönlichkeit.
Ein Einakter von dem in Paris lebenden rumänischen Komponisten M i h a I o v i c i, „Die Heimkehr“, ist dramatisch völlig instinktlos verfaßt und plätschert musikalisch im seichten Wässerchen eines selbstzufriedenen Impressionismus. Die Aufführung von zwei Honegger-Werken aus den zwanziger Jahren, „A iti p h i o n“ und „A n t igone“, ließ weitaus mehr den Atem des Genies spüren. Freilich war er an beiden Werken im Sinne des Experimentes verschwendet worden. Während „Amphion“, musikalisch die Atmosphäre der „Jeanne d'Arc“ vorwegnehmend, an der Diskrepanz zwischen der Kürze des Werkes und den enormen Aufführungsmitteln eines „Gesamtkunstwerkes“ leidet, liegt das Problem in der „Antigene“ an der Behandlung des Textes von Cocteau, der, betont unpathetisch und banal, mit der nach Höherem strebenden Musik nicht recht harmonieren will; ganz abgesehen davon, daß er — nach dem Motto des Dichters, der Griechen-Tand „vom Flugzeug betrachten“ wollte — beinahe im Tempo des gesprochenen Wortes abgehaspelt wird.
Wenn also die Bilanz dieser Woche künstlerisch noch keine Aspekte auf eine Lösung der Probleme vermittelte, so gibt die geleistete Arbeit dem Zürcher Stadttheater ein durchaus ausgeprägtes, persönliches Profil, das Interesse erweckt und durchaus beispielhaft genannt werden kann. Denn- nicht aus der Genußsucht, sondern nur aus dem Interesseeines vielleicht anfänglich noch kleinen Publikums kann der modernen Oper eine Zukunft erblühen.
Es wird daher nicht uninteressant sein, kurz die Bedingungen zu streifen, unter denen solche Leistungen zustande kommen. Das Zürcher Opernhaus besitzt kein Repertoire in unserem Sinn, es werden lediglich bestimmte Werke einstudiert und eine kurze Zeit lang quasi en suite gespielt, bis sie wieder abgesetzt werden. Es finden sich unter diesen Werken natürlich auch Standardwerke des Repertoires, aber auch in weit höherem Maße, als dies bei einem ausgesprochenen Repertoiretheater überhaupt möglich ist, Werke.der Moderne, deren Zugkraft auch in Zürich nicht viel stärker ist, als sie; es in Wien wäre. — Im musikalischen Sektor liegen die günstigen Bedingungen in der Verpflichtung so hervorragender Musiker und „Spezialisten“ wie Haiis R o s b a u d und Victor Reinshagen. Ihnen gelang es, die freilich auch ihrer ganzen Vorbildung nach durchaus aulgeschlossenen Musiker zu 'einem Ensemble zu. machen, das moderne Musik mit wirklichem Verständnis spielt. Gleiche Geschlossenheit läßt sich auch im Ensemble auf der Bühne konstatieren, obwohl es nur in den kleineren Partien „fest“ und für die Hauptrollen auf Kräfte des Auslandes angewiesen ist. \ V“' k .',
Und damit kommen wir zu dem vielleicht wesentlichsten, Punkt: Voraussetzung für einen derartigen Spielplan ist doch in erster Linie Verständnis und Entgegenkommen bei Geldgebern und Behörden, Verständnis dafür, daß das zur Verfügung gestellte Geld „unsichtbar“ investiert wird, d. h. in Proben und noch einmal Proben. Die Zumutung ist für viele hart: man „sieht“ nicht die Gegenleistung, sei sie selbst meritorischer Art, für das. was man gegeben hat. Und es kann gut möglich, sein,. daß die prgani-satorischen Krisen, die die Leitung des Instituts, derzeit mitmacht — und von denen man glücklicherweise auf der Bühne ebensowenig „sieht“ —, auf derlei Gründe zurückgehen. Es wäre schade, nein, es wäre ein kultureller Verlust, wenn solche Krisen das gegenwärtige Gesichf des Hauses ändern würden. Denn ein Profil ohne Repertoire ist — quod erat demonstrandum - durchaus möglich, ein Repertoire ohne Profil macht die Oper zum Museum.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!